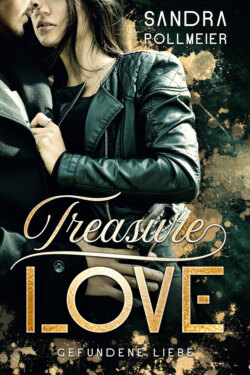Читать книгу Treasure Love - Sandra Pollmeier - Страница 8
3
Оглавление„Du siehst absolut hinreißend aus.“
Noah sah mich voller Bewunderung an. Hinreißend. Das war ja mal ein geschwollenes Wort. Wenn er mein Inneres hätte sehen können, hätte er wohl eher elendig gesagt. Aber allem Anschein nach konnten mein perfekt sitzendes rotes Kleid und mein eigens von einer Kosmetikerin aufgetragenes Make-Up über diese Tatsache hinwegtäuschen. Die hatte mich wegen meiner geschwollenen, verheulten Augen zwar sehr mitleidig angesehen, jedoch zu diesem Thema professionell geschwiegen und dann ganze Arbeit geleistet.
Der Concierge des geschichtsträchtigen Atlantik-Hotels an der Hamburger Außen-Alster geleitete uns durch das immer noch andauernde Schneetreiben mit einem großen Regenschirm über den roten Teppich in das prunkvolle Gebäude. Am Eingang des Festsaals drängte sich bereits eine Traube edel gekleideter Menschen zusammen, allesamt Mitglieder der oberen Hamburger Bildungs- und Einkommensschicht. Eine freundlich lächelnde Bedienung reichte uns Champagner auf einem Silbertablett und ich geriet in ehrfürchtige Bewunderung, als wir den zirka 8 Meter hohen, Stuck verzierten und mit prachtvollen Kronleuchtern behangenen Ballsaal betraten, in dem die ganz in Weiß und Silber eingedeckten Tische auf die Gäste warteten. Überall brannten Kerzen und es duftete nach den üppigen Rosenbouquets, die den Saal schmückten. Das gesamte Szenario erinnerte an eine Sequenz aus einem Märchenfilm, und ich erwartete beinahe, Aschenbrödel an mir vorbeihuschen zu sehen, wie sie mit ihrem Prinzen im Walzerschritt tanzte.
Wir setzten uns auf die extra für uns reservierten Plätze, und während ein Dutzend gleich gekleideter Kellner das sündhaft teuer aussehende Entrée zu Tisch reichte, stimmte ein dezentes Streichorchester sanfte Melodien von Mozart an. An jedem anderen Tag hätte ich diese überwältigenden Eindrücke geradezu in mich aufgesogen, aber heute bewirkten sie nur, dass ich mich noch trauriger und deplatzierter fühlte.
„Schade, dass dein Bruder uns doch nicht begleiten konnte“, durchbrach Noah mein langes Schweigen. Vermutlich war es ihm nicht entgangen, dass ich mit meinen Gedanken gerade ganz woanders war.
„Egal.“ Ich schenkte Noah ein halbherziges Lächeln und zuckte bedauernd mit den Schultern. „So kenne ich Ben halt. Ihn hält es nie lange an einem Ort. Hätte mich gewundert, wenn es anders gelaufen wäre.“ Während ich einen weiteren tiefen Schluck aus meinem Weißweinglas nahm, zog Noah einen Umschlag aus seinem Smoking.
„Tja, ich weiß ja nicht, warum er es so eilig hatte, aber er hat dem Taxifahrer etwas gegeben, das er an mich weitergeleitet hat. Vermutlich ist es dein Stammbuch.“
Durch das Papier des DIN-A5-Umschlags fühlte ich die Kanten eines Buches. Unglaublich, dass Ben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht hatte, es wieder zu mir zurückzubringen. Stattdessen gab er diese wichtigen Unterlagen lieber einem Taxifahrer, der ihn eigentlich nur hatte zum Weihnachtsball abholen sollen.
Betont uninteressiert ließ ich den Umschlag in meine Handtasche gleiten und fasste stattdessen nach Noahs Hand. „Lass uns nicht mehr von Ben reden. Es ist sehr schön hier und ich freue mich, dass wir diesen besonderen Abend zusammen verbringen dürfen. Danke, dass du mich hierzu eingeladen hast.“
Klang das zu gestelzt? Zu unehrlich? Aber Noah schien nichts zu bemerken. Stattdessen hob er meine Hand vorsichtig an seine Lippen und hauchte einen galanten Kuss auf meine Fingerspitzen.
„Weißt du, Sofia, dies ist ein besonderer Abend und ich dachte, dass wir ihn auch besonders ausklingen lassen“, bemerkte Noah, während er mir tief in die Augen sah. „Ich war so frei und habe für heute Nacht eine Suite im Atlantik-Hotel gebucht. Ganz oben, mit Blick über die Alster. Ich würde mich freuen, wenn du nach der Feier dort bei mir bleibst.“
Oh Gott! Ich hätte es ahnen müssen. Schon seit einigen Wochen hatte Noah so geheimnisvoll getan. Eine Suite im Atlantik mit Blick auf die Alster – das hatte sicher ein kleines Vermögen gekostet. Wie hätte er auch ahnen können, dass ich gerade heute überhaupt nicht in der Stimmung dazu war, mit ihm eine romantische Nacht zu verbringen? Ehrlich gesagt – es war peinlich genug – hatten Noah und ich überhaupt noch keine Nacht miteinander verbracht. Wir hatten über ein halbes Jahr gedatet, bevor er sich getraut hatte, mir körperlich näher zu kommen. Es folgten zaghafte Küsse und ein paar zärtliche Berührungen, doch mehr hatten wir beide bisher nicht gewagt. Meine Freundin Stella hatte immer entsetzt den Kopf über mich geschüttelt. „Du bist so bescheuert“, konnte ich mir beinahe täglich von ihr anhören. „Er mag dich und er will dich und du hebst dich auf für was? Für einen Mann, der seit über zwei Jahren spurlos verschwunden ist? Mit dem du nur eine einzige Nacht verbracht hast? Und der sich – entschuldige bitte die Wortwahl – in den letzten Jahren sicherlich quer durch die verschiedensten Betten gevögelt hat? Dir ist nicht mehr zu helfen…“
Natürlich hatte sie Recht. Stella hatte immer Recht. Und doch konnte ich nichts für meine Gefühle und hielt Noah freundlich, aber bestimmt auf Abstand – so lange, wie er sich das eben gefallen ließ. Und das war schon länger, als ich zu hoffen gewagt hatte.
Heute Abend wollte er also das Blatt wenden. Ausgerechnet heute Abend!
„Aber… ich habe doch gar nichts mitgenommen“, stammelte ich unsicher. „Ich kann hier doch morgen früh nicht im Ballkleid zum Frühstück erscheinen.“
„Keine Sorge“, schmunzelte Noah verführerisch. „Stella hat mir vor ihrer Abreise heimlich geholfen. Ich habe ein paar Dinge aus deinem Kleiderschrank entwendet – entschuldige bitte. Es ist für alles gesorgt. Sag einfach ,ja`. Du würdest mich sehr glücklich machen.“
Stella, diese kleine Intrigantin! Wieso hatte sie mich nicht vorgewarnt? Wenigstens eine Andeutung gemacht? Jetzt saß ich hier und wusste nicht, welche Ausrede ich mir dieses Mal einfallen lassen konnte. Nun hatte Noah mich wirklich genau da, wo er mich haben wollte.
„Was soll ich sagen“, flüsterte ich verlegen. „Ich bin total…“, ich suchte nach dem richtigen Wort, doch es fiel mir einfach nicht ein. „…begeistert“, log ich mit einem gespielten Lächeln und schimpfte in Gedanken mit mir selbst. Lügnerin! Betrügerin! Das kann doch alles nicht…
„Danke. Du machst mich zum glücklichsten Mann heute Abend.“ Galant hauchte Noah einen weiteren Kuss auf meine Fingerspitzen, dann stellte er sich auf, verbeugte sich altmodisch vor meinem Platz und bat höflich um einen Tanz.
Im Walzerschritt ließ ich mich von ihm führen. Herum, herum, herum,… Die Welt drehte sich um mich, und jetzt, wo ich mich bewegte, begann ich auch den Wein zu spüren, der meine Sinne betäubte. Vielleicht sollte es so sein. Vielleicht hatte ich diesen radikalen Bruch gebraucht, um von Ben loszukommen. Ben, Ben, Ben…? Hatte ich ihn eigentlich je richtig gekannt? Oder hatte ich nur all meine jugendlichen, mädchenhaften Sehnsüchte auf ihn projiziert, weil ich so sehr jemanden gebraucht hatte, den ich anhimmeln konnte?
Es war nicht mehr wichtig.
Der Abend verflog mit sanften Orchesterklängen, Champagner und Kaviarhäppchen und endete mit einer weihnachtlichen Lichtershow auf der Dachterrasse, die ihresgleichen suchen musste. Noah hielt mich fest in seinen Armen und seine Augen leuchteten, als er mich schließlich zu unserer Suite führte. Als er aufschloss, stockte mir der Atem. Sie war noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt hatte: Ein mindestens 40 qm großes Appartement eröffnete sich uns, bestehend aus zwei hohen Räumen, die durch einen Wanddurchbruch miteinander verbunden waren. Rechts lag der Wohnraum mit ausladenden, antik anmutenden Ledersesseln, Couchtisch, Minibar und atemberaubendem Blick über die Alster; links befand sich das Schlafzimmer mit King-Size-Bett, Kronleuchter und Brokatvorhängen vor dem Fenster. Auf dem Sekretär aus Mahagoniholz stand ein mit Eis und einer Flasche Champagner befüllter Sektkühler. Doch trotz meines nicht gerade niedrigen Alkoholpegels fühlte ich mich mit einem Schlag wieder erschreckend klar und während eines Sekundenbruchteils wusste ich plötzlich ganz genau, was ich jetzt tun musste: ich musste hier weg!
„Endlich“, flüsterte Noah in mein rechtes Ohr, während er hinter mich trat und mir eine lose Haarsträhne aus dem Nacken strich. Seine Hände streiften meine Schultern und fuhren an meinen Armen herunter bis zu meinen Hüften. Dort hielt er mich fest und zog mich eng an sich heran. Oh Gott, ich musste etwas tun. Jetzt. Sofort. Sonst war es zu spät.
„Ich muss mal eben ins Bad“, log ich und entschlüpfte Noahs Umarmung, ehe sie zu fordernd wurde. Mit einem Lächeln auf den Lippen hob er seine Hände entschuldigend in die Höhe und ließ mich an sich vorbeigehen. „Ich warte auf dich“, raunte er mir hinterher und ließ sich auf der Bettkante nieder, zog die Fliege von seinem Hals und lockerte seinen Kragen.
Das Bad war perfekt, genauso wie der Rest der Luxussuite. Dunkler Marmor, riesige Badewanne, Doppel-Waschbecken mit Designer-Wasserhahn. Alles vom Feinsten. Ich drehte den Kran auf, klatschte mir etwas Waser ins Gesicht und starrte in den Spiegel. Was nun? Hier im Bad war ich gefangen. Kein Fenster, keine zweite Tür. Er würde es sofort bemerken, wenn ich das Zimmer verließ. Ich musste mir schnell etwas anderes überlegen. Mein Blick fiel auf die dicken bordeauxroten Badetücher über dem Spiegel. Vielleicht wäre das meine Chance? Während ich die Badewanne volllaufen ließ, raffte ich mein Kleid hoch und wickelte mich in das Badetuch ein, bis es so aussah, als hätte ich das Kleid bereits ausgezogen. Dann drapierte ich mit einem Handtuch einen Turban über meine noch hochgesteckten Haare, atmete tief durch, öffnete die Tür einen Spalt breit und lugte vorsichtig hindurch. Noah saß noch immer auf der Bettkante und lächelte verführerisch, als ich zu ihm herüberblickte. „Na, soll ich dir beim Baden helfen?“, fragte er mit anzüglichem Unterton und stand auf, um zu mir zu kommen. Schnell zog ich die Tür etwas enger zu.
„Noah, es tut mir ganz schrecklich leid, aber mir fällt ein, dass ich meine Handtasche unten im Saal habe liegen lassen. Da ist etwas drin, das ich dringend brauche. Wärest du so lieb und gehst sie holen?“
An Noahs etwas enttäuschtem Blick konnte ich gut erkennen, dass er sich etwas anderes erhofft hatte. Aber ganz Gentleman, der er nun einmal war, schenkte er mir ein freundliches Lächeln und schloss den Kragen seines geöffneten Hemdes. „Natürlich mache ich das, Sofia. Bleib, wo du bist, ich bin in fünf Minuten wieder hier.“
Er verschwand auf den Flur hinaus, die Tür fiel mit einem leisen „Klack“ ins Schloss. Bleib, wo du bist! Als ob er es ahnen würde. Hastig entfernte ich das Badetuch und das Handtuch von meinen Haaren und schlüpfte zurück in meine Schuhe. Noah hatte gesagt, er hätte neutrale Kleidung für mich mitgenommen, doch es blieb mir keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Also schnappte ich mir meine hellgraue Strickjacke aus dem Schrank und eilte aus dem Zimmer. Auf dem Flur angekommen, suchte ich den Notausgang über das Treppenhaus, denn ich wollte es vermeiden, am Aufzug meinem erstaunten Freund in die Arme zu laufen. Als ich die Stufen der Treppe nach unten rannte, verfluchte ich die schicken High Heels, die ich mir extra für diesen Abend zugelegt hatte. Warum hatte ich mir nicht wenigstens so viel Zeit genommen, meine Sneaker zu suchen, die Noah sicherlich auch für mich eingesteckt hatte? Scheiße! Auf halber Strecke vom fünften Stock abwärts blieb ich stehen und zog meine Schuhe aus, um schneller voranzukommen. Als ich endlich dne Eingangsbereich erreichte, drosselte ich mein Tempo und ging betont ruhig und barfuß, mit meinen Pumps in der Hand, am verwunderten Concierge vorbei. Draußen hatte es erneut begonnen zu schneien, eine eisige Kälte schlug mir entgegen. Es nutzte nichts, die Schuhe mussten wieder an die Füße. Ungelenk hielt ich mich an der Eingangstür fest, während ich mich in meine wackeligen High Heels zwängte, und der vorhin noch unentschlossene Concierge sprang mir sogleich zur Hilfe.
„Madame, wollen Sie wirklich so nach draußen gehen?“, fragte er mich unsicher, während er meinen Arm stützte. „Heute Nacht soll es Minusgrade geben und der Schneefall wird immer stärker. Kann ich Ihnen ein Taxi rufen?“
„Nein danke.“ Ich schenkte ihm ein verlegenes Lächeln. Sicher musste er von mir denken, dass ich total betrunken war, womit er auch nicht ganz falsch lag, aber das spielte jetzt auch keine Rolle mehr. Natürlich wäre es intelligent gewesen, wenn ich wenigstens meine Handtasche, die natürlich nicht im Ballsaal, sondern auf der Couch in unserer Suite lag, mitgenommen hätte. Ich konnte kein Taxi nehmen. Mein Portemonnaie mit all meinen Kreditkarten, meinem Ausweis und sogar mein Handy waren unerreichbar für mich.
„Ich muss nicht weit gehen, alles gut“, beruhigte ich den besorgten Hotelangestellten. „Vielen Dank für Ihre Hilfe.“
Und so stakste ich vorsichtig die Treppe herunter, zog meine dünne Strickjacke fest um meinen Körper und stürzte mich ins Schneegestöber.
Das Hyatt Park Hotel war nur wenige Straßenzüge vom Atlantik entfernt, aber der Weg erschien mir unendlich lang. Der Schnee durchnässte meine Haare und meine dünne Kleidung, meine Schuhe rutschten ständig unter mir weg, denn zum Wandern längerer Strecken bei Eisglätte waren sie nun wirklich nicht geeignet. Inzwischen musste es mindestens ein Uhr nachts sein, und auch in einer Stadt wie Hamburg wagten sich um diese Zeit und bei einem derartigen Wetter nicht mehr viele Menschen auf die Straßen. In einem Kellereingang saß in Decken gehüllt ein Penner. Er hielt eine Flasche Ouzo in den mit Handschuhen bedeckten Händen und sah mich an, als hätte er soeben das Christkind vorbeihuschen sehen. Sein altersschwacher Mischlingshund stand auf, lief zu mir, schnupperte an meinen gefrorenen, tauben Fingern und drehte schließlich wieder um, um zu seinem Herrchen zurückzukehren. Ich stapfte weiter, an dunklen Hauseingängen und zwielichtigen Hinterhöfen vorbei, immer weiter, Schritt für Schritt. Um mich vom Klappern meiner Zähne abzulenken, summte ich alte Kinderlieder vor mich hin. Dabei biss ich meine Zähne so fest zusammen, dass sich mein Kiefer verkrampfte. Schritt für Schritt arbeitete ich mich vor durch den kalten Matsch unter meinen Füßen, den Blick nach unten gerichtet, die Arme fest vor meinem Körper verschränkt. An eine Mauer gelehnt zündete sich ein blutjunges Mädchen, das offenbar dem horizontalen Gewerbe nachging, eine Zigarette an. Sie trug eine billige Kunstfelljacke, Minirock und Overknee-Stiefel über schwarzen Netzstrümpfen. Die Wimperntusche unter ihren Augen war verlaufen, die blond gefärbten Haare nass vom Schnee. Am liebsten hätte ich einen großen Bogen um sie gemacht, doch das ließen meine tauben Füße schon längst nicht mehr zu.
„Mann, siehst du Scheiße aus.“ Sie lachte trocken, als ich ungefähr auf ihrer Höhe war. „Wer immer dich losgeschickt hat, hat noch weniger Anstand als Johnny, der Arsch. Magst du eine zum Warmwerden?“
Mit einem schiefen Grinsen hielt sie mir eine Packung Zigaretten unter die Nase. Verlegen hielt ich inne. So eine freundliche Geste hatte ich nicht erwartet und es beschämte mich ein wenig. Und obwohl ich so gut wie noch nie im Leben geraucht hatte, griff ich dankend zu und ließ mir von der Fremden Feuer geben.
„Wo willst du denn heute noch hin, eine Nacht vor Heiligabend?“, fragte mich das Mädchen, das ich kaum älter schätzte als sechzehn. „Zum Hyatt Park Hotel“, flüsterte ich mit bibbernden Lippen und begann zu husten, als der Rauch meine Lungen füllte.
„Ah, so edel?“, sinnierte die Fremde. „Dein Freier muss gut Kohle haben. Da musst du mehr rausholen als einen Blowjob, hörst du?“
Ich grinste und nickte bestätigend. Wenn du wüsstest, Kleine!
„Danke für die Zigarette.“ Sie tat mir wirklich
leid, aber es gab nichts, was ich in diesem Moment für sie hätte tun können.
„Nicht dafür“, wiegelte das Mädchen mit einer lockeren Handbewegung ab und ich setzte meinen Weg fort.
Was versprach ich mir eigentlich von dieser Aktion? Kopflos wie eh und je war ich losgestürzt, ohne über die Folgen nachzudenken. Vielleicht war Ben ja schon abgereist. Dann stünde ich schön dumm da, ohne Geld und Handy. Nicht einmal meine Wohnungsschlüssel hatte ich mitgenommen!
Aber kurz bevor ich mich vollkommen meinen elenden Gedanken hingeben konnte, entdeckte ich hinter der nächsten Straßenbiegung die hell erleuchtete Fassade des Hyatt Park Hotels. Mit letzter Kraft schleppte ich mich zum Eingang. Keine fünf Minuten länger hätte ich in dieser Kälte ausgehalten. Mein Körper war wie betäubt, und als ich in die Wärme der Empfangshalle trat, fühlte es sich an, als würden tausend feine Nadeln auf mich einstechen. Mit wackeligen Füßen taumelte ich auf den entsetzt dreinblickenden jungen Mann zu, der die Nachtschicht an der Rezeption hatte. Sicher wog er gerade in Gedanken ab, ob er wegen mir die Polizei oder einen Krankenwagen herbeirufen sollte.
„Guten Abend“, begrüßte ich den verwirrten Hotelmitarbeiter möglichst freundlich. „Ich hätte gerne die Zimmernummer von Herrn Benjamin Stevens. Er hatte mir gesagt, dass er heute Nacht in Ihrem Hotel untergekommen ist.“
In meiner Aufregung konnte ich mich beim besten Willen nicht mehr an die Zahl erinnern.
„Oh, Gott, bitte lass´ ihn noch hier sein!“, betete ich in Gedanken. Der junge Mann presste unschlüssig die Lippen aufeinander. „Bitte verzeihen Sie, aber ich kann Ihnen nicht einfach die Zimmernummer eines unserer Gäste geben. Das fällt unter Datenschutz.“ Mitleidig zog er seine Stirn in Falten und machte eine entschuldigende Handbewegung.
„Dann rufen Sie ihn an. Ganz einfach.“ Ich atmete tief ein und versuchte, Ruhe zu bewahren.
„Es ist mitten in der Nacht. Um diese Uhrzeit stören wir unsere Gäste nicht mehr. Rufen Sie Ihren Bekannten doch einfach selber an und informieren Sie ihn über Ihren Besuch.“
So langsam begann meine Geduld zu bröckeln.
„Sehen Sie hier irgendwo ein Handy?“, fragte ich mit zitternder Stimme und zog dabei demonstrativ meine dünne Strickjacke aus, die völlig durchnässt über meinen Schultern gehangen hatte. Der junge Mann musterte mich mit hochgezogenen Augenbrauen. Anscheinend entging es ihm nicht, dass mein sündhaft teures Abendkleid nicht dem Kleidungsstil einer drogensüchtigen Prostituierten entsprach.
„Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich habe meine Anweisungen und ich möchte nicht…“
Entnervt ließ ich meine Jacke und die Pumps zu Boden fallen. „Wissen Sie“, japste ich mit letzter Kraft und stemmte meine Hände auf die Hüften, „entweder Sie rufen jetzt meinen Bruder an, oder ich schreie so laut, dass das ganze Hotel davon wach wird. Und dann können Sie mich gerne von der Polizei abholen lassen, aber der Vorfall wird sich herumsprechen, da können Sie Gift drauf nehmen!“
Ich sah, wie der junge Mann schluckte und seine Augen sich erschrocken weiteten. Lieber ein verärgerter Gast als eine unschöne Schlagzeile in der Boulevardpresse. Mit einer beschwichtigenden Geste griff er zu seinem Telefon. Es schien endlos zu klingeln, doch dann holte der Hotelmitarbeiter tief Luft und stotterte verlegen in den Hörer.
„Ja, Herr Stevens. Bitte entschuldigen Sie die späte Störung. Aber hier im Foyer steht eine junge Dame, die behauptet, Ihre Schwester zu sein, und die dringend mit Ihnen reden möchte. Sie scheint zu Fuß durch den Schnee gekommen zu sein… ja… genau… vielleicht würden Sie… Ja, das mache ich… Vielen Dank, Herr Stevens.“
Wenn er mir jetzt mitteilte, dass Ben nicht mit mir sprechen wollte, dann würde ich sterben. Jetzt und hier. Vor Scham. Und vor Wut. Und vor Verzweiflung.
Der junge Mann legte das Telefon zurück unter die Theke. „Es ist in Ordnung.“ Er nickte mir zu. „Herr Stevens wird gleich nach unten kommen. Er ist schon auf dem Weg.“
27. März 1854
Heute war es ungewöhnlich warm gewesen für einen Frühlingstag an der See. Matilda hatte zum ersten Mal in diesem Jahr ihre Schuhe und Strümpfe ausgezogen und war barfuß den Strand entlanggelaufen. Ihre Arbeit auf dem Gutshof ließ ihr nicht viel Zeit zum Müßiggang. Seit fünf Uhr morgens war sie auf den Beinen, hatte die Kühe gemolken und die Pferde zur Koppel geführt. Dann hatte sie das Frühstück für den Gutsherrn serviert, die Küche geputzt und der Köchin beim Zubereiten des Mittagessens geholfen. Weiter ging es mit Dielen schrubben, Wäsche waschen und zum Trocknen aufhängen. Am Abend führte sie zusammen mit dem Knecht die Pferde von der Koppel in den Stall, fütterte und striegelte sie, bis die Sonne schon fast das Meer berührte. Erst dann begab sie sich auf den Heimweg. Natürlich hätte sie den Weg durch die Dünen nehmen können, vorbei an den windschiefen Häusern im Dorf, deren weit heruntergezogene Dächer beinahe bis auf die Erde reichten – aber Matilda liebte das Meer, den Wind, die Weite und das Gefühl von Freiheit und zog es vor, den Umweg am Strand entlang zu nehmen. Während die Sonne am Horizont verschwand, raffte sie ihre Kleider hoch und ließ ihre schmerzenden Füße vom Salzwasser umspülen. Dann schloss sie die Augen, füllte ihre Lungen tief mit der salzigen Luft und ließ die Mühen des Tages langsam aus sich herausströmen, Atemzug für Atemzug. Das Rauschen des Meeres und das Krächzen der Möwen hüllte sie ein wie eine freundliche Umarmung. Langsam ließ sie ihre hochgerafften Kleider los und streckte die Arme gen Himmel. Sie war eins mit dem Meer. Sie war eins mit dem Wind. Sie war frei…
Doch mit einem Mal schnellte etwas mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbei. Zu allen Seiten spritzte Wasser und durchnässte ihre Kleider und Haare. Erschrocken fuhr sie herum, geriet ins Taumeln, fing sich wieder und sah in einiger
Entfernung ein schwarzes Pferd den Strand entlang galoppieren. Es gab nur einen Mann, der auf der kleinen, 230 Seelen zählenden Insel ein solches Pferd besaß – ihr Dienstherr und Gutshofbesitzer Martin Stevens.
Eigentlich kannte sie ihn nur aus der Ferne. Kaum drei Sätze hatte sie bisher mit ihm gewechselt, denn Stevens sprach nicht viel und überließ die Anweisungen an das Personal seinem Verwalter. Zweifellos war er eine ganz besondere Erscheinung. Seine dunklen, von wenigen grauen Strähnen durchzogenen wilden Haare umrahmten sein scharf geschnittenes, stets ernst und unnahbar blickendes Gesicht. Die tiefe Falte zwischen seinen Augenbrauen schien wie eingemeißelt und ließ ihn härter wirken, als er tatsächlich war. Stevens war erst vor ein paar Jahren auf die Insel gekommen und pflegte keinen Kontakt zu den übrigen Insulanern. Die waren seit jeher ein stures Volk, das „Eindringlinge“ vom Festland misstrauisch beäugte. Doch ein halber Engländer, wie Stevens einer war, mit seinem aristokratischen Aussehen und seinem vielen Geld wurde erst recht gemieden. Nicht dass es dem Gutsbesitzer etwas auszumachen schien. Es war, als ob er sich die Abgeschiedenheit dieser Insel ganz bewusst ausgesucht hätte. Nie bekam er Besuch, niemals verreiste er selber - bis auf dieses eine Mal im vorletzten Sommer, als er mit seiner schönen, aber ebenso kühlen Ehefrau Rebecca heimkehrte. Rebecca Stevens war nicht viel älter als Matilda, aber sie regierte den Hof mit einer alles beobachtenden Strenge, so dass viele der Angestellten Angst vor ihr hatten. Ähnlich wie Martin Stevens sah man sie nie lächeln, aber dennoch strahlte sie deutlich mehr Härte aus als er. Anstatt der einsamen Melancholie, die ihren Mann umgab, wirkte ihr Blick kalt wie der schneidende Nordwind im Winter.
Vielleicht – so hatte Matilda sie manchmal in Schutz genommen – lag ihre harte Art an den drei erfolglosen Schwangerschaften, die sie in den vergangenen eineinhalb Jahren durchgemacht hatte. Jedes Mal hatte sie nach wenigen Monaten starke Blutungen bekommen und das Kind, das in ihr heranwuchs, verloren. Die Unfähigkeit, ihrem Mann ein gesundes Kind zu schenken, hatte sie vergrämt und hart und unerbittlich gegenüber anderen Menschen gemacht. So zumindest sah es Matilda…
Während sie ihre nassen Kleider zusammenraffte und zurück an den Strand stolperte, dorthin, wo sie ihre Holzschuhe zurückgelassen hatte, sah sie, wie der Reiter das Pferd zügelte, anhielt und in einem weniger rasanten Tempo in ihre Richtung zurückkehrte.
„Verzeih mir, bitte“, hörte sie eine eigenartig fremd klingende, aber freundliche Stimme, als sie das Wasser aus dem Saum ihres Kleides wrang. „Ich habe dich zu spät gesehen und konnte ihn nicht mehr bremsen. Jetzt bist du völlig durchnässt. Vielleicht kann ich es wiedergutmachen, indem ich dich ein Stück mitnehme? Wo wohnst du?“
Erstaunt blickte Matilda zu Martin Stevens herauf. Nicht nur, dass er zurückgekommen war, um sich bei einer einfachen Magd zu entschuldigen… Er wollte sie mitnehmen? Auf seinem Pferd? Die Leute aus dem Dorf würden sich ihre Mäuler über sie zerreißen, wenn irgendjemand das mitbekommen sollte! Eine junge, alleinstehende Magd, zusammen auf einem Pferd mit dem Gutshofbesitzer! Eine Ungeheuerlichkeit! Bei dem Gedanken musste sie lächeln. Das Gerede der Leute hatte sie schon immer herzlich wenig gestört und die Versuchung war einfach zu verlockend.
„Ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Ich weiß nicht, wie das geht…“, stammelte sie verlegen und wunderte sich erneut, denn nun sah sie auch etwas, das ihr bis dato fremd gewesen war – Martin Stevens lächelte! Es war ein so freundliches und gütiges Lächeln, dass es sie mehr schwanken ließ als der wilde Hengst, der gerade noch an ihr vorbei galoppiert war.
„Es ist ganz einfach, komm! Ich ziehe dich hoch, du musst nur deinen Fuß in diesen Steigbügel stellen und dich ein wenig hochdrücken…“ Mit einem festen Ruck hatte Stevens sie mühelos nach oben gezogen und Matilda schräg vor seinen Sattel gesetzt. Ganz nah saßen sie beieinander, eine warme Woge durchfuhr sie bis in die Fußspitzen, obwohl der Wind aufgefrischt hatte und durch ihre nassen Kleider fuhr. „Warte“, bat Stevens und zog sogleich seinen Mantel aus, um ihn um ihre schmalen Schultern zu wickeln. Nachdem er sie so eingehüllt hatte, nahm er wieder die Zügel in die Hand, zog Matilda schützend in seine Arme und gab seinem Pferd mit einem schnalzenden Laut zu verstehen, dass es nun lostraben konnte.
Kreischende Möwen flogen an ihnen vorbei, die Gischt spritzte unter den Hufen des Hengstes, doch Matilda nahm nichts davon wahr. Nichts außer den starken Armen, die sie sicher hielten, den warmen Geruch seines Mantels und die Kanten seiner Schultern, an die sie sich lehnte, während die Welt um sie herum sich veränderte. Denn obwohl alles so aussah wie immer, wurde Matilda an diesem Abend eine Sache bewusst: Ab heute war nichts mehr wie zuvor. Dieser Mann würde ihr Schicksal sein. Ein Schicksal, das besiegelt worden war in dem Moment, in dem sie seine Hand genommen hatte, um sich von ihm nach oben ziehen zu lassen…