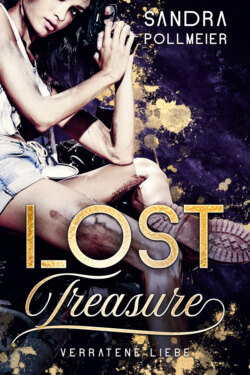Читать книгу Lost Treasure - Sandra Pollmeier - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеWir liefen wortlos hintereinander her und ich spürte, wie ich mit jedem weiteren Schritt mein altbekanntes Leben – oder vielmehr das, was noch davon übriggeblieben war – hinter mir ließ.
Nach dem schrecklichen Brand in dem Retro-Nachtklub von Madame Monique gab es für Ben und mich kein Zurück mehr. Verfolgt von fremden Menschen, die es auf die Schatzkarte abgesehen hatten, die mein Vater bei einer Expedition auf den Seychellen gefunden hatte, mussten wir dringend untertauchen. In Hamburg waren wir nicht mehr sicher.
Von der Seitenstraße aus, in der wir unseren Wagen geparkt hatten, sah ich die Einsatzkräfte mit Atemmasken bekleidet hektisch hin und her laufen. Auf ihren Armen trugen sie leblose Körper. Der ganze Block war inzwischen in dichte Rauchwolken gehüllt, doch nur wenige Schaulustige hatten sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eingefunden, um das schreckliche Szenario aus nächster Nähe zu betrachten. Hier, im größtenteils stillgelegten Gewerbegebiet, gab es nicht viele Anwohner. Die Sonne tauchte langsam auf hinter den grauen Häusern der Stadt, als Ben hastig den Motor aufheulen ließ und ohne sich anzuschnallen in Richtung Innenstadt fuhr. Müde sackte ich auf dem Beifahrersitz zusammen. Ich hatte keine Ahnung, wohin wir fuhren, aber ich fühlte mich zu erschlagen, um meinen Bruder danach zu fragen. Es verging eine gefühlte Ewigkeit, bevor Ben endlich wieder ein Wort zu mir sagte. Ich zuckte zusammen, als ich plötzlich seine raue Stimme neben mir vernahm. „Tony und Nadja werden uns nicht erwähnen. Ich habe mit beiden gesprochen, wir können ihnen vertrauen.“ Dann verstummte er und ich hakte nicht weiter nach, ob Nadja und Tony nicht verwundert über unsere Flucht waren. Es interessierte mich nicht. Über zu viele Dinge hatte ich mir in den letzten Tagen den Kopf zerbrochen. Jetzt wollte ich an nichts mehr denken, mich ausnahmsweise nur treiben lassen.
Wir fuhren an diesem Morgen nicht nach Hause. Niemand durfte uns sehen, niemand sollte uns folgen können. Ich bezweifelte zwar, dass Bens Bekannte Dana sich noch im Haus aufhielt, nachdem ich sie mit einer Waffe bedroht und an einen Stuhl gefesselt hatte, doch sicher waren wir uns da nicht. Vielleicht hatten wir ja eine Chance, wenn Onkel Michaels „Hintermänner“ dachten, wir wären genauso wie er in der Feuersbrunst ums Leben gekommen. Natürlich zusammen mit dem ach so begehrten französischen Brief. Alles vernichtet, kein Grund mehr, diese Angelegenheit weiter zu verfolgen. Wir wären frei! Und doch glaubte ich nicht an diese Theorie. Irgendwann würden sie doch erfahren, dass wir noch lebten. Aber vielleicht hätten wir dann genügend Zeit gewonnen, um sie abzuschütteln.
Den ersten Zwischenstopp auf unserer Reise legten wir bei Bens Kumpel Oskar ein. Lange konnten wir dort nicht bleiben, wir mussten dringend Hamburg verlassen. Aber ohne Geld, Kleidung und Papiere war das ein schwieriges Unterfangen. Oskar war ein tätowierter und dutzendfach gepiercter Heavy Metal-Freak, der nicht begeistert über unser Erscheinen war. Er nahm es seinem Freund Ben immer noch übel, dass dieser Oskars geliebte Harley in der vergangenen Nacht auf dem Ohlsdorfer Friedhof hatte stehen lassen. Ben erzählte ihm eine haarsträubende Geschichte, deren Inhalt sich darum drehte, dass Ben angeblich von der Polizei gesucht würde, weil er illegal erworbene Autos nach Polen vertickt hatte. Das schien Oskar aus unerfindlichen Gründen zu verstehen, und so half er uns dabei, Bens alten Ford gegen einen klapprigen Polo einzutauschen. Er besorgte uns auch ein paar neue Klamotten und stieg sogar in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in unser Haus ein, um uns unsere Papiere, Kreditkarten und einige Wertsachen zu besorgen. Natürlich bekam er für diese Unterstützung ein sattes Honorar.
Am Dienstag nach unserem „Tag X“ im Excelsior sprang mir schon am Frühstückstisch die riesige Schlagzeile auf dem Titelblatt der Hamburger Morgenpost ins Auge: „Brandkatastrophe in illegalem Tanzklub - 73 Tote“. Meine Finger zitterten, als ich die Zeitung zu mir heranzog, und das eben noch gekaute Brot blieb mir in der trockenen Kehle stecken. Hastig überflog ich die Zeilen und suchte nach einem Hinweis auf Ben und mich – doch anscheinend hatten Tony und Nadja tatsächlich Wort gehalten und nichts von unserem Aufenthalt dort erwähnt. Laut Text hatten – außer uns –nur zwei Menschen überlebt, die restlichen Besucher des Klubs waren erstickt oder verbrannt. Die Ursache des Feuers sei noch ungeklärt, man vermute allerdings Brandstiftung. Dann folgte ein langer Absatz über die Sicherheitsmängel im Excelsior und darüber, dass der illegale Klub anscheinend seit Jahren „im Dunkeln“ existiert hatte. Mit einem Seufzen legte ich die Zeitung aus der Hand. Die Medien würden sich um diese Geschichte schlagen, so viel war klar. Es wurde höchste Zeit, dass wir von hier verschwanden.
Als Ben mit düsterer Miene die schäbige Küche seines Kumpels Oskar betrat, brauchte ich nicht zu raten, was ihm schon am frühen Morgen die Laune verfinsterte. Wortlos warf er sich neben mich auf einen Stuhl, erkannte mit einem kurzen Blick, dass auch ich schon die Schlagzeilen gelesen hatte, und atmete tief durch. „Wir fahren heute Abend“, murmelte er ohne mich dabei anzusehen. Ich nickte nur, da auch ich nicht zu längeren Gesprächen aufgelegt war. Vielleicht hätte es mich interessieren sollen, wohin wir fahren würden, aber irgendwie war es mir egal. Mein Leben war zu einem schwarzen Loch mutiert, es spielte keine Rolle, ob oder wie es weiterging. Wichtig war nur, dass meine Freunde in Sicherheit waren. Und das waren sie hoffentlich, wenn Ben und ich von der Bildfläche verschwanden. Bevor ich mit Ben gegangen war, hatte Marvin mir heimlich sein Handy zugesteckt. Ich hatte meinem Bruder nichts davon erzählt, weil ich befürchtete, dass er von mir verlangen würde, es wegzuwerfen. Mein eigenes Handy hatte ich schon entsorgt. Aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, den Kontakt zu Marvin und Stella völlig zu verlieren. Zumindest musste ich wissen, ob es Stella wieder gut ging.
Nachdem ich mein Brot hastig herunter geschlungen hatte, verließ ich die Küche, um mein provisorisches Schlaflager in Oskars Wohnzimmer aufzusuchen. Als ich das Handy aus der Tasche zog, sah ich sofort, dass es blinkte und eine neue Nachricht anzeigte. Natürlich war sie von Marvin. Er schrieb, dass Stella noch immer bewusstlos sei, aber definitiv nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. Die Polizei ging mittlerweile nicht mehr von einem Selbstmordversuch, sondern einem Gewaltverbrechen aus, da man an Stellas Handgelenken Fesselspuren entdeckt hatte. „Bitte schreib mir, wohin ihr fahrt“, war Marvins letzte Bitte, „ich muss wissen, dass es dir gut geht, sonst werde ich noch verrückt.“
„Sofia?“ Erschrocken ließ ich das Handy in meine Tasche fallen und fuhr zur Tür herum. Einen Moment lang wirkte Ben irritiert, doch er fragte nicht, warum ich so zusammengezuckt war, sondern setzte sich auf einen Stuhl schräg gegenüber von meiner Luftmatratze. „Ich habe Bekannte in Amsterdam. Wir werden erst einmal dorthin fahren. Sie werden uns weiterhelfen. Alles andere weiß ich auch noch nicht.“ Ben ließ seine ineinander gefalteten Hände in den Schoß fallen und beugte sich vor, um mir noch eindringlicher in die Augen zu sehen. Sein Blick verriet eine merkwürdige Mischung aus Angst, Entschlossenheit und Bedauern, doch ich konnte diese eigenartige Kombination nicht deuten. Nur eines war mir irgendwie ohne weitere Erklärung klar: dass er seine sogenannten „Bekannten“ in Amsterdam nur widerwillig aufsuchen würde. „Wir werden das schaffen“, fügte mein Bruder nach einer kurzen Pause hinzu. Es klang eher, als wolle er sich selbst davon überzeugen als mich. „Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Von niemandem, O.K.?“ Ich lächelte schwach und nickte, doch ich spürte, dass der Kampfgeist in mir erloschen war. Wenn Ben wollte, dass ich ihm folgte – na gut, was sollte ich auch sonst tun? Aber an ein glückliches Ende der Geschichte konnte ich nicht mehr glauben. Nicht nach all dem, was wir gestern erlebt hatten.
Als wir mit Anbruch der Dämmerung Oskars Wohnung verließen, war ich froh darüber, Hamburg den Rücken zu kehren. Die Stadt, in der ich aufgewachsen war und die mir so lange Zeit vertraut gewesen war, kam mir plötzlich fremd und feindselig vor. Ich fühlte mich wie ein kleiner Fisch, der in seinem geschützten Riff in der lauschigen Lagune bisher nicht gemerkt hatte, dass direkt neben ihm ein Schwarm blutrünstiger Haie lauerte. Als wir die Lichter der Stadt hinter uns ließen, verlangsamte sich mein hämmernder Puls allmählich, Müdigkeit umfing mich mit wohlwollender Umarmung. Ben hatte seinen Blick starr auf die Straße gerichtet, seine in Falten gezogene Stirn ließ seine innere Anspannung erkennen. Meine Augenlider wurden schwer und das Dröhnen des alten Motors vermischte sich mit dem Prasseln des Regens auf unserer Windschutzscheibe. Irgendwo im Niemandsland zwischen Hamburg und Amsterdam gab mein Körper nach und ich fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.