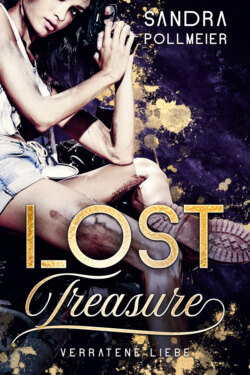Читать книгу Lost Treasure - Sandra Pollmeier - Страница 7
3
ОглавлениеWo war ich? Um mich herum waberte undurchdringlicher Nebel. Alles war grau und dumpf und kalt. Warum trug ich keine Schuhe? Es fröstelte mich und der Boden unter meinen Füßen fühlte sich feucht an. „Hallo?“ Kein Echo. Keine Antwort. Mein Ruf wurde vom Dunst verschluckt. Unsicher tastete ich mich vorwärts. Aus weiter Ferne hörte ich ein Kreischen, wie von aufgescheuchten Vögeln. „Ist hier jemand?“ Nichts. Nur Stille. Ängstlich streckte ich meine Hände aus. Was, wenn ich plötzlich ins Leere trat? Vielleicht lauerte ja schon kurz vor mir ein gähnender Abgrund. Doch da war nichts. Kein Stein, kein Strauch, kein Ast, der mich streifte, kein Laut - bis auf das Vogelkreischen, das gespenstisch aus allen Richtungen kam. Mein Puls raste, kalter Schweiß trat auf meine Stirn. Wie war ich an diesen unheimlichen Ort gekommen? Gerade war ich doch noch … Voller Schrecken wurde mir bewusst, dass ich vergessen hatte, wo ich mich noch vor einem Augenblick befunden hatte. Meine Erinnerung war wie ausgelöscht. Ich befand mich an einem Ort außerhalb von Raum und Zeit. Außerhalb der vertrauten Realität. War das ein Traum? Aber warum fühlte ich dann die feuchte Erde unter meinen Füßen? Warum konnte ich den modrigen Geruch des Nebels einatmen? Warum war mir so kalt? Ich fasste in meine Haare und spürte die feinen Wassertropfen, die sich in den losen Strähnen abgesetzt hatten. Alles war viel zu real für einen Traum. Ich biss mir auf die Unterlippe und sie schmerzte. Ja, ich schmeckte sogar das Blut, das meine Lippe benetzte.
Und dann hörte ich es. Ein leises Scharren. Ein schleppendes, langsames Schlurfen. Wie von einem verletzten Tier, das sich mühevoll den Weg zu mir bahnte. Ich erschauderte vor Angst. Sollte ich weglaufen? Aber wohin? Sollte ich stehen bleiben und abwarten, dass es an mir vorbeizog? Sollte ich rufen und auf etwas Positives hoffen oder mich so leise wie möglich verhalten? Ich entschied mich für die letzte Alternative, das schleppende Geräusch kam immer näher. Bald war ich mir sicher, dass mein zitternder Atem mich verraten würde. Ich musste hier weg! Orientierungslos stolperte ich vorwärts, doch die Schritte, die sich nun eher menschlich anhörten, folgten mir. Ja, es hatte sogar den Anschein, dass sie schneller und sicherer wurden, je schneller ich lief. Und mittlerweile rannte ich. Die Vögel, die vor wenigen Minuten noch aus weiter Ferne gekreischt hatten, waren plötzlich ganz nah. Ich spürte das Flattern ihrer Flügel, obwohl ich sie nicht sehen konnte. Aber sie waren da. Und es waren viele. Ich strauchelte. Etwas hatte mich berührt. Es hatte sich kalt und feucht angefühlt. Waren das Federn? Ich fiel auf die Hände in den Matsch, versuchte mich keuchend wieder aufzurappeln – und erstarrte. Direkt vor mir stand ein Paar schwerer schwarzer Lederstiefel. Sekundenlang wagte ich nicht, nach oben zu schauen. Stattdessen schloss ich die Augen und erwartete den Todesstoß, der mich aus diesem Albtraum erlösen würde. Ein Wassertropfen rann über meine Stirn und blieb an meiner Nasenspitze hängen. Einen Moment lang hatte ich diesen irrwitzigen Gedanken in meinem Kopf, dass dieser dumme Tropfen an meiner Nase das Letzte in meinem Leben wäre, das ich spürte. Und dann passierte – nichts. Die Stiefel bewegten sich nur einen kleinen Schritt rückwärts. Der Boden unter ihnen gab ein schmatzendes Geräusch von sich. Dann herrschte Stille. Nicht einmal die Vögel waren mehr zu hören. Langsam erhob ich mich aus dem Matsch. Noch immer konnte ich kaum die Hand vor Augen erkennen. Und doch sah ich den Schatten, der kaum einen Meter von mir entfernt auf mich wartete. Zitternd wischte ich mir die Hände an meiner Kleidung ab.
Erst jetzt wurde mir bewusst, dass das hier nicht meine Kleider waren. Ich trug ein bodenlanges, spitzenbesetztes weites Kleid mit schulterfreiem Dekolleté und engem Mieder, das merkwürdig altertümlich aussah. Vor Verwunderung merkte ich erst verspätet, dass der dunkle Schatten sich langsam zu mir herunterbeugte. Als der schwarze Lederhandschuh meine mit Schlamm verschmierte Wange streifte, zuckte ich zusammen. Dann erst sah ich sein Gesicht und es verschlug mir die Sprache. Vor mir stand Ben.
Nein. Vor mir stand ein Fremder, der genauso aussah wie Ben. Dieselben dunkelblauen Augen, die wilden braunen Haare, die unwiderstehlichen Grübchen, das schiefe, fast spöttische Lächeln. Aber dieser Mann hier war nicht Ben. Er trug einen langen, schwarzen Gehrock über einem weiten Rüschenhemd und engen Kniebundhosen. Seine Haare waren länger als die von Ben und im Nacken zu einem Zopf geflochten. Auf dem Kopf trug er einen Dreispitz und im Gesicht einen feinen, kurz geschnittenen Kinnbart. Was mich endgültig davon überzeugte, dass dies nicht mein Bruder sein konnte, war die tiefe Narbe, die sich quer über seine linke Wange bis zum Hals hinzog. Der Fremde lächelte, doch er sprach kein Wort. Bewegungslos stand ich da und starrte ihn an – unfähig etwas zu sagen oder mich zu bewegen. Der Fremde zog langsam seinen Hut vom Kopf, im selben Moment lichtete sich der Nebel. Erst jetzt erkannte ich den dichten, grünen Urwald um uns herum. Merkwürdig. Noch vor wenigen Sekunden hatte ich geglaubt, dass wir uns auf einer Ebene befanden. Aus den Wipfeln der riesigen Bäume tropfte Regen auf uns herunter, statt der Kälte breitete sich mit einem Mal eine stickige Schwüle aus. „Was … warum…?“, stotterte ich ungläubig, doch der Fremde, der gerade eben dem frühen achtzehnten Jahrhundert entstiegen zu sein schien, schüttelte den Kopf und legte mir den rechten Zeigefinger auf die Lippen, bevor ich weiterreden konnte. „Du musst dich in Acht nehmen!“, flüsterte er mit warnendem Unterton und stark französischem Akzent. Dann lächelte er wieder und ging langsam um mich herum, als wolle er mein Erscheinungsbild begutachten. Jetzt war er nur noch wenige Zentimeter von mir entfernt und ich konnte seinen warmen Atem in meinem Nacken spüren.
„Wovor?“, fragte ich leise und schloss die Augen, weil mich diese seine Nähe zutiefst verwirrte. Einen Moment lang bekam ich keine Antwort. Stattdessen spürte ich die kühlen Lederhandschuhe, die mir eine lose Haarsträhne aus dem Nacken strichen. Ich wollte mich dagegen wehren, doch ich konnte mich nicht rühren.
„Vor den Vögeln“, flüsterte er mir ins Ohr.
„Was ist mit den Vögeln?“, fragte ich verwirrt und drehte mich in seine Richtung.
Seine tiefblauen, dunklen Augen sahen mich abschätzend an. „Du wirst es verstehen, wenn du so weit bist“, antwortete er kryptisch und zeichnete mit seinem Finger die Konturen meines Gesichts nach. Dann strichen die kühlen Handschuhe sanft über mein Haar. Und wieder konnte ich mich nicht wehren gegen dieses ohnmächtige Gefühl, dass ich Ben mit Haut und Haaren verfallen war. Meinem Bruder! Aber das hier war nicht Ben … oder etwa doch? Jetzt neigte er sein Gesicht zu mir herunter, ganz langsam. Gleich würde er mich küssen – und ich würde ihn nicht davon abhalten. Voller Anspannung erwartete ich den Moment, in dem das passierte, was im normalen Leben nicht passieren durfte … Aber das hier war nicht die Realität. Weiter konnte ich nicht denken, denn plötzlich wurde ich mit einem gewaltigen Ruck nach hinten gerissen. Ich verlor den Halt unter den Füßen und fiel. Mit weit aufgerissenen Augen stürzte ich eine schier endlose Klippe hinunter. Oben stand Bens Doppelgänger und sah mit ausdruckslosem Gesicht auf mich herunter. Hatte er mich gestoßen? Aber er hatte mir doch helfen wollen! Gleich würde ich auf den scharfen Felsen aufschlagen, nur noch wenige Meter und …
Orientierungslos blickte ich in das helle Licht über meinem Kopf. War ich tot? Vorsichtig bewegte ich meine Zehen. Hm, ich konnte mich noch bewegen. Und das Pochen in meinem Kopf fühlte sich auch nicht so an, als wäre ich zu einem Geistwesen mutiert. Nein, ich schwebte definitiv nicht auf einer Wolke im fernen Nirvana. Ich lag in einem fremden Bett mit hellblauem Blümchenbezug. Das Licht, in das ich schaute, kam von einem üppig geschmückten antiken Kristallleuchter. Langsam rappelte ich mich hoch. Dieses Zimmer hier wirkte auf mich genauso fremd wie der Urwald, durch den ich gerade noch gestolpert war. Auf der schnörkeligen Kommode neben dem Fenster standen ca. ein Dutzend Bilderrahmen unterschiedlichster Form und Größe. Vorsichtig erhob ich mich und tapste barfuß über das Parkett zu den bunten Fotos. Auf vielen von ihnen sah ich das Gesicht eines hübschen rothaarigen Mädchens. Zum Teil waren es Kinderfotos – die Kleine in gelben Gummistiefeln mitten im Watt an der Nordsee oder mit einem Hundewelpen auf dem Schoß. Manche Bilder zeigten sie als schöne junge Frau im Kreise ihrer Freundinnen, im Abendkleid und in Umarmung eines jungen Mannes, der mir sehr bekannt vorkam. Vorsichtig hob ich das Foto von der Kommode, um es eingehender zu betrachten. Ben wirkte jünger und fröhlicher als ich ihn kannte. Sein Lachen war ehrlich und das Mädchen in seinen Armen drückte ihr Gesicht an seine Schulter. Ja, jetzt wusste ich wieder, wo ich war. Plötzlich hörte ich, wie hinter mir eine Türklinke heruntergedrückt wurde. Hastig stellte ich das Foto wieder an seinen Platz und drehte mich herum. Etwas zu ruckartig vielleicht, denn jetzt spürte ich, dass ich die Kontrolle über meinen Gleichgewichtssinn noch nicht vollständig zurückerlangt hatte. Die Wände um mich herum drehten sich wie ein Karussell und ich sackte in die Knie und warf dabei das soeben betrachtete Foto um, das klirrend auf dem Boden landete.
„Tut … mir leid …“, stammelte ich benommen, als ich die Scherben auf dem Parkett entdeckte.
„Sofia!“, mit besorgter, aber irgendwie auch erleichterter Miene griff Ben mir unter die Arme und zog mich vom Boden hoch. Taumelnd hielt ich mich an ihm fest und ließ mich widerstandslos zum Bett zurückführen. „Seit wann bist du wach?“, fragte er.
Ich runzelte die Stirn. Was für eine dumme Frage. Glaubte er tatsächlich, dass ich stundenlang auf dem Bett gesessen und Däumchen gedreht hatte? Und vor allem – hatte er mich hier so lange alleine gelassen? „Na seit gerade eben“, antwortete ich matt, während er mir eines der dicken Paradekissen in den Rücken stopfte. Ich konnte mir nicht helfen, aber irgendwie kam ich mir doof vor, mich so von meinem Bruder „bemuttern“ zu lassen. Doch während ich noch leise vor mich hin grummelte, schenkte Ben mir ein sanftes Lächeln.
„Wir haben uns Sorgen um dich gemacht“, sagte er mit einem tiefen Seufzer.
„Warum denn?“
„Du stellst Fragen! Kaum dass wir bei Julie angekommen waren, bist du umgekippt und warst nicht mehr ansprechbar. Du hattest über 40 Grad Fieber und hast wirres Zeug geredet. Als wir dich ins Bett brachten, hab´ ich gesehen, dass du eine tiefe Wunde am linken Oberarm hast, die sich entzündet hatte. Um ein Haar wärst du an einer Blutvergiftung krepiert, du dummes Ding!“
Blutvergiftung? Langsam dämmerte es mir. Der alte Schuppen in Dr. Potters Garten. Ich hatte mich an einer Harke oder etwas ähnlichem verletzt. Nach all dem, was danach passiert war, hatte ich diesen kleinen Unfall vergessen. Was war ein kleiner Kratzer schon im Vergleich dazu, dass ich fast erschossen worden oder im Excelsior verbrannt wäre? Ben holte neben dem Bett eine Flasche hervor und goss mir etwas Wasser in das leere Glas auf meinem Nachttisch. Tatsächlich hatte ich wahnsinnigen Durst. Als er mir das Glas reichte, trank ich es in einem Zug leer und musste gleich darauf husten, weil ich mich verschluckt hatte. „Nicht so schnell!“ Mein Bruder schüttelte den Kopf, so als würde er an mir verzweifeln.
„Wie lange hatte ich denn Fieber?“, hustete ich, während er mir vorsichtig auf den Rücken klopfte.
„Zwei Tage und zwei Nächte“, antwortete er ernst. Erst jetzt wurde mir klar, dass ich anscheinend wirklich mit dem Tode gerungen hatte. „Zum Glück hat sich Linus´ `Leibarzt´“, er sprach das Wort mit einer gewissen Verachtung aus, „um dich gekümmert. Ohne Papiere hier in Amsterdam wäre es sonst schwierig gewesen, unentdeckt zu bleiben.“
Natürlich. Ben hatte Recht. Ich hatte uns und unser Vorhaben in Gefahr gebracht. Aber dieser Linus hatte anscheinend für jedes Problem eine Lösung parat. Wieder hörte ich die Tür quietschen; diesmal war es Julie, die vorsichtig ins Zimmer lugte.
„Du bist aufgewacht!“, bemerkte sie mit einem strahlenden Lächeln und schwebte zu Ben ans Fußende meines Bettes. Ich kam mir reichlich dumm vor.
„Mir geht´s schon wieder gut“, wiegelte ich das übertriebene Interesse an meiner Person ab und versuchte mich aufzurappeln, doch Ben schob mich mit strenger Miene wieder zurück auf mein Kissen.
„Du bleibst erst mal schön liegen!“, sagte er und zog warnend seine linke Augenbraue in die Höhe.
„Jawohl, Sir!“ Ich verschränkte beide Arme vor der Brust. „Na, wenn du dich schon wieder zanken kannst, dann bist du auf dem Weg der Besserung!“ Julie lachte und zwinkerte mir zu. Warum nur war sie so freundlich zu mir? War das jetzt eine neue Masche? Sei nett zur Schwester deines Lovers, dann mag er dich auch lieber? Aber ich würde mich nicht von ihr um den Finger wickeln lassen.
„Na, ich koche dir erstmal einen Tee und lass euch allein.“ Julie drehte sich um und ging zur Tür, „Gibt es etwas Bestimmtes, das du gerne essen würdest, Sofia?“
Nicht um den Finger wickeln lassen … „Hast du Erdbeeren da?“ Okay, ich bin schwach, ich gebe es zu.
Jetzt strahlte Julie noch mehr. „Mit Sahne?“ Wer konnte da widerstehen? Ich nickte freudig und ohrfeigte mich innerlich für meine Blödheit. Na sei´s drum. Irgendwie war ich zu müde für diese Eifersüchteleien. Als Julie den Raum wieder verlassen hatte, schwiegen Ben und ich uns an. Keiner von uns beiden wusste, was er sagen sollte, und mein Herz schlug mir bis in die Kehle. Ich dachte an den Traum und daran, wie sehr ich mich darin nach ihm gesehnt hatte. Oh Gott, wie sollte ich ihm nur je wieder in die Augen sehen, ohne vor Scham im Boden zu versinken?
„Ich bin echt froh, dass du … wieder da bist“, rang mein Bruder schließlich nach den richtigen Worten und grinste mich dabei an. Nein! Ich würde ihm nicht in die Augen schauen!
„Ach was, hättest doch weniger Ballast mit dir rumzuschleppen, wenn´s mich dahingerafft hätte“, versuchte ich zu spaßen, doch Ben schüttelte den Kopf.
„Nein. Da würde mir doch was fehlen.“ Er streckte die Hand aus und strich mir mit dem Handrücken über die linke Wange. Nur eine kleine, nette Geste, aber ich hatte das Gefühl, gleich wieder in Ohnmacht zu fallen. Himmel, was war nur los mit mir?
„Ben, kannst du grad´ mal kommen?“, rief Julie aus dem Nebenraum und ich war fast froh darüber, dass sie mich aus dieser merkwürdigen Situation erlöste. Zögernd stand mein Bruder auf, zuckte etwas hilflos mit den Schultern und verschwand hinter der Tür.
Nachdem ich eine Weile auf meinem Bett vor mich hingedöst hatte, durchfuhr es mich plötzlich wie ein Stromschlag. Mein Handy! Ich hatte es in meiner Jackentasche, als ich vor zwei Tagen Julies Wohnung betrat! Hatte Ben es entdeckt und mir weggenommen? Hatte Marvin sich gemeldet und wunderte sich jetzt, warum ich ihm nicht antwortete? Hastig stand ich auf und öffnete die Türen des Kleiderschranks. Meine Jacke hing ordentlich auf einem Bügel, doch als ich die Taschen durchsuchte, konnte ich kein Handy entdecken. Mir wurde heiß und kalt. Ben hatte es entdeckt und weggeworfen. Aber warum war er dann gerade so freundlich zu mir gewesen? Er hätte wütend sein müssen, weil ich das Ding vor ihm geheim gehalten hatte. Auf dem Stuhl neben meinem Bett lagen die Kleidungsstücke, die ich am Dienstag getragen hatte – meine Jeans, mein altes T-Shirt, sogar die Unterwäsche (wer zur Hölle hatte mir die denn ausgezogen?). Mit zitternden Händen durchwühlte ich die Sachen – und atmete erleichtert durch. Das Handy steckte in meiner Hosentasche! Vorsichtig tappte ich auf Zehenspitzen zur Zimmertür und legte mein Ohr an das kühle Holz. Auf der anderen Seite war es ruhig, nur das Rauschen der Autos auf der Straße war zu hören. Anscheinend hatten Ben und Julie die Wohnung verlassen. Langsam drückte ich die Klinke nach unten und lugte in den lichtdurchfluteten Wohnraum. Niemand zu sehen. Auf dem Beistelltisch neben meiner Zimmertür lag ein Zettel, daneben standen eine Kanne mit Pfefferminztee, eine Tasse mit Blümchenmuster und ein dazu passendes Schälchen mit Erdbeeren und Sahne. „Liebe Sofia!“, stand auf dem weißen Blatt mit einer schwungvollen Frauenhandschrift geschrieben, „Wir sind kurz etwas zu Essen holen. Sind gleich wieder da! Ben & Julie“. Ich schnappte mir die Erdbeeren und verschwand wieder im Nebenraum. Auf dem Bett wühlte ich das Handy unter dem Kopfkissen hervor und schaltete es an. Kaum war das Logo zu sehen, vibrierte es auch schon. Oh, Gott! „Sie haben sieben neue Nachrichten“, stand auf dem Display. Es musste etwas in Hamburg geschehen sein! Die Nachrichten waren allesamt von Marvin, die erste von gestern Morgen, 8:32 Uhr. „Hi Fia! Wo seid ihr jetzt? Ruf mich bitte an, es gibt wichtige Neuigkeiten!“ Dann, zwei Stunden später: „Sicher bist du nicht allein und kannst nicht antworten. Aber es ist wirklich SEHR WICHTIG! Versuch doch bitte, mich anzurufen!!“ Die dritte SMS war dann schon etwas eindringlicher: „Meine Güte, Sofia! Ich habe Neuigkeiten zu Dr. Potter! Es ist wirklich dringend!!“.
Ich schüttelte den Kopf. Hatte jetzt auch die Polizei Dr. Potters Leiche im Gartenteich entdeckt? Die Nachrichten Nummer vier und fünf enthielten nur wildes Gefluche und einige Beschimpfungen, allesamt auf Ben bezogen. Doch in SMS Nummer sechs rückte Marvin – mittlerweile um 01.05 Uhr in der Nacht - endlich etwas mit der Sprache raus: „Vielleicht hat Ben, dieser Arsch, dir das Handy schon längst weggenommen und lacht über meine Nachrichten. Aber falls nicht: Das, was im Teich lag, war nicht das, für das wir es gehalten haben, Sofia! Kapiert??“ Nicht das, für das wir es gehalten hatten? Der Tote im Wasser war nicht Dr. Potter? Vor Entsetzen vergaß ich beinahe die letzte Nachricht zu lesen, sondern starrte stattdessen geistesabwesend die kahle Wand an. Doch dann wurde ich von einer zuknallenden Autotür unter meinem Fester wieder zurück in die Gegenwart gerissen. Ben und Julie kamen zurück! Schnell klickte ich die letzte der Mitteilungen an. Sie war von heute Morgen, 7:45 Uhr: „Du hast dich die ganze Nacht nicht gemeldet. Es reicht jetzt. Ich gehe zur Polizei.“ „Nein!“ Vor Entsetzen war ich aufgesprungen und hatte anscheinend sogar laut geschrien. Dann kramte ich in der Nachttischschublade nach meiner Armbanduhr. Da ich so lange geschlafen hatte, hatte ich das Zeitgefühl verloren. War es noch morgens oder schon Nachmittag? Der grau bewölkte Himmel vor meinem Fenster gab mir keine Anhaltspunkte. Schließlich fand ich meine Uhr, versteckt unter diversen holländischen Modezeitschriften. Das Zifferblatt zeigte 11:38 Uhr. Verflucht! Fast vier Stunden nach Marvins letzter Mitteilung. Sicher hatte er bereits die Polizei informiert. Ich musste ihn anrufen. So schnell wie möglich.
„Wir sind wieder da!“ Julies glockenhelle Stimme trällerte durch die Wohnung. Na super, das war ja ein tolles Timing! Was sollte ich denn jetzt tun? Hastig schlüpfte ich aus meinem Nachthemd und warf mir den weißen Bademantel über, der neben meiner Jacke im Kleiderschrank hing. Dann huschte ich aus dem Zimmer, machte einen Satz ins angrenzende Bad und drehte den Duschhahn voll auf. „Ich wollte mich gerade noch frisch machen!“, rief ich durch die Tür in den Wohnraum und drehte den Schlüssel. „Bitte, bitte nimm ab!“, flehte ich das Handy an, während ich Marvins Nummer wählte, und setzte mich auf den Rand von Julies ausladender Marmor-Badewanne. Dreimal klingelte es, dann meldete sich eine völlig aufgelöste Männerstimme. „Sofia! Ich fass´ es nicht, wo warst du denn?“
„Ich hatte meinen Akku nicht aufgeladen“, log ich, denn ich wollte Marvin nicht noch mehr beunruhigen.
„Den Akku nicht aufgeladen! Na das ist typisch“, schnaufte Marvin.
„Was ist los, Marvin? Ist etwas mit Stella passiert? Warst du bei der Polizei?“, fiel ich ihm ins Wort, denn das war momentan das Einzige, an das ich denken konnte.
„Nein“, antwortete Marvin zögerlich. Ich seufzte erleichtert, „Stella ist noch nicht aufgewacht, und bei der Polizei war ich auch nicht. Aber ich war wirklich kurz davor, Fia. Du hast keine Ahnung, was hier los ist!“
„Was ist denn mit Dr. Potter?“ Ich drehte den Wasserhahn etwas herunter, da ich durch das rauschende Wasser Marvins Stimme kaum verstehen konnte.
„Na, er war´s nicht! Die Leiche im Teich war eine Frau! Sie haben sie vorgestern Abend entdeckt. Den Nachbarskindern flog ein Ball auf Potters Grundstück. Da haben sie die Hand im Wasser gesehen.“
„Eine Frau?“ Jetzt verstand ich gar nichts mehr. Gut, wir hatten uns die Hand nicht wirklich angesehen. Sie war weiß und aufgedunsen vom Wasser, aber ich konnte mich noch genau daran erinnern, dass sie weder lange noch lackierte Fingernägel gehabt hatte. Na gut, das bedeutete nichts. Auch ich trug meine Nägel kurz und naturbelassen.
„Ja, aber bis jetzt ist ihre Identität noch nicht geklärt. Die Polizei will in Kürze anhand einer Gesichtsrekonstruktion Phantombilder veröffentlichen. Vielleicht melden sich dann ja Bekannte oder Angehörige.“ Jetzt war es still am anderen Ende der Leitung. Fast kam es mir vor, als hörte ich Marvin leise fluchen. Und auch mir hatte es die Sprache verschlagen. „Sofia“, begann er nach einer ganzen Weile, „Merkst du denn immer noch nicht, dass diese Geschichte uns total über den Kopf wächst? Sei vernünftig und komm nach Hause! Wenn Potter nicht das Opfer, sondern einer der Täter war, dann sucht er auch nach dem Schatz. Vermutlich hat er sich schon damals Kopien von diesem Brief gemacht. Und er kennt dich. Ihr seid in Lebensgefahr, wenn ihr auf die Seychellen fliegt.“
„Wir waren auch schon vorher in Lebensgefahr“, erwiderte ich gereizt, doch ich musste zugeben, dass Marvins Neuigkeiten mir nicht gerade Mut machten.
„Ganz egal, wer diese tote Frau ist, Sofia. Ich bin mir sicher, dass Potter und seine Komplizen sie umgebracht haben, weil sie ihnen in die Quere kam. Geh´ zur Polizei und klär´ das Ganze auf, Sofia! Ich stehe dir auch bei in dieser Sache, versprochen!“
„Es geht hier nicht nur um mich“, fauchte ich Marvin an und musste mich gleichzeitig daran erinnern meine Stimme zu senken, damit mich Ben und Julie nebenan nicht hörten. „Ben ist ein enormes Risiko eingegangen, um mir zu helfen.“
„Ach ja, ist er das?“
Mit einem Mal wurde mir klar, dass ich Marvin die wichtigsten Kapitel unserer Odyssee noch nicht erzählt hatte. Er hatte keine Ahnung von dem Zwischenfall auf dem Friedhof, oder davon, dass mein Onkel das Massaker im Excelsior ausgelöst hatte. „Sorry, Sofia. Ich dachte, wir würden einander vertrauen! Aber du weihst mich inzwischen wohl nicht mehr in jedes unwichtige Detail ein.“
Stöhnend verbarg ich mein Gesicht in der freien Hand. „Es tut mir leid, Marvin, ich wollte dich nicht noch tiefer mit reinziehen. Und außerdem - wann sollte ich es dir erzählen? Dafür gab es bisher keine passende Gelegenheit!“
„Wie wäre es denn mit jetzt?!“
„Ich sitze hier im Badezimmer und lasse das Wasser laufen, damit mich niemand hört.“
„Wo bist du, Sofia?“ Marvins Tonfall wurde immer frostiger. Mir war klar, dass er sich ausgeschlossen fühlte, und ich konnte nur zu gut verstehen, dass er keine Lust mehr darauf hatte, von mir im Unklaren gehalten zu werden.
„Na gut“, seufzte ich nach kurzem Zögern, „Ich erzähle dir alles. Aber du musst mir schwören, nicht die Polizei zu informieren!“
„Ja, ist klar.“
„Was ist klar?“
„Ja, ich schwöre, meine Güte, jetzt erzähl´ endlich!“
Und dann berichtete ich ihm alles. Marvin unterbrach mich nicht, aber ich hörte ihn manchmal scharf einatmen. Es war, als könnte ich seine gerunzelte Stirn und die fest aufeinander gepressten Lippen vor mir sehen. Als ich die Geschichte mit meinem Zusammenbruch in Julies Wohnung beendete, schwieg Marvin immer noch. „Bist du noch da?“, fragte ich zögerlich, doch ich bekam keine Antwort. „Marvin?“
„Ich kann nicht fassen, was du da gerade erzählt hast“, flüsterte Marvin. Jetzt schwiegen wir beide. Er hatte ja Recht. Es war alles ein einziger Albtraum. „Ich kann dich ja doch nicht davon überzeugen zurückzukommen“, sagte Marvin nach einem endlosen Augenblick. „Aber versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Und bitte melde dich. Am besten jeden Tag einmal. Damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist.“
Im Bad war die Luft um mich herum mittlerweile dunstverhangen. Ich drehte den Wasserhahn zu und öffnete das Fenster. „Danke!“, flüsterte ich in den Hörer. Draußen hatte es zu regnen begonnen. Ein junges Pärchen lief laut lachend die Straße herunter und versteckte sich unter einer ausgebreiteten Jacke. Wie unbeschwert sie waren! Es kam mir vor, als wären Jahre vergangen, seitdem ich zum letzten Mal so ausgelassen gelacht hatte.
„Mach´s gut, Sofia“, hörte ich Marvin, dann war es still. Eine ganze Weile starrte ich in den Regen. Irgendwann zog ich meinen Bademantel aus und stellte mich unter die Dusche.
„Nach einem schönen Bad fühlt man sich wie ein neuer Mensch, nicht wahr?“ sagte Julie, als ich mit triefnassen Haaren aus der Dusche kam. Als Antwort zuckte ich nur mit den Schultern. Diese ewig gut gelaunte Art von ihr ging mir mächtig auf die Nerven. „Wir haben dir etwas vom Chinesen mitgebracht. Das ist jetzt leider kalt, aber du kannst ja die Mikrowelle benutzen. Du magst doch Ente süß-sauer?“, plapperte Bens alte Flamme unbeeindruckt weiter.
„Ja, klar. Danke“, entgegnete ich, ohne sie anzusehen, und verschwand in meinem Zimmer.