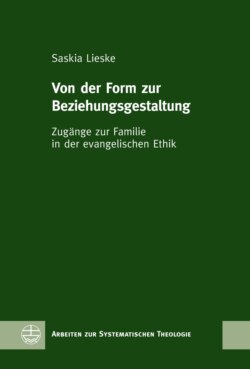Читать книгу Von der Form zur Beziehungsgestaltung - Saskia Lieske - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Der Zusammenhang von Ehe und Familie in Artikel 6 Absatz 1 GG
ОглавлениеIm Gegensatz zur nachweisbaren Kontinuität zwischen Weimarer Reichsverfassung und Grundgesetz kann im Verhältnis des Parlamentarischen Rates zum Nationalsozialismus samt seiner Gesetzesauslegung von einem Bruch gesprochen werden. Bereits in der Weimarer Reichsverfassung waren an die Ehe bevölkerungspolitische Interessen geknüpft. Aufgrund ihrer Reproduktionsfunktion wurde die Ehe gemäß Art. 119 Abs. 1 WRV als die »Grundlage […] der Erhaltung und der Vermehrung der Nation«94 aufgefasst. Im Nationalsozialismus wurde diese Idee für die »völkische Ideologie« aufgegriffen. Die Ehe wurde durch die Nationalsozialisten instrumentalisiert und im Sinne der »völkischen Weltanschauung« umgedeutet.95 Fortan wurde die Ehe nicht als eine private Angelegenheit verstanden, sondern stand im Mittelpunkt des Interesses der sogenannten Volksgemeinschaft. Dies galt insbesondere für die Zeugung von Kindern, welche als Pflicht für den Erhalt der »völkischen Gemeinschaft« angesehen wurde.96 Der Wert einer Ehe wurde daran gemessen, inwieweit die Eheleute dieser Pflicht nachkommen konnten. In sich selbst hatte die Ehe entsprechend dieser Fokussierung auf Nachkommen keinen Wert mehr.97 In Analogie dazu wurde auch die Familie von staatlicher Seite instrumentalisiert. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand das Kind, welches den Fortbestand der Gemeinschaft gewährleisten sollte. Damit ging nebenbei eine Aufwertung des unehelichen Kindes einher, solange es aufgrund der Herkunft seiner Eltern als wertvoll für die Gemeinschaft angesehen werden konnte.98 Aus alldem lässt sich zugespitzt der Schluss ziehen: Ehe und Familie wurden vom nationalsozialistischen Staat instrumentalisiert. Beide Rechtsinstitute erhielten ihren Wert durch den Zweck, die sogenannte völkische Gemeinschaft durch Fortpflanzung zu bewahren. Weder die Ehe noch die Familie besaßen einen Selbstzweck, sondern stellten vielmehr Mittel zum Zweck der Erhaltung und des Wachstums der Gemeinschaft dar.
Vor diesem Hintergrund muss Art. 6 Abs. 1 GG als eine eindeutige Kehrtwende verstanden werden. In Abgrenzung zur Instrumentalisierung von Ehe und Familie wird dort die Eigenständigkeit beider Institute, mithin ihr Selbstzweck betont:
»(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.«99
Dieser Wortlaut resultiert aus eingehenden Beratungen in den Ausschüssen. In der ersten vom Parlamentarischen Rat erstellten Fassung des Grundgesetzes vom 18. Oktober 1948 wird weder die Ehe noch die Familie erwähnt. Deren erstmalige Erwähnung erfolgte in einer Fassung, die am 10. Dezember 1948 im Hauptausschuss diskutiert und angenommen wurde. Die Bestimmungen, wie sie damals in Art. 7a zu finden waren, lauteten wie folgt:100
»(1) Die Ehe als die rechtmäßige Form der fortdauernden Lebensgemeinschaft von Mann und Frau und die mit ihr gegebene Familie sowie die aus der Ehe und der Zugehörigkeit zur Familie erwachsenden Rechte und Pflichte stehen unter dem besonderen Schutz der Verfassung.
(2) Jede Mutter hat gleichen Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(3) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern.«101
Hinzu kamen in Art. 7b Abs. 1 noch Rechtssätze zu Pflege und Erziehung der Kinder:
»Pflege und Erziehung der eigenen Kinder ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Die Herausnahme von Kindern aus der Familiengemeinschaft gegen den Willen der Erziehungsberechtigten ist nur auf gesetzlicher Grundlage möglich, wenn durch ein Versagen der Erziehungsberechtigten die Gefahr der Verwahrlosung der Kinder gegeben ist.«102
Die Familie wird nach Art.7a Abs.1 als mit der Ehe gegeben angesehen. Dadurch kommt es zu einer Identifikation von Ehe und Familie, die auf zweifache Weise interpretiert werden kann. Auf der einen Seite ist infolge dieser Identifikation eine Aufwertung der kinderlosen Ehe denkbar. Jede Ehe wäre dementsprechend zugleich eine Familie. Der Familienbegriff würde dann keinen zwangsläufigen Bezug mehr zur Eltern-Kind-Gemeinschaft haben. Auf der anderen Seite kann zugleich der gegenteilige Schluss gezogen werden, dass eine Abwertung der kinderlosen Ehe erfolgt. Dieser Lesart folgend wäre eine Ehe stets mit Kindern verbunden, sodass die Familie aus diesem Grund mit der Ehe gegeben ist.103 Vom Wortlaut her lässt sich keine eindeutige Entscheidung treffen. Entgegen der anfänglichen Kopplung von Ehe und Familie, erfolgte auf Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses eine Entkoppelung beider Rechtsinstitute. Am 13. Dezember 1948 legten dessen Mitglieder eine Stellungnahme zur eben dargelegten Fassung des Hauptausschusses samt alternativer Formulierungsvorschläge vor. Hier fand sich erstmals jener Wortlaut, der am Ende offiziell in Art. 6 Abs. 1 GG Eingang fand: »Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.«104 Mit dieser Formulierung wurde auf der sprachlichen Ebene insofern eine Trennung beider Institute vollzogen, als dass die Ehe fortan nicht als Grundlage der Familie galt.105 Die Ehe und die Familie stehen als Rechtsinstitute jeweils für sich unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.106
Aus der Trennung von Ehe und Familie auf sprachlicher Ebene den Schluss zu ziehen, dass beide Institute generell in keinem Zusammenhang stehen, würde allerdings den Diskussionen in den Ausschüssen nicht gerecht werden. Wird der Entstehungskontext berücksichtigt, wie dies innerhalb der historischen Auslegung üblich ist, wäre es eine Verkürzung, Ehe und Familie lediglich als voneinander unabhängige Glieder einer Aufzählung zu verstehen.107 Vielmehr wurde die Ehe als die rechtmäßige auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau angesehen. Gemeinsam mit der auf der Ehe beruhenden Familie ist sie Teil einer vom Staat vorgefundenen Ordnung.108 Aus diesem Grund kann sodann das uneheliche Kind nicht auf eine Stufe mit dem ehelichen Kind gestellt werden.109 Dem unehelichen Kind sind zwar die gleichen Bedingungen für seine Entwicklung zu schaffen, aber es ist dem ehelichen Kind nicht gleichgestellt. Aus dem Gesagten lässt sich nun die Schlussfolgerung ziehen, dass die Ehe und die Familie auf der sprachlichen Ebene zwar voneinander getrennt worden sind und jeweils für sich unter dem Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Unter Berücksichtigung des Entstehungskontextes muss aber zugleich eingeräumt werden, dass über den Wortlaut hinaus durchaus ein Bezug zwischen Ehe und Familie besteht und beide gerade nicht losgelöst voneinander zu betrachten sind. Trotz aller Eigenständigkeit und allen Eigenwerts stellt die Familie eine Ableitung aus der Ehe dar. Entsprechend der subjektiven Auslegungstheorie wäre diese Auffassung auch in der Gegenwart in der Auslegung von Art. 6 GG bindend.110 Im Gegensatz dazu wird innerhalb der objektiven Auslegungstheorie nach dem Sinn des Gesetzes gefragt – unabhängig vom Willen des historischen Gesetzgebers. Dieser Auslegungsrichtung folgend, ist nun zu überlegen, welche Rolle die Ehe rechtlich gegenwärtig für die Familie spielt. Dazu werden zwei alternative Vorschläge dargelegt.
Auf der einen Seite kann die Auffassung vertreten werden, dass Ehe und Familie in einem engen Zusammenhang stehen und infolgedessen auch zu schützen sind.111 So stellt PETER BADURA fest: »[S]ie [d.i. die Ehe, Anm. d. V.] ist die alleinige Grundlage einer vollständigen Familiengemeinschaft und als solche Voraussetzung für die bestmögliche körperliche, geistige und seelische Entwicklung von Kindern.«112 Diese Aussage erinnert an die Diskussionen um die Formulierung von Art. 6 GG. Doch statt einer einfachen Übernahme damaliger Ansichten hinsichtlich Ehe und Familie, nimmt BADURA insofern eine Veränderung vor, als dass er von der Ehe als Grundlage der vollständigen Familiengemeinschaft spricht. Dadurch wird nichtehelichen Eltern und ihren Kindern der Status einer Familie nicht aberkannt, doch haftet einer solchen Gemeinschaft aufgrund der Unvollständigkeit der Charakter des Mangelhaften an. Wird das Strukturprinzip der prinzipiellen Unauflöslichkeit der Ehe berücksichtigt, so könnte BADURAS Aussage als ein Stabilitätsargument verstanden werden. Aufgrund der Dauerhaftigkeit, die im Allgemeinen zu den Strukturprinzipien der Ehe gezählt wird, kann die in der Ehe gegründete Familie in struktureller Hinsicht einen besonders stabilen Rahmen für die Pflege und Erziehung der Kinder darstellen. Problematisch hieran ist jedoch, dass damit nichtehelichen Lebensgemeinschaften unterstellt wird, dass diese per se von kürzerer Dauer und deshalb auch instabiler sind. Die Dauerhaftigkeit bildet eine Analogie zwischen der Ehe und der Familie, auch wenn bei beiden Lebensformen gilt, dass die Dauerhaftigkeit oftmals vor allem potentiell zu denken ist. Darüber hinaus sind bei BADURA zwei weitere Entsprechungen erkennbar, die darauf schließen lassen, dass Zuschreibungen der Ehe zugleich für die Familie gelten. BADURA nennt die dialogische Dimension des Menschen und die umfassende Lebenshilfe. 113 Er geht davon aus, dass der Mensch seinem Wesen nach auf Dialog ausgerichtet sei. Dementsprechend stellen sowohl die Ehe als auch die Familie Lebensformen dar, bei denen dieser Anlage des Menschen entsprochen werde. Zur Lebenshilfe dürften die gegenseitige Fürsorge und Verantwortung, wie auch der Beistand zählen.114 Für die Frage nach dem Zusammenhang von Ehe und Familie lässt sich schlussfolgern, dass beide Institute von ähnlichen Strukturen und Funktionen geprägt sind. Infolgedessen stehen sie in einer engen Verbindung und heben sich zugleich von anderen Formen des Zusammenlebens ab.115 Problematisch ist dabei, dass außer Acht gelassen wird, dass für das Institut der Familie der Familienstand der Eltern unerheblich ist. Eine Familie wird aus rechtlicher Perspektive durch das Kind konstituiert. Wenn BADURA die Ehe als die Voraussetzung einer vollständigen Familiengemeinschaft sieht, wird dadurch die Eigenständigkeit des Familieninstituts abgewertet und der Familienstand der Eltern zu einem Charakteristikum der Familie erhoben.
Im Gegensatz zur eben dargelegten Verhältnisbestimmung – Ehe und Familie stehen in einem engen Zusammenhang – kann der Schwerpunkt alternativ auf die Eigenständigkeit beider Rechtsinstitute gelegt werden. Die Ehe der Eltern spielt dann keine gesonderte Rolle für die Schutzwürdigkeit der Familie. Dementsprechend ist die Familie als Eltern-Kind-Gemeinschaft unabhängig vom Familienstand der Eltern seitens des Staates zu schützen und zu fördern.116 Bei einer Betonung der Eigenständigkeit der Ehe gegenüber dem Rechtsinstitut der Familie bereitet es jedoch Schwierigkeiten, das Verhältnis der Ehe zu anderen partnerschaftlichen Lebensformen zu bestimmen. Anders formuliert: Aus welchem Grund soll die Ehe unter einem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen, wenn die Funktionen, die sie erfüllt – gerade mit Blick auf Verantwortung und gegenseitige Fürsorge – auch in anderen Lebensformen wahrgenommen werden können. Damit hängt sodann die Frage zusammen, ob der Schutz der Ehe dergestalt erfolgen kann, dass andere Lebensformen nicht benachteiligt werden. 117
Die Entkoppelung von Ehe und Familie auf der einen und der enge Bezug beider Institute auf der anderen Seite sind Alternativen für die Frage, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Während unstrittig ist, dass die Familie vom Grundgesetz geschützt wird, steht die besondere Stellung der Ehe zur Disposition – hinsichtlich ihres Bezugs zur Familie und ihres Verhältnisses zu nichtehelichen Partnerschaften. Nach Auffassung BADURAS ist die optimale Entwicklung des Kindes in der ehelichen Familie gegeben. 118 Doch ist zu hinterfragen, ob die Form der Ehe die Voraussetzungen für die bestmögliche Entwicklung des Kindes schafft oder die ihr innewohnenden Prinzipien wie Verantwortung oder Dauerhaftigkeit. Beide werden zwar von Rechtswegen in besonderer Weise der Ehe zugeschrieben, doch sind solche Prinzipien auch in anderen Formen des Zusammenlebens zu finden.119 Ähnliches gilt auch in Bezug auf die dialogische Struktur des Menschen. Wenn der Mensch seiner Natur nach ein dialogisches Wesen ist, wie es unter anderem BADURA und FRIEDERIKE NESSELRODE behaupten, spricht dies gerade gegen eine besondere Stellung der Ehe.120 Der Mensch ist stattdessen als in der Welt Seiender auf Dialog hin angelegt. Dieser Anlage wird nicht erst in der Ehe, sondern bereits dadurch entsprochen, dass der Mensch in Beziehungen gestellt ist. Die Familie entspricht diesem Zusammenhang in besonderer Weise, als dass jeder Mensch eine Herkunftsfamilie hat. Mit dieser befindet er sich in einer Beziehung und steht in der Regel in einem Dialog mit ihren Mitgliedern. Daraus ergibt sich als mögliche Konsequenz, dass die Familie im Besonderen zu schützen und zu fördern ist. Die Ehe hat in Anbetracht dessen im Vergleich zu anderen gemeinschaftlichen Lebensformen nicht zwangsläufig eine hervorgehobene Stellung. Aus juristischer Perspektive ist gleichwohl zu überlegen, ob die Ehe aufgrund ihrer größeren Verbindlichkeit unter dem Schutz der staatlichen Ordnung stehen sollte.121 Schließlich hat der Staat ein Interesse an der entlastenden Funktion, die der Ehe als Fürsorge- und Beistandsgemeinschaft zugeschrieben wird.122 Doch kann auch anderen Lebensformen diese Funktionen zugeschrieben werden.
Die angeführten Überlegungen deuten darauf hin, dass die vom Grundgesetz her garantierte besondere Rolle der Ehe mit Blick auf Familien zu problematisieren ist. In der gesellschaftlichen Realität ist die Bezogenheit von Ehe und Familie zunehmend loser geworden. Zwar wächst die Mehrzahl der Kinder immer noch in der klassischen Familie auf, die aus Ehemann und -frau sowie mindestens einem Kind besteht, doch gibt es eine wachsende Zahl an alternativen Familienformen, bei denen Kinder lediglich bei einem Elternteil oder in nichtehelichen oder gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften und Ehen aufwachsen.123
Festzuhalten ist ein Wandel hinsichtlich der Stellung der Ehe in der Rechtsprechung. Anfangs stand die Privilegierung der Ehe im Vordergrund. Diese basierte auf der Vorstellung, dass die Ehe die Grundlage für die Familie darstelle und beide Rechtsinstitute gemeinsam für die staatliche Ordnung normativ seien. 124 Damit ging die Diskriminierung nichtehelicher Lebensformen einher. Eine solche Ordnung ist im Wandel: »Das Fördergebot des Art. 6 Abs. 1 GG kann nicht als Benachteiligungsgebot für andere Lebensformen als die Ehe verstanden werden.«125 Die zentrale Frage ist demnach, wie die Ehe geschützt werden kann, ohne dass nichteheliche Lebensformen diskriminiert und benachteiligt werden.126 Eine rechtliche Bestimmung des Verhältnisses verschiedener Lebensformen zueinander ist nicht nur um der einzelnen Lebensformen selbst willen notwendig, sondern steht auch in einer Verbindung zum Familienbegriff. Dieser wird in der Rechtsanwendung als Eltern-Kind-Gemeinschaft aufgefasst – ungeachtet des Familienstandes der Eltern. Doch ist Familie als Eltern-Kind-Gemeinschaft eine denkbar weite Definition. Innerhalb dieser können durchaus Schwerpunkte gesetzt werden. Dies kann grundsätzlich die Frage betreffen, ob die Form oder die Funktion einer Familie wichtiger ist. Abhängig von der schwerpunktmäßigen Funktion, die der Familie zugeschrieben wird, können darüber hinaus verschiedene Formen des Zusammenlebens bevorzugt oder benachteiligt werden.127 Andersherum ist auch zu überlegen, ob nicht aus bestimmten Formen, die eine Familie annehmen soll, unterschiedliche Funktionen folgen. In jedem Fall gilt, dass Formen und Funktionen der Familie miteinander verwoben sind. Sie können deshalb nicht isoliert voneinander betrachtet werden.
Weder die Begriffe der Ehe und der Familie noch das Verhältnis beider Institute zueinander können in der Rechtsanwendung eindeutig bestimmt werden. Vom Wortlaut her ist eine Offenheit zu konstatieren, die weitere Auslegungsmethoden notwendig werden lässt. Zwar kann mithilfe der historischen Auslegung der damalige Entstehungskontext samt seiner Anknüpfungspunkte und Abgrenzungen erhellt werden. Darüber hinaus kann aber auch mittels dieser Methode nicht zweifelsfrei festgestellt werden, wie sich der Begriff der Ehe und der Begriff der Familie zueinander verhalten.128 Im Übrigen kommt die Schwierigkeit des zeitlichen Abstandes hinzu. Selbst wenn das Verhältnis für die Zeit der Verabschiedung des Grundgesetzes hätte eindeutig herausgearbeitet werden können, bliebe die Frage, in welchem Zusammenhang Ehe und Familie in der gegenwärtigen Zeit zueinander stehen.129
Außerdem ist festzuhalten, dass weder der Begriff der Ehe noch der Begriff der Familie im Grundgesetz näher erläutert werden. Dadurch wohnt Art. 6 GG eine Offenheit inne, die es ermöglicht, den gesellschaftlichen Wandel bei der Rechtsanwendung zu berücksichtigen und den verfassungsrechlich garantierten Schutz der Familie auszudehnen. Auch Familienmodelle jenseits der klassischen Kernfamilie können folglich unter dem Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Auf diese Weise werden zeitgemäße Auslegungen des Rechts ermöglicht, ohne dass diese jeweils Änderungen des Wortlautes des Grundgesetzes voraussetzen müssten.130 Eine gesellschaftliche Veränderungen aufgreifende Akzentuierung von Begriffen stellt jedoch nur eine Möglichkeit dar. Alternativ kann eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen auch zur Folge haben, dass Veränderungen verhindert werden. Trotz der deutungsoffenen Begriffe wird an tradierten Interpretationen festgehalten. Nicht das angesichts der gesellschaftlichen Realität Gebotene wird dann als Maßstab der Rechtsanwendung zugrunde gelegt, sondern das Gesetzte.131
Die Frage, ob dem Gesetzten oder dem aufgrund äußerer Umstände Gebotenen bei der Rechtsanwendung gefolgt werden soll, ist Gegenstand der Rechtsphilosophie. Die erstgenannte Auffassung, dass das Recht ist, was gesetzt und sozial wirksam ist, wird als positivistisch bezeichnet.132 Nach BERND RÜTHERS/CHRISTIAN FISCHER/AXEL BIRK sind folgende Maximen für den Rechtspositivismus grundlegend: Erstens ist der Staat die einzige Rechtsquelle. Zweitens ist jedes erlassene Gesetz, das mit der Verfassung konform ist, bindendes Recht. Drittens ist der Gesetzgeber unabhängig von moralischen Grundwerten oder der Idee der Gerechtigkeit.133 Dem Rechtspositivismus gegenüber stehen nichtpositivistische Auffassungen, wonach der Rechtsbegriff auch moralische Elemente enthält und folglich die inhaltliche Richtigkeit einer Norm ebenso eine Rolle in der Bewertung dessen spielt, was Recht ist.134 Das grundlegende Problem besteht also in der Bestimmung des Zusammenhangs von Recht und Moral. Auch die Negation eines Zusammenhangs stellt hierbei eine mögliche Interpretation dar.135 Recht und Moral stehen in einem ambivalenten Verhältnis zueinander. 136 Dem Recht kommt einerseits die Funktion zu, moralische Normen durchzusetzen. Hier ist beispielsweise an Tötungs- oder Diebstahlverbote zu denken. Andererseits soll das Recht den Einzelnen vor den moralischen Forderungen anderer oder der Gemeinschaft schützen. Beispielhaft ist hierfür die Funktion der Grundrechte, den Einzelnen vor unverhältnismäßigen Eingriffen des Staates zu bewahren. Mit diesen Ambivalenzen geht die Frage einher, wie sehr das Recht von moralischen Normen bestimmt sein darf. Umgekehrt kann gefragt werden, wie weit das Recht von Normen moralischer Natur abweichen darf. Weichen die vom Gesetzgeber erlassenen rechtlichen Normen in starkem Maße von moralischen Vorstellungen ab, kann dies die Nichtbefolgung der rechtlichen Normen zur Folge haben. Es darf bezweifelt werden, dass eine solche Reaktion vonseiten des Gesetzgebers erwünscht ist. Bei einer solchen Fragerichtung wird die gegenseitige Abhängigkeit von Recht und Moral vorausgesetzt. Im deutschen Rechtssystem wurde diese Grundannahme übernommen. Alle staatliche Gewalt ist in Deutschland an die Grundrechte gebunden, die wiederum moralische Normen darstellen.137
Im Folgenden soll die Annahme gelten, dass Recht und Moral in einem Zusammenhang stehen. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates nahmen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung reflektiert auf. Ebenso brachten sie eigene Vorschläge in die Diskussion ein. Dabei waren sie von moralischen Normen in Bezug auf Ehe und Familie geprägt. Gleiches gilt für die gegenwärtig an der Rechtsprechung Beteiligten. Für den weiteren Verlauf der Arbeit scheint es nun geboten, die mit Blick auf Ehe und Familie leitenden moralischen Normen offenzulegen und darzustellen sowie sie sodann auch kritisch zu reflektieren. Dies ist nicht aus das Gebiet der Rechtsphilosophie beschränkt. Vielmehr rücken andere Wissenschaften in den Fokus – Soziologie und Theologie.138