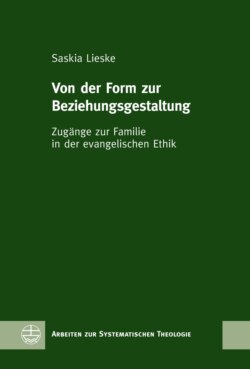Читать книгу Von der Form zur Beziehungsgestaltung - Saskia Lieske - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. ZUSAMMENFASSENDE THESEN
ОглавлениеZwei zentrale Einsichten sollen am Ende dieses Kapitels festgehalten werden: Erstens weisen die dargestellten theoretischen Ansätze darauf hin, dass sich Familienformen sowie die an die Familie gerichteten Erwartungen in einem kontinuierlichen Wandel befinden. Der Grund hierfür ist, dass die Familie immer von verschiedensten Faktoren abhängig ist, die einen Einfluss auf die familiale Lebenswelt haben. Umgekehrt gilt ebenso, dass familiale Lebensweisen gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen. Vereinfacht ausgedrückt heißt dies, dass die Familie – sei es als Institution oder bezüglich ihrer einzelnen Mitglieder und deren Beziehungen untereinander – stets in einer Wechselwirkung mit äußeren Einflüssen steht. Aus dieser Perspektive erscheint der Wandel im Sinne von Veränderung als ein für die familiale Lebenswelt konstitutives Geschehen.
Zweitens ist die akzeptierte Vielfalt familialer Lebensformen die Konsequenz aus dem mehrheitlich vertretenen Familienleitbild. So lange die Erhebung milieuspezifischer Familienleitbilder noch ein Desiderat der Forschung darstellt, können Schlussfolgerungen nur aus dem bisher erhobenen Familienleitbild gezogen werden. Dem entspricht es, dass die Familie weder auf eine bestimmte Form noch auf bestimmte Funktionen reduziert wird. Stattdessen gehören zur Familie in aller Regel Kinder, sodass formal betrachtet hauptsächlich Eltern-Kind-Gemeinschaften als Familien erachtet werden. Der Familienstand der Eltern spielt dabei keine Rolle. Zugleich stellt die Gewährleistung eines stabilen Rahmens für das Aufwachsen und die Sozialisation von Kindern eine wichtige Funktion der Familie dar. Doch liegt dem Familienleitbild keine Entweder-Oder-Struktur zugrunde. Vielmehr sind formale und funktionale Aspekte miteinander verwoben. Gerade das eröffnet die Möglichkeit einer familialen Vielfalt, weil Familien nicht auf eine bestimmte Form festgelegt werden.
Aus diesen beiden Ansichten, der Unausweichlichkeit familialen Wandels und der Offenheit für familiale Vielfalt, ergeben sich eine Reihe von Schlussfolgerungen für das weitere Nachdenken über Familie.
(1) Die Diskussion um Entwicklungen im Bereich der Familie ist immer subjektiv geprägt, da Vorstellungen zur Familie immer vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen mit der Familie und den medial vermittelten Bildern familialen Lebens gewonnen werden. Gerade deshalb ist es wichtig, sich in der Diskussion stets der Normalität familialen Wandels zu vergewissern. Jenseits der alternativen Wahrnehmungen dieses Wandels als Fortschritt oder Verfall kann neutral festgehalten werden, dass sich auf dem Gebiet der Familie ein kontinuierlicher und unumgänglicher Wandel vollzieht.332
(2) Wenn sich die Vorstellungen dessen, wer eine Familie darstellt und was diese auszeichnet, ständig wandeln, ist Vorsicht geboten, einem bestimmten Familienmodell einen normativen Charakter zuzuschreiben. Die Gefahr besteht darin, den zeitlichen Rahmen zu verengen und den Blick dafür zu verstellen, dass es stets eine Vielfalt an Familienformen gab. Dies gilt einerseits für das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie, die in dieser Form lediglich zwei Jahrzehnte lang im 20. Jahrhundert die dominierende Familienform in den alten Bundesländern war, andererseits aber auch für zukünftige Diskurse zur Familie.
(3) Familiale Entwicklungen stehen immer in einem Zusammenhang mit externen Faktoren. Beide beeinflussen sich gegenseitig. Das stellt einen Anknüpfungspunkt für andere Wissenschaften dar, da im Gespräch mit ihnen Einsichten für die Familiensoziologie gewonnen werden können, die familiale Entwicklungen erklären. Gleichzeitig gilt, dass auch familiensoziologische Erkenntnisse in die Argumentationen anderer Fachgebiete einfließen können.
(4) Die Familienleitbildforschung befindet sich noch in ihren Anfängen. Aus interdisziplinärer Sicht erscheint ein Dialog zwischen Soziologie und Theologie als erstrebenswert, wenn davon ausgegangen wird, dass religiöse Vorstellungen zur Familie das Leitbild des Einzelnen beeinflussen. Die Theologie kann solche Vorstellungen plausibilisieren.
(5) Den gegenwärtigen Leitbildern von Familie wohnt eine Pluralität hinsichtlich der Familienformen inne. Denn in ihrem Zentrum steht das Verlangen nach Stabilität. Das betrifft sowohl die Partnerschaft selbst als auch die finanzielle und berufliche Situation der Partner. Stabilität wird wiederum nicht zwangsläufig von einer bestimmten Familienform garantiert, sondern vom Verhalten der Beteiligten bedingt.
(6) Damit rückt das Familienleben in den Fokus, auf das sich die mit Familienleitbildern verbundenen Erwartungen richten. Vonseiten der soziologischen Theoriebildung wird der Alltag von Familien vor allem in praxistheoretischen Ansätzen analysiert. Dabei sind oftmals familienbezogene Einzelfragen im Blickpunkt. Im interdisziplinären Diskurs ist ihnen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, wenn das Familienleben stärker thematisiert werden soll, da bei diesen Ansätzen das Beziehungsgeschehen im Mittelpunkt steht.
(7) Wenn aus soziologischer Sicht die Familie immer offen für Wandel ist und eine Vielfalt an familialen Lebensformen weithin akzeptiert ist, ergibt sich für die Theologie die Frage, inwieweit soziologische Fragen samt ihrer vorläufigen Antworten rezipiert werden können. Denkbar ist, dass eine Rezeption geradewegs abgelehnt wird. Die Grenze der wissenschaftlichen Disziplinen wäre undurchlässig. Unterschiedliche Perspektiven auf den Betrachtungsgegenstand Familie würden unvermittelt nebeneinanderstehen. Alternativ kann über die Rezeption nachgedacht werden. Ausschnitthafte Einsichten in die familiale Realität gilt es dann mit theologischen Perspektiven auf die Familie in Beziehung zu setzen.
Nicht nur diese zusammenfassenden Thesen und die ihnen zugrunde liegende Darstellung soziologischer Perspektiven, sondern auch die vorangegangene rechtliche Perspektive dienen der Kontextualisierung der Familie. Die Erkenntnisse dieser beiden Arbeitsschritte fließen in die nun folgenden Kapitel zu ethischen Ansätzen in christlicher Perspektive ein. Zum Teil geschieht dies im Hintergrund, wenn vor allem die Überlegungen der beiden evangelischen Ethiker RENDTORFF und HÄRLE dargestellt werden. Zum Teil wird jedoch auch explizit auf rechtliche und soziologische Perspektiven Bezug genommen, wenn RENDTORFFS und HÄRLES Aussagen kritisch hinterfragt werden, aber auch, wenn im abschließenden Kapitel dieser Arbeit eine ethische Kriteriologie für die Familie entwickelt wird.