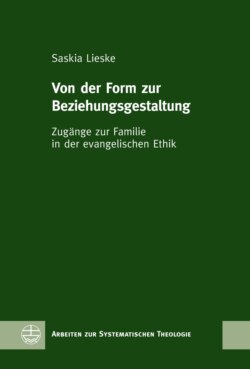Читать книгу Von der Form zur Beziehungsgestaltung - Saskia Lieske - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. EINLEITUNG
Оглавление»Wer sich allein an der Form von Familien abarbeitet, dem sind die Inhalte des Familienlebens gleichgültig.«1 Mit diesen, zugegebenermaßen spitzen, Worten blicken UTE GERHARD und BARBARA THIESSEN, zwei Mitautorinnen der 2013 veröffentlichen Orientierungshilfe der EKD Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken, auf die zurückliegende Debatte. Verglichen mit der sonst auf Fachkreise begrenzten Rezeption kirchlicher Veröffentlichungen löste die Orientierungshilfe nach ihrem Erscheinen eine hitzig geführte innerkirchliche und öffentlich-mediale Kontroverse aus. Drei Jahre zuvor war eine Kommission vom Rat der EKD mit dem Auftrag eingesetzt worden, das Thema Familie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu erarbeiten und eine »evangelische Position«2 dazu zu formulieren. Diesem Auftrag gemäß liegt der inhaltliche Schwerpunkt dieser Orientierungshilfe auf familienpolitischen Fragestellungen und dem Beitrag von Kirche und Diakonie zu diesen Debatten. Dabei geht es vor allem um die Förderung eines neuen, an Gerechtigkeit ausgerichteten Familienmodells, nämlich die »partnerschaftliche Familie, in der die Rechte und Pflichten jedes Mitgliedes, auch der Kinder, gerecht untereinander geteilt und wechselseitig anerkannt werden.«3 Überlegungen zu partnerschaftlichen Lebensformen spielen dagegen keine zentrale Rolle, werden jedoch im Rahmen der Theologischen Orientierung anhand der Frage nach dem Verhältnis von Ehe und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften thematisiert.4
In der innerevangelischen Debatte, wie auch darüber hinaus, wurden vor allem die Abkehr von der Ehe zwischen Mann und Frau als einziger partnerschaftlicher Idealform und die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mitunter scharf kritisiert.5 Des Weiteren verdeutlichten die Reaktionen, dass sich der Streit in der Ökumene heutzutage vordergründig an ethischen Fragestellungen entzündet.6 So wurde von Seiten römisch-katholischer Theologen7 der Vorwurf erhoben, dass das dargestellte »neue« evangelische Familienbild einer Aufkündigung bisheriger ökumenischer Konsense gleichkäme. 8 Darüber hinaus fand auch außerhalb der kirchlichen Öffentlichkeit, hauptsächlich in den Medien und der Politik, eine Rezeption des EKD-Papiers statt. Im Zentrum der Kritik stand hier ebenfalls die These von der Gleichwertigkeit verschiedener Formen von Familie und Partnerschaft. Daran lässt sich erkennen, dass die Ehe von Mann und Frau als normative Form der Partnerschaft und die sogenannte klassische Mutter-Vater-Kind-Familie als gesellschaftliches Ideal weiter verbreitet zu sein scheinen, als dies die faktisch gegebene und oftmals akzeptierte Pluralität der Lebensformen vermuten lässt.9 Gleichzeitig gab es jedoch auch Stimmen, die gerade die Anerkennung der Gleichwertigkeit verschiedener Lebensformen auf der Grundlage ihrer inhaltlichen Ausgestaltung von Seiten der Autoren der Orientierungshilfe begrüßten.10 Der Einblick in die Kontroverse verdeutlicht, dass die Dringlichkeit, über die vielfältigen Herausforderungen im alltäglichen Leben der Familien nachzudenken, angesichts der vehementen Diskussionen um die Form der Familie außer Acht gelassen wird. Dies ist umso kritischer zu sehen, als dass die Frage nach der Familienform im Kern eine Diskussion über die partnerschaftliche Lebensform der Eltern darstellt. Zwar hat diese einen Einfluss auf das Familienleben, doch wirft der Alltag von Familien vielfältigere Fragen als die auf, ob Eltern miteinander verheiratet sein sollen oder ob es daneben auch andere, gleichwertige Familienformen geben kann.
So korreliert die breit geführte kirchliche Debatte um die Orientierungshilfe der EKD mit dem öffentlichen Diskurs zur Familie. Dazu gehören unter anderem Fragen zum Stellenwert der sogenannten klassischen Mutter-Vater-Kind-Familie für die Gesellschaft, zu ihrem Verhältnis zu den stetig anwachsenden alternativen Familienformen, zu den Adoptionsrechten gleichgeschlechtlicher Paare, zu den Möglichkeiten und Grenzen moderner Reproduktionsmedizin sowie dem Verhältnis familialer zu anderen Lebensformen. Gemeinsam ist diesen Themen, dass sie in der Regel stark polarisieren. Da jeder Mensch eine Herkunftsfamilie hat, die Mehrheit eine eigene Familie gründet und auch Singles oder kinderlose Paare Familien in ihrem Umfeld kennen, ist jeder Mensch in existentieller Weise von der Thematik betroffen. Verstärkend kommt hinzu, dass die eigene Identität durch die Erfahrungen in der Familie geprägt ist. Dazu zählen auf der einen Seite die vielfältigen Erfahrungen in der Herkunftsfamilie, die ihrerseits nicht nur die Perspektive auf die Familie im Allgemeinen, sondern auch auf eine mögliche eigene Familie beeinflussen. Auf der anderen Seite prägt die eigene Lebensform ebenfalls die Sicht auf das Thema Familie. In den Debatten steht deshalb immer auch der eigene Lebensentwurf zur Disposition. Infragestellungen oder Bekräftigungen bestimmter Lebensformen im öffentlichen Diskurs können dementsprechend leicht als Kritik oder Affirmation der individuellen Lebensform verstanden werden. Die Folge sind häufig emotional geführte Diskussionen, die nicht per se zu diskreditieren sind, den sachlichen Austausch jedoch erschweren. Angesichts einer kontinuierlich wachsenden Zahl familialer Lebensformen, einer fortschreitenden Instrumentalisierung von Familien seitens der Wirtschaft, einer nur langsam voranschreitenden Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zahlreicher Erwartungen, die von Seiten der Politik und der Gesellschaft den Familien zugeschrieben werden, scheint es notwendig, eine Debatte über Familienbilder zu führen. Um der Komplexität des Themas gerecht zu werden, sowohl hinsichtlich der Familienformen als auch in Bezug auf die inhaltliche Ebene, muss die Diskussion über Emotionen und Meinungen hinausgehen.
Im Kontrast zur Intensität der Debatte um die Orientierungshilfe steht die Randständigkeit der Familie als Thema christlicher Ethik.11 Dafür ist paradigmatisch, dass Überlegungen zur Familie an Reflexionen zur Ehe angeschlossen werden, sodass von einer eigenständigen Annäherung an die Familie oft keine Rede sein kann. Einerseits lässt sich dieser Sachverhalt historisch erklären, da Ehe und Familie lange Zeit in einem untrennbaren Zusammenhang standen und dieses Bild in dem Modell der bürgerlichen Kleinfamilie fortbesteht. Andererseits drängt die faktisch gegebene Vielfalt familialer Lebensformen sowohl aus innerkirchlichen als auch darüber hinausreichenden Gründen zu einer inhaltlichen Ausdifferenzierung der ethischen Zugangsmöglichkeiten zur Familie aus christlicher Perspektive. Innerkirchlich liegt dies nahe, da auch in den Kirchengemeinden die Vielfalt familialer Lebensformen anzutreffen ist, während dort zugleich das klassische Bild der Mutter-Vater-Kind-Familie tief verwurzelt scheint. Die daraus erwachsenden Spannungen, insbesondere der Umgang mit der familialen Vielfalt, sind vor dem Hintergrund eines christlich geprägten Wirklichkeitsverständnisses zu reflektieren. Eine Intensivierung des christlichethischen Nachdenkens über die mannigfaltigen Dimensionen der Familie kann zudem einen Beitrag zur Versachlichung des Diskurses leisten.12 Darüber hinaus zeigt die breite, über die christlichen Kirchen hinausreichende Rezeption der Orientierungshilfe, dass deren Haltung zu familienbezogenen Fragestellungen auch außerhalb kirchlicher Kontexte von Interesse ist. Eine Partizipation am öffentlichen familienethischen Diskurs in Form von christlich-ethischen Debattenbeiträgen liegt deshalb nahe. An diese umfassende Reichweite familienethischer Überlegungen kann christliche Ethik anknüpfen, da sie zwar auf spezifischen Voraussetzungen aufbaut, ihr Adressatenkreis jedoch über die, die ihre Voraussetzungen teilen, hinausgeht. Angesichts des innerkirchlichen Klärungsbedarfes und der existentiellen Bedeutung von Familie für jeden Menschen ist die thematische Eigenständigkeit der Familie in der christlichen Ethik, die in Ansätzen bereits gegeben ist, weiterzuentwickeln.
Die Eigenständigkeit der Familie als ethisches Thema hervorzuheben, ist allerdings nicht gleichbedeutend damit, den Zusammenhang von Familie und Ehe gänzlich aufzulösen. Denn die Verbindung von Familie und Ehe ist ein Sinnbild dafür, dass Familie nicht losgelöst von partnerschaftlichen Lebensformen thematisiert werden kann. Aufgrund der modernen Reproduktionsmedizin ist zwar keine sexuelle Partnerschaft vonnöten, um ein Elternteil zu sein, jedoch kann diese Möglichkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein untrennbarer Zusammenhang zwischen der Eltern-Kind-Gemeinschaft und partnerschaftlichen Lebensformen besteht. Ethisch brisant sind dabei vor allem jene Fragen, die sich ergeben, wenn Menschen sich ein Kind wünschen, dies jedoch nicht auf natürlichem Wege realisieren können oder nicht im Rahmen einer Partnerschaft verwirklichen wollen. Ersteres gilt besonders in Bezug auf gleichgeschlechtliche Paare. Wie sind deren Möglichkeiten, dem Kinderwunsch nachzugehen, ethisch zu beurteilen? Kann die Reproduktionsmedizin als Emanzipation von der Natur befürwortet werden? Welche Gründe sprechen gegen Samenspende oder Leihmutterschaft, die in Deutschland verboten ist? Anhand dieser Fragen wird der enge Zusammenhang von familialen und partnerschaftlichen Lebensformen deutlich. Ebenso gilt dies auch für Familien, die bewusst nicht auf einer Partnerschaft der Eltern aufbauen. Zu nennen ist hier das sogenannte Co-Parenting, bei dem zwei Menschen gemeinsam ihren Kinderwunsch realisieren, ohne jedoch ein Liebespaar zu sein. Auch die hier getroffene, bewusste Entscheidung gegen eine Partnerschaft versinnbildlicht letzten Endes den bestehenden Zusammenhang. Die Gründung einer Familie kann nicht geschehen, ohne sich zu Partnerschaft zu verhalten. Von ethischer Relevanz ist deshalb, wie dieser Zusammenhang qualifiziert wird. Ist die Familie als eine Ableitung der Ehe von Mann und Frau konzipiert, sodass alle Familienformen, deren Grundlage nicht die Ehe ist, gegenüber der idealtypischen Familie einzig aufgrund ihrer Form als defizitär gelten? Oder stehen familiale und partnerschaftliche Lebensformen in einer Verbindung, die im Kontext der Familienethik zu thematisieren ist, jedoch zugleich nicht deren Schwerpunkt bildet? Die Form der Familie wäre somit ein Thema neben anderen, welche die inhaltliche Ausgestaltung des Familienlebens vermehrt ins Zentrum der Debatte rücken.
Auf dem Gebiet christlicher Ethik fällt die Antwort auf die Frage, in welchem Zusammenhang familiale und partnerschaftliche Formen des Zusammenlebens stehen, verschieden aus. Die diversen Ansätze verbindet allerdings, dass allein aus der Form der Familie noch keine Rückschlüsse hinsichtlich dessen gezogen werden können, wie das Leben innerhalb der Familien aus ethischer Perspektive gestaltet werden kann. Formbezogene Überlegungen können deshalb immer nur ein Teil familienethischer Reflexionen sein, die zwangsläufig auch um weiterreichende Überlegungen zur inhaltlichen Dimension ergänzt werden müssen. Dies ist umso drängender, da ethische Konflikte vor allem im alltäglichen Leben von Familien zutage treten. Um eine Hilfestellung zur selbstständigen Urteilsbildung für den Einzelnen zu sein, darf sich Familienethik nicht in formbezogenen Aussagen erschöpfen, sondern muss die Gestaltungsmöglichkeiten familialen Lebens ins Zentrum rücken.
Damit ist der Perspektivenwechsel genannt, welcher der Familie als eigenständigem Thema christlicher Ethik zugrunde liegt – weg von einer allzu starken Fokussierung auf eine normative Familienform hin zu der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung familialen Lebens.13 Der Einzelne steht hinsichtlich der Handlungsoptionen vor einer kaum überschaubaren Vielfalt von Vorstellungen und Erwartungen hinsichtlich der Möglichkeiten, das Familienleben auszugestalten. Aus dieser Vielgestaltigkeit erwächst ein Orientierungsbedarf seitens der Menschen für ihr Handeln, der einen Anknüpfungspunkt für die Ethik bildet, wenn diese nicht allein auf theoretische Fragestellungen begrenzt sein, sondern stattdessen Angelegenheiten der konkreten Lebensführung thematisieren soll. Christliche Ethik darf sich diesen Diskussionen aus den bereits genannten Gründen nicht entziehen, wenn sie der fundamentalen Bedeutung der Familie für den Einzelnen und innerhalb der Gesellschaft Rechnung tragen will.
Das Anliegen der vorliegenden Arbeit besteht darin, den beschriebenen Perspektivenwechsel von einer alleinigen Fokussierung auf Familienformen hin zu einer breiteren Wahrnehmung der zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten des Familienlebens zu vertiefen und dadurch die Eigenständigkeit der Familie als ethisches Thema zu verstärken. Dabei liegt der Fokus allerdings nicht darauf, einzelne materialethische Fragestellungen zu analysieren und ethische Urteile bezüglich bestimmter Handlungsoptionen zu entwickeln. Durch eine solche Herangehensweise wäre immer nur ein Ausschnitt familialer Wirklichkeit Gegenstand der Ethik. Dies ist an sich nicht problematisch; gleichwohl wird dadurch das Bild verstärkt, dass die Familie ein fragmentiertes Thema der Ethik ist. Statt der Familie selbst sind oft nur einzelne, sie betreffende Bereiche Gegenstand der Reflexion. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, spielen einzelne materialethische Fragestellungen in dieser Arbeit nur eine untergeordnete Rolle. Zwar werden Bezüge zu kontroversen Themen wie den Adoptionsrechten gleichgeschlechtlicher Paare, dem Umgang mit Trennungen und Scheidungen, der Vielfalt partnerschaftlicher Lebensformen oder der Entkoppelung von biologischer und sozialer Elternschaft hergestellt. Doch geschieht dies vor allem in Form von Ausblicken, ohne dabei detaillierte Antworten zu gewinnen. Das Fundament dieser Arbeit bildet vielmehr das Anliegen, bestehende Zugänge zur Familie als Ganzes zu analysieren und daran anschließend weitere Alternativen zu entwickeln. Auf welcher Grundlage können normative Aussagen in der Familienethik getroffen werden? Geschieht dies aufbauend auf einer idealtypischen Familienform? Sind es vorrangig Funktionen, die der Familie zugeschrieben werden und deren Ausübung im gesamtgesellschaftlichen Gefüge erwartet wird? Oder gibt es, wie es der Titel der Arbeit suggeriert, auch eine Alternative jenseits dieser beiden Ansätze? Um das Anliegen dieser Arbeit zu realisieren und nach grundlegenden Zugängen zur Familie als Thema christlicher Ethik zu fragen, werden sowohl die »Form von Familien«14 als auch die »Inhalte des Familienlebens«15 reflektiert.
Auf der einen Seite soll damit eine einseitige Diskussion der Familienformen vermieden werden. Denn diese läuft Gefahr, Familien allein aufgrund ihrer Form als defizitär zu erachten und die hinter der Pluralisierung der familialen, ebenso wie der partnerschaftlichen Lebensformen liegenden Motive nicht ausreichend zu ergründen. Um solchen Tendenzen entgegenzuwirken, sind auch die inhaltlichen Dimensionen von Familien in den Blick zu nehmen. Dabei rückt vor allem die Gestaltung der Beziehung zwischen den Familienmitgliedern ins Zentrum, da sie das Familienleben in besonderem Maße prägt. Wie können die familialen Beziehungen lebensdienlich gestaltet werden? Wie kann ein geschützter Raum der Familie aussehen, der zugleich dem Einzelnen Freiräume gewährt? Die Beziehungsebene von Familien als einen alternativen, ethischen Zugang zur Familie stärker zu berücksichtigen, wirkt sich zugleich auf materialethische Fragestellungen aus, die für gewöhnlich vor allem dem Themenkreis der Familienform zugeordnet werden. Die Verschränkung von Form und Inhalt hat auf der anderen Seite zur Folge, dass der Fokus ebenso wenig allein auf der inhaltlichen Ebene der Familie liegt.
Für die Umsetzung dieses Anliegens folgt die Arbeit einem viergliedrigen Schema. Rechtliche und soziologische Vertiefungen gehen dem ethisch-theologischen Teil voraus, der den Schwerpunkt bildet. An diesen schließt sich die Entfaltung ethischer Kriterien an, welche den Blick für das Beziehungsgeschehen schärfen soll, das den diversen Familienformen zugrunde liegt. Der zu Beginn der Arbeit erfolgende Rückgriff auf Recht und Soziologie geschieht mit dem Ziel, die ethischen Auseinandersetzungen um die Familie zu kontextualisieren. Mit der Einbeziehung anderer Fachbereiche ist der Anspruch verbunden, eine allzu voreingenommene Darstellung familialer Wirklichkeit seitens der Ethik zu vermeiden. In der Ethik müssen zunächst die Bedingungen, unter denen Familien ihr Leben führen, wahrgenommen und beschrieben werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Deskription unter dem Vorbehalt der Perspektivität steht, demzufolge Familien vor allem so gesehen werden, wie es dem eigenen Bild der Familie entspricht. Wo die Abweichungen zur individuellen Lebensführung zu zahlreich erscheinen, steht womöglich die eigene Identität zur Disposition. Nun ist freilich einzuräumen, dass die Perspektivität kein exklusives Phänomen der Theologie ist. Sie liegt vielmehr allen Wissenschaften zugrunde. Durch den Rückgriff auf rechtliche und soziologische Themenstellungen zur Familie soll ein möglichst umfassender Eindruck der vielschichtigen Wirklichkeit familialen Lebens vermittelt werden.16 Zu berücksichtigen ist dabei, dass die rechtlichen und soziologischen Erkenntnisse keine Quelle normativer ethischer Aussagen in christlicher Perspektive sind. Vielmehr vermitteln sie ein Bild der gegenwärtigen Lebensrealität von Familien, aus der ethische Fragen entwickelt werden können.
Der große Einfluss der Rechtsprechung auf das Familienleben, sowohl auf der inhaltlichen Ebene als auch hinsichtlich der Familienformen, ist in den vergangenen Jahren anhand grundsätzlicher Urteile des Bundesverfassungsgerichtes deutlich geworden.17 Des Weiteren bestimmen die familienrechtlichen Regelungen auch über Trennungen hinaus das familiale Zusammenleben. Zugrunde liegt den verschiedenen familienbezogenen Gesetzen Art. 6 GG, dessen Spitzenaussage darin besteht, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. 18 Vor dem Hintergrund der allgemeinen Formulierung auf der einen und der Pluralität familialer Lebensformen, die in der Gesellschaft begegnen, auf der anderen Seite, wirft dieser Absatz viele Fragen zum Umgang mit der Vielfalt auf, die zugleich auch Gegenstand der Ethik sind. Daran wird deutlich, dass sich Recht und Ethik berühren, was eigens, wenngleich skizzenhaft, reflektiert wird.19 Angesichts der Feststellung, dass rechtliche Diskussionen gesellschaftliche Entwicklungen auf dem Gebiet der Lebensformen widerspiegeln und umgekehrt durch Rechtsprechung und Gesetzgebung die Entwicklungen vorangetrieben oder gehemmt werden können, liegt es nahe, auf die rechtliche Situation von Familien einzugehen, um so Anknüpfungspunkte für ethische Perspektiven zu schaffen.
Von Seiten der Soziologie fließen theoretische und empirische Perspektiven auf die Familie in die Arbeit ein. Wie in der Ethik bestehen auch in der Soziologie diverse theoretische Zugänge zur Familie, die entweder stärker die Familienformen oder das innere Geschehen der Familie in den Fokus rücken. In einem ersten Schritt sollen die ausgewählten soziologischen Ansätze dargestellt werden. Leitend ist dabei vor allem die Frage, wie mit ihrer Hilfe der stetige Wandel familialer Lebensformen erklärt werden kann. Denn zu den zentralen Einsichten der Soziologie zählt, dass Familie immer schon einem Wandel unterliegt, wodurch Vertreter der Annahme, dass es eine einzige normative Familienform gäbe, vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Begründung ihrer These gestellt werden. Das gilt auch für die Theologie, für die soziologische Erkenntnisse zwar keinen normativen Geltungsanspruch haben, die dadurch jedoch in besonderer Weise vor der Herausforderung steht, ein bestimmtes normatives Familienmodell vor dem Hintergrund faktischer Vielfalt zu plausibilisieren. In einem zweiten Schritt stehen sodann empirische Ergebnisse zu Familien in Deutschland im Mittelpunkt. Als Grundlage dienen dafür zum einen der Mikrozensus 2013 und zum anderen die noch junge Forschung zu Familienleitbildern. Damit werden zwei Ziele verfolgt. Zunächst soll mittels des Mikrozensus die Häufigkeit von Lebensformen samt dazugehöriger Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten dargestellt werden, um kritisch die immer wieder begegnende These erörtern zu können, die traditionelle Familie befinde sich in einem Verfall. Auf die qualitative Leitbildforschung wird dagegen zurückgegriffen, um einen Einblick in gesellschaftlich verbreitete Vorstellungen zur Familie zu gewinnen. Auch dies ist für einen ethischen Zugang zu Familien relevant, da das eigene Familienleben in aller Regel auch in Bezug zu gesellschaftlich verankerten Vorstellungen gestaltet wird. Nicht selten geht davon ein Druck für den Einzelnen aus, wenn die eigenen und die gesellschaftlichen Vorstellungen und Erwartungen nicht übereinstimmen, woraus wiederum ethische Konflikte entstehen können.
Die Lebensrealität von Familien kann nur ausschnitthaft erfasst werden. Inwieweit sich die damit angedeuteten Herausforderungen für Familien tatsächlich in der christlichen Ethik niederschlagen, wird bei der Auseinandersetzung mit zwei ausgewählten ethischen Ansätzen kritisch geprüft werden. Doch stellt dies nur einen Aspekt des theologischen Hauptteils dar. Den weitaus bedeutsameren Schwerpunkt bildet die Frage, wie innerhalb christlicher Ethik normative Aussagen über die Familie entwickelt werden können und ob diese im Wesentlichen auf die Form oder auf die Gestaltung des Familienlebens zielen. Für die Durchführung dieser Fragestellung wurden zwei Ethiken ausgewählt: die erstmals 1980/81 erschienene Ethik des Ende 2016 verstorbenen Münchner Theologen TRUTZ RENDTORFF und die 2011 veröffentlichte Ethik des Heidelberger Theologen WILFRIED HÄRLE. Die genannten Werke dieser beiden evangelischen Ethiker bilden aus verschiedenen Gründen die textliche Grundlage dieser Arbeit. Entgegen der sonst begegnenden Randständigkeit findet eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Familie statt, die über einzelne Themen hinausreicht.20 Dies ist vor allem eine Folge der Tatsache, dass die materialethischen Reflexionen sowohl bei RENDTORFF als auch bei HÄRLE an die jeweiligen theoretischen Grundlegungen angeschlossen sind, deren Erkenntnisse auf die Familie angewendet werden. Diese Verbindung von ethischer Theorie und materialethischer Entfaltung prägt die Entwürfe der beiden Autoren. Zum anderen bietet der Abstand von 30 Jahren zwischen den beiden Veröffentlichungen die Möglichkeit, die Zeitbedingtheit der Materialethik nachzuvollziehen. Einerseits stellt dies ein Faktum einer jeden Materialethik dar, da sie immer von den Umständen ihrer Zeit abhängig ist. Andererseits erscheint es dennoch sinnvoll, dies in Erinnerung zu rufen, um absolute Ansprüche hinsichtlich der getroffenen Aussagen zu vermeiden. Ebenso wie sich die ethischen Fragen im Bereich der Familie ändern, sind auch die Antworten der Ethik immer wieder dahingehend zu prüfen, inwieweit sie angesichts stetiger Veränderungen der Lebensrealität noch tragfähig sind. Das bedeutet nicht, dass die Aussagen der Materialethik obsolet werden, sobald sich die Rahmenbedingungen verändern. Allerdings ist darauf zu achten, ob gegebenenfalls andere Argumente gefunden werden müssen, um einen Bezug zur Lebensrealität herzustellen.21 Der wichtigste Grund für die Auswahl der jeweiligen Ethik der beiden Autoren ist jedoch, dass sie paradigmatisch für zwei verschiedene Zugangsweisen zur Familie stehen: RENDTORFF thematisiert die Familie als eine Ableitung aus der Ehe von Mann und Frau und setzt sich im Zuge dessen kritisch mit anderen partnerschaftlichen Lebensformen auseinander, sodass sich familienbezogene Fragen allen voran aus der Beurteilung der verschiedenen partnerschaftlichen Lebensformen speisen. Demgegenüber stehen Familie und Ehe zwar auch bei HÄRLE in einem Zusammenhang, doch ist dieser im Gegensatz zu RENDTORFFS Bestimmung nicht durch Exklusivität gekennzeichnet. Stattdessen sind Familie und Ehe in den umfassenderen Themenkomplex der Lebensformen eingebettet. Da nach Auffassung HÄRLES sowohl der Familien- als auch der Ehe-Begriff samt damit zusammenhängender Fragen, verglichen mit anderen Lebensformen, besonders strittig sind, thematisiert er Familie und Ehe eigens.22 Allerdings stehen Lebensformen im Allgemeinen und dementsprechend auch Familie und Ehe nicht für sich, sondern in Verbindung mit Sexualität und Liebe. Das hat für die materialethischen Ausführungen zu Familie und Ehe zur Folge, dass sie eine Dimension dieser Trias neben anderen sind. Dies fällt vor allem im Vergleich mit RENDTORFF auf, der anhand der Ehe, und somit auch der Familie, seine gesamten theoretischen Grundlegungen hinsichtlich ihrer Konsequenzen für die Lebensführung des Einzelnen entfaltet. Die Darstellung und kritische Reflexion der materialethischen Aussagen RENDTORFFS und HÄRLES bildet einen Schwerpunkt bei der Auseinandersetzung mit ihren ethischen Ansätzen. Diesem Arbeitsschritt geht jedoch eine Beschäftigung mit den theoretischen Grundlegungen voraus. Dabei ist der Gedanke leitend, dass die materialethischen Aussagen durch die theoretischen Grundlagen vorbereitet werden. Um die Aussagen zur Familie in den Kontext der jeweiligen Ethik einordnen zu können, erfolgt eine Darstellung der zugrunde liegenden ethischen Theorie. Allerdings ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass die jeweiligen Erkenntnisse daraus unmittelbar auf die Materialethik übertragen werden. Stattdessen zeigt sich zuweilen eine Diskrepanz zwischen beiden Teilgebieten der Ethik, was anhand der möglichen Schlussfolgerungen auf der Basis der theoretischen Grundlagen hinsichtlich der konkreten Lebensform der Familie sichtbar wird. Diese bilden einen Zwischenschritt, der die vielfältigen Implikationen der ethischen Theorie für die Materialethik verdeutlichen soll. Allerdings wird er in dieser Form weder von RENDTORFF noch von HÄRLE getätigt. Sowohl die Thesen dieses Zwischenschritts als auch die zusammenfassenden Thesen, die an die jeweiligen materialethischen Aussagen angeschlossen sind, fließen in die abschließenden Überlegungen ein.
Den Abschluss dieser Arbeit stellt die Grundlegung einer ethischen Kriteriologie dar. Mit ihr ist das Anliegen verbunden, den Perspektivenwechsel hin zu einer wachsenden Eigenständigkeit der Familie im materialethischen Themenkanon fortzuführen. Es handelt sich dabei nicht um einen eigenen ethischen Ansatz, sondern vielmehr um eine Grundlegung, an die weiterreichende Überlegungen angeschlossen werden können. Zwar stellen Kriterien kein Novum in der christlichen Ethik dar, aber bislang sind sie vor allem im partnerschaftstheoretischen Kontext bekannt. Die Ausweitung der ethischen Kriterien auf familiale Lebensformen hat zum einen zur Folge, dass das Hauptaugenmerk auf der Gestaltung des Lebens innerhalb der Familie liegt. Obwohl eine Definition der Familie vonnöten ist, um den Bezugsgegenstand der Kriterien zu bestimmen, bildet diese keine Basis für die ethische Beurteilung einer Familie. Dementsprechend sind sie auf die vielfältigen Lebensformen anwendbar, ohne diese aufgrund ihrer Form vorzuverurteilen. Zum anderen stellen Kriterien auch auf sprachlicher Ebene einen Gewinn dar, da ihre allgemein gehaltene Formulierung genügend Spielraum für die zahlreichen Facetten familialen Lebens bietet. Auf diese Weise tragen sie sowohl der Vielfalt familialer Formen als auch jener der Gestaltungsmöglichkeiten Rechnung.
Mittels der entwickelten ethischen Kriterien wird schließlich auch ein Bezug zur Bibel hergestellt, da sie aus dem biblischen Doppelgebot der Liebe abgeleitet werden und zugleich zu dessen Veranschaulichung dienen. Die Frage, ob und wie die Bibel in der christlichen Ethik zur Anwendung kommt, führt mitten hinein in eine Kontroverse, die hinsichtlich der Leidenschaft, mit der sie geführt wird, den Debatten um das vermeintlich richtige Bild von Familie in nichts nachsteht. Aus der Perspektive der einen finden biblische Einzelaussagen über die Familie, genauer über die der Familie zugrunde liegende Ehe von Mann und Frau, nicht ausreichend Beachtung im ethischen Diskurs. Im Zentrum der Kritik steht dabei vor allem der Umgang mit den biblischen Aussagen zur Homosexualität und zum Zusammenhang von Ehe und Sexualität. Aus der Perspektive der anderen ist bei jedem Rückgriff auf Einzelnormen der Bibel deren kulturelle Prägung kritisch zu berücksichtigen. Stattdessen sei vielmehr die Liebe, wie sie in der neutestamentlichen Verkündigung im Zentrum steht, das zentrale Motiv christlicher Ethik. Während auf der einen Seite das Leben der Menschen in einer schier unüberschaubaren Anzahl biblisch begründeter Normen zu ersticken droht, läuft man auf der anderen Seite Gefahr, dass beinahe alles erlaubt ist, weil mit Verweis auf die Liebe viel legitimiert werden kann. Dass diese beiden Möglichkeiten, einseitig auf die Bibel in der Ethik zurückzugreifen, keinen sinnvollerweise zu folgenden Weg darstellen, liegt auf der Hand. Bei Ersterem droht der Blick für die Komplexität des Lebens verloren zu gehen, zu der auch zählt, dass in der Bibel nicht unmittelbar alle Antworten auf Fragen der Lebensführung gefunden werden können. Bei der Alternative wird wiederum außer Acht gelassen, dass die individuelle Freiheit Grenzen kennt und die Liebe um des anderen willen auch Begrenzungen der eigenen Möglichkeiten bereithält. Ein Konsens bezüglich der Realisierung des Schriftbezugs christlicher Ethik ist nicht in Sicht und kann auch im Rahmen dieser Arbeit nicht hergestellt werden. Dass Kriterien in der Ethik zur Anwendung kommen sollen, weist jedoch bereits darauf hin, dass keine Einzelnormen im Zentrum der Ethik stehen. Dies liegt aufgrund ihrer Vielzahl nahe, mit der zuweilen auch eine Widersprüchlichkeit einhergeht, die nicht in Eindeutigkeit aufgelöst werden kann. Stattdessen stellt das Doppelgebot der Liebe die Basis der ethischen Kriterien dar, wobei die sich daraus ergebenden Begrenzungen und Vermittlungen betont werden, die sich aus der Liebe zu Gott, den Mitmenschen und einem selbst ergeben. Auf diese Weise soll einer ethischen Haltung, dass alles erlaubt sei, Einhalt geboten werden.23
Folgendes ist hinsichtlich Anliegen, Aufbau und Methode der Arbeit festzuhalten: Die Arbeit widmet sich der Frage, welche grundlegenden Zugänge zur Familie aus ethischer Perspektive gewählt werden können, um die Familie als ein eigenständiges Thema der Ethik zu etablieren. Kapitel zu rechtlichen und soziologischen Perspektiven auf die Familie dienen der Kontextualisierung. Damit soll zum einen vermieden werden, dass die Lebenswirklichkeit von Familien so wahrgenommen wird, wie es der eigenen Perspektive und Prägung entspricht. Zum anderen soll ein breit gefächertes Bild der gegenwärtigen Situation von Familien gezeichnet werden, da ethische Konflikte in der Lebensrealität entstehen. Die kritische Auseinandersetzung mit den ethischen Ansätzen RENDTORFFS und HÄRLES stellt zwei paradigmatische Zugangsweisen zur Familie in der christlichen Ethik dar. Die Entfaltung ethischer Kriterien bildet den Abschluss und ist der Versuch, einen Zugang zur Familie zu ermöglichen, der den Schwerpunkt auf die Gestaltung des zugrunde liegenden Beziehungsgeschehens legt. So soll das eingangs erwähnte einseitige Abarbeiten an Familienformen vermieden und die Gleichgültigkeit gegenüber den eigentlichen, alltäglichen Herausforderungen von Familien durchbrochen werden.