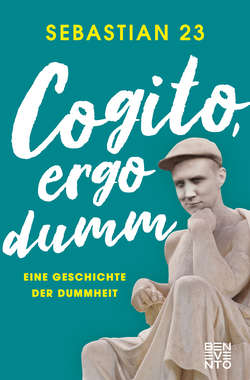Читать книгу Cogito, ergo dumm - Sebastian 23 - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Unwissenschaft und Technik
Оглавление»Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius null – und das nennen sie ihren Standpunkt.«
Mag sein, dass man es nicht jedem Menschen sofort anmerkt, aber auch das Wissen der Menschheit entwickelt sich ständig weiter. Das Begreifen der Welt und die Nutzbarmachung ihrer Ressourcen gehen dabei Hand in Hand. Und an der dritten Hand geht die Dummheit. Denn Wissenserweiterung geschieht immer auch durch Überschreitung des bestehenden Konsenses. Der erste Affe, der ein Werkzeug eingesetzt hat, war umgeben von Affen, die vermutlich dachten: Der Typ spinnt!
Bevor der erste Affe erfolgreich einen Stein als Werkzeug einsetzte, um eine Nuss zu knacken, haben es vermutlich Hunderte andere Affen mit einer Banane oder einem Blatt versucht. Darum finde ich es auch so bedenklich, dass mittlerweile viele technische Neuerungen die Dummheit der Nutzer*innen miteinberechnen und von vornherein »fail safe« konstruiert sind. Wir haben schließlich gute Gründe, die Bedienungsanleitung nicht zu lesen, denn Fehler sind eben notwendige Schritte auf dem Weg zum richtigen Weg. Und nein, es ist kein Zufall, dass sich im letzten Satz ein Stilfehler befindet. Und wenn Sie jemanden sehen, der im Stadtpark mit einer Banane auf eine Kokosnuss einprügelt, seien Sie versichert: Er bringt das Wissen der Menschheit voran. Vielleicht nicht ganz so sehr wie Roger Bacon, aber immerhin.
Roger Bacon war ein mittelalterlicher Visionär und Erfinder, er lebte im 13. Jahrhundert und ersann Erfindungen wie das Mikroskop, das Teleskop, fliegende Maschinen und Dampfschiffe. Ja, Sie haben richtig gelesen, diese Dinge wurden im 13. Jahrhundert erfunden, während der Großteil der Menschheit noch damit beschäftigt war, Pest und Kreuzzüge terminlich zu koordinieren und sich nackte Hühner auf den Kopf zu setzen. Natürlich konnte Roger Bacon die meisten seiner Erfindungen technisch nicht umsetzen. Allerdings gilt er vielen als Erfinder der Brille. Falls Sie das hier lesen können, liegt das also eventuell an ihm. Falls Sie das hier nicht lesen können, GEHEN SIE ZUM AUGENARZT!
Am Rande bemerkt: Roger Bacon war bei der Erfindung der Brille inspiriert durch den im heutigen Irak geborenen Wissenschaftler Alhazen, der als Erfinder der Lupe gilt und ein weiteres exzellentes Beispiel dafür ist, wie antikes europäisches Wissen im arabischen Raum erhalten und weiterentwickelt wurde, während man hierzulande im Hochmittelalter beinahe alles vergessen, verdrängt und verbrannt hatte, was nicht der Lehre der katholischen Kirche und der damals schwer angesagten Philosophie der Scholastik entsprach.
Die Scholastik war sehr theoretisch und versuchte als Weiterentwicklung der aristotelischen Logik, Probleme zu lösen. Das hatte nur ganz am Rande mit der Welt zu tun, sondern war sehr, sehr kopflastig. Ein scholastischer Denker wie Thomas von Aquin klang in etwa so: »Ich würde nicht ewig leben, weil wir nicht ewig leben sollten, weil, wenn wir ewig leben sollten, dann würden wir ewig leben, aber wir können nicht ewig leben, weshalb ich auch nicht ewig leben würde.« Gut, okay, ich gebe zu, das ist tatsächlich nicht von Thomas von Aquin, sondern in Wahrheit ein wörtliches Zitat einer Bewerberin um den Titel der Miss Alabama 1994, kam also gut 700 Jahre zu spät. Aber viele scholastische Beweisführungen klangen nicht weniger verworren und verkopft. Der echte Thomas von Aquin war beispielsweise überzeugt, dass die Welt nicht notwendig existiere, aber dass Dinge, die nicht notwendig existieren, nicht aus sich selbst heraus existieren können, sondern nur aus einem notwendigen Wesen heraus geschaffen sein können, und dieses notwendige Wesen sei eben Gott. Das muss man jetzt nicht notwendig verstehen, aber es klingt lecker logisch.
Roger Bacon war ein früher Vertreter der Versuche der Überwindung dieses rein theoretischen Denkens und er war einer der wichtigsten Vordenker der empirischen Methode, also der Überprüfung von Hypothesen durch Versuche. Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man Roger Bacon eine gewisse Wichtigkeit für die Wissenschaft zugesteht. Denn natürlich war sein Konzept der Erfahrungswissenschaft ein Vorgriff auf unser heutiges Verständnis, und inzwischen haben wir deshalb sogar die technischen Möglichkeiten, sämtliche seiner Visionen Realität werden zu lassen. Sogar den Ornithopter, also ein Flugzeug, dass per Flügelschlag fliegt. Das gibt es heute allerdings nur als Kinderspielzeug aus Holz, Papier und Gummi.
Doch vor 700 Jahren sah man das weniger spielerisch. Wenn man seiner Zeit so weit voraus ist wie Roger Bacon, dann reagieren die Zeitgenossen darauf erst mal skeptisch. Denken Sie an den ersten Affen, der einen Stein statt einer Banane nutzte, um eine Kokosnuss zu knacken. Nicht weniger problematisch wurde es dadurch, dass Roger Bacon recht genervt von seinen Mitmenschen war und deren mangelnder Bereitschaft, ihm Glauben zu schenken. Er hatte eine gewisse Neigung zur schroffen Kritik und das, was man heute wohl ein loses Mundwerk nennen würde. Man kann das vielleicht aus heutiger Sicht nachvollziehbar finden, aber damals machte es ihn sehr unbeliebt. So stellte man ihn früh unter strenge Beobachtung, entzog ihm seine Lehrerlaubnis und steckte ihn schließlich 1278 sogar ins Gefängnis. Vielleicht hätte Bacon, statt schroff zu sein, mal ganz sanft auf das allererste schriftlich fixierte vergleichende Experiment zur Überprüfung einer Hypothese hinweisen sollen. Das hätte den christlichen Scholastikern womöglich gefallen, denn es steht in der Bibel, genauer gesagt bei Daniel 1,1.
Die Geschichte spielt im 7. Jahrhundert vor Christus in Israel, nachdem Nebukadnezar Jerusalem erobert hatte. Daniel wurde zu Hofe geladen, doch erbat sich die Erlaubnis für sich und seine Leute, statt des Weines und der Speisen des Königs nur Gemüse und Wasser zu sich zu nehmen. Das erschien den Leuten am Hof zunächst sehr abwegig, aber man einigte sich auf ein zehntägiges Experiment mit zwei Kontrollgruppen – Daniel und seine Leute auf der einen, der Rest des Hofes auf der anderen Seite. Am Ende sahen Daniel und seine Leute gesünder aus als alle anderen am Hofe. Also erlaubte man ihnen weiterhin den Verzehr von Gemüse.
Bacon hingegen machte man 2000 Jahre später mundtot. Seine Lehren und Ideen konnte er so nicht weitergeben und geriet zunächst in Vergessenheit. Das ist dann wohl der Unterschied zwischen Bacon und Gemüse. Nur weil seine Schriften und Erfindungen erhalten blieben und später wiederentdeckt wurden, wissen wir heute noch von ihm. Was wir nicht wissen ist jedoch, wie viele Denkerinnen und Denker uns entgingen und entgehen, weil Wissenschaft, Kunst, Meinung und Rede nicht frei waren und an vielen Orten bis heute unfrei sind. Oder es eben einfach Frauen waren, die etwas Entscheidendes erforschten oder eine grandiose Idee hatten. Es kann einem ein kalter Schauer den Rücken runterlaufen, wenn man darüber nachdenkt.
Greifen wir noch einmal kurz den Aspekt auf, dass Roger Bacon bei seiner Arbeit an optischen Linsen und der Brille auf die Studien eines Wissenschaftlers namens Alhazen aus dem heutigen Irak zurückgriff. Heutzutage scheint es in gewissen Kreisen in Mode zu sein, die muslimischen Länder des Nahen Ostens in erster Linie als Quelle vieler Probleme dieser Welt abzustempeln. Als Hort der Wissenschaft und des freien Denkens, der die führenden Köpfe Europas beeinflusste, kennt man ihn eher nicht. Manche sehen gar ganz generell durch Einflüsse aus dem Ausland ihre einheimische Kultur bedroht. So heißt es im AfD-Programm von 2016 unter Punkt 7.2, »Deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus«: »Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur deutschen Leitkultur, die sich im Wesentlichen aus drei Quellen speist: erstens der religiösen Überlieferung des Christentums, zweitens der wissenschaftlich-humanistischen Tradition, deren antike Wurzeln in Renaissance und Aufklärung erneuert wurden, und drittens dem römischen Recht, auf dem unser Rechtsstaat fußt.«
Im weiteren Verlauf wendet sich das Programm explizit gegen kulturelle Einflüsse von außen, und wer in den letzten Jahren der AfD zugehört hat, der kann erahnen, dass damit insbesondere die Kultur der islamischen Länder des Nahen Ostens gemeint ist. Was die Frage aufwirft, wie diese wissenschaftlich-humanistische Tradition, auf dem die sogenannte »deutsche Leitkultur« basieren soll, denn jetzt genau mit dem kulturellen Einfluss aus dem Nahen Osten zusammenhängt.
Nehmen wir Sokrates, Platon und Aristoteles, diese altgriechische Boygroup, die wenige Jahrhunderte vor Christi Geburt im antiken Athen für Aufsehen sorgte. Allerdings nicht mit ihren flotten Dancemoves, sondern mit ihrer Philosophie. Ein moderner Beleg für die Relevanz von Philosophie findet sich im Internet, genauer gesagt auf Wikipedia. Aber nicht in einem Beitrag, sondern in (fast) allen. Die Artikel dort sind ja mit verlinkten Schlagwörtern versehen. Wenn man nun bei einem Artikel auf den ersten Link im Text klickt, landet man beim nächsten Artikel. Und wenn man dort wieder wahllos auf den ersten Link klickt, geht es weiter. So hüpft man von Artikel zu Artikel – bis wohin? Nun, in 97 Prozent der Fälle landet man am Ende beim Artikel über Philosophie. Kein Wunder, dass man bis heute die Hits der Boygroup der Philosophie kennt.
Wobei man dazusagen muss, dass bis ins 12. Jahrhundert in Mitteleuropa nur ein einziges Werk Platons bekannt war, der Timaios. Und das ist, wenn ich meine Privatmeinung mal einstreuen darf, nicht sein bestes Buch. Auch von Aristoteles wusste man im Mittelalter wenig, nur zwei logische Schriften waren überliefert und ins Lateinische übersetzt worden, das damals die Sprache der Wissenschaft war. Über Sokrates war so gut wie nichts bekannt.
Moment mal, die drei größten Philosophen des Abendlandes waren in diesem Abendland fast in Vergessenheit geraten? Aber wie wissen wir dann heute von ihnen? Nun, liebe Leser*innen, gut, dass Sie fragen, ich will es Ihnen verraten: Unter dem abbasidischen Kalif Al-Mansur wurden Mitte des 8. Jahrhunderts erstmals Bücher aus einer fremden Sprache ins Arabische übersetzt, darunter viele altgriechische Bücher von Aristoteles. Seine Nachfolger Kalif al-Mahdi und Kalif Harun al-Raschid folgten seinem Beispiel, bis ein Großteil des Werkes von Aristoteles übersetzt war und, nebenher bemerkt, unter anderem auch Euklids Elemente, ein zentrales Werk der Mathematik. Hunain ibn Ishaq war es dann, der im 9. Jahrhundert Platons Werke ins Arabische übersetzte. Diese Menschen sind der Grund, warum diese tragenden Säulen der westlichen Kultur bis heute erhalten sind. Denn erst ab dem 12. Jahrhundert kamen westliche Denker wie Adelard von Bath und Gerhard von Cremona darauf, all diese Schriften aus dem Arabischen ins Lateinische zu übersetzen und sie so nach Europa »zurückzubringen«. Etwa zur selben Zeit entstanden in Europa die ersten Universitäten, die erste in Bologna im Jahr 1088. An den Universitäten begeisterte man sich insbesondere für Aristoteles, denn er erfand nicht nur Worte wie Ethik und Energie, sondern angeblich auch das Wort Problem. Damit hatte er der Menschheit quasi alle ihre Probleme gebracht, zumindest wusste man vorher nicht, dass man welche hatte. Und wir alle wissen: Menschen lieben Probleme.
Nicht zuletzt deshalb gab es natürlich sofort Stress mit der Kirche. Aristoteles’ Lehre von der Ewigkeit des Universums widersprach der Idee der Schöpfung durch Gott. Zudem es bei Aristoteles ausführlich um Ursache und Wirkung geht und die Sorge der Kirche war, dass zwischen Ursache und Wirkung kein Platz mehr sei für ein Eingreifen Gottes. Außerdem, wenn alles durch Ursache und Wirkung erklärt werden könne, was würde denn dann nur aus all den Wundern? Und so wurde 1210 die aristotelische Naturphilosophie an der Universität von Paris vom dortigen bischöflichen Konzil verboten. Das Verbot wurde 1231 von Papst Gregor IX., genannt der Wurstfingerpapst, bestätigt. Okay, das mit dem Wurstfingerpapst habe ich mir möglicherweise nur ausgedacht, weil ich gerade beim Schreiben sauer auf den Mann geworden bin. Geholfen haben seine finsteren Umtriebe dann zum Glück nicht mehr, nur 25 Jahre später waren all die Bücher wieder in der Bibliothek der Universität zu finden. Auf einigen steinigen Umwegen haben Aristoteles, Platon und Sokrates also ihren Weg nach Europa und bis ins heutige Deutschland gefunden.
Man kann allein anhand dieses einen Beispiels leicht sehen, dass die sogenannte »deutsche Leitkultur« ein Widerspruch in sich ist. Denn ihre zentralen Inhalte basieren zu großen Teilen auf kulturellem Einfluss von außen, der sich hier gegen sehr deutlichen anfänglichen Widerstand der Einheimischen durchgesetzt hat. Damals war es in erster Linie die Kirche, heute sind es selbst ernannte Patrioten, die verhindern wollen, dass sich die menschliche Kultur wie eh und je über alle Landesgrenzen hinaus in bunter und freier Art mischt und gegenseitig bereichert. Selbst wenn es stimmen würde, dass wir ohne Aristoteles keine Probleme hätten.
Natürlich kriegen es aber seit jeher weder Kirche noch Patrioten hin, zu verhindern, dass die Menschen sich kreuz und quer über den Globus bewegen und sich im Zweifelsfall nur eingeschränkt für Grenzen interessieren. Das gilt auch und insbesondere für die Geschichte der »Entdeckung« der Welt. Kennen Sie zum Beispiel Gunnbjörn Úlfsson und Giovanni Caboto?
Eine sehr beliebte Dummheit ist die Annahme, Kolumbus habe Amerika entdeckt. Daran ist so ziemlich alles falsch. Natürlich war Kolumbus nicht der erste Mensch auf dem amerikanischen Kontinent. Er war nicht mal der erste Europäer. Tatsächlich gab es vorher Menschen, die Amerika entdeckt haben; das geschah aber vor etwa 12 000 bis 15 000 Jahren, genauer weiß man es nicht, weil sie es damals nicht direkt auf Facebook gepostet haben. Der erste Europäer, der erwiesenermaßen um 875 auf Grönland landete und damit geografisch betrachtet auf amerikanischem Boden, hieß Gunnbjörn Úlfsson. Es ist ungewiss, ob Úlfsson auch auf dem amerikanischen Festland landete. Der erste Europäer, von dem das als gesichert gilt, war Leif Eriksson um das Jahr 1000. Das geschah also entspannte 500 Jahre vor Giovanni Caboto, der als erster Europäer der Neuzeit am 24. Juni 1497 das amerikanische Festland betrat. Richtig gelesen, es war Giovanni Caboto, nicht Kolumbus.
Es ist nämlich so, dass Kolumbus überhaupt nie auf dem amerikanischen Festland ankam, seine »Entdeckung« war erst mal am 12. Oktober 1492 die Inselgruppe der Bahamas. Dass da bereits Menschen waren, störte ihn kaum; er ging auch nicht davon aus, einen neuen Kontinent entdeckt zu haben, sondern war schlicht und ergreifend überzeugt, in Indien gelandet zu sein. Daher nannte er die Leute, die ihn und seine Mannschaft am Strand empfingen, auch Indianer. Dass er überhaupt erst losgefahren war, um in westlicher Richtung einen Weg nach Indien zu suchen, und glaubte, es an jenem Tag erreicht zu haben, lag daran, dass er sich grob verschätzt hatte, was den vermeintlichen Erdumfang anging. Um 7600 Meilen, um genau zu sein.
Amerika ist übrigens nicht nach Kolumbus benannt, wie den Fuchsigeren unter den Leser*innen schon aufgefallen sein wird. Das liegt eben daran, dass Kolumbus auch bei seinen späteren Expeditionen nie geblickt hat, dass er einen »neuen« Kontinent gefunden hatte. Bis zu seinem Tod stritt er diesbezügliche Vermutungen vehement ab. Das galt übrigens auch für Giovanni Caboto, der bei seiner zweiten Mission Richtung Westen extra einen Brief an den »König von China« mitgenommen hatte. Falls er jedoch diesen Brief dem Häuptling der Apachen überreicht hat, dürfte das allseits für milde Verwunderung gesorgt haben.
So ging der Ruhm der Benennung des Kontinents an den ansonsten etwas weniger berühmten Seefahrer und Entdecker Amerigo Vespucci. Denn dieser hatte eben die richtige Vermutung, dass es sich nicht um Asien handelte, sondern einen gänzlich anderen Kontinent. Wie hat er das geschafft? Nun, ihm war aufgefallen, dass Flora und Fauna des Landes ziemlich eigentümlich waren und so gar nicht mit dem übereinstimmten, was man über Indien wusste. Vielleicht hat ihm auch der Häuptling der Apachen heimlich verraten, dass er doch nicht der König von China ist. Bewiesen wurde die These, es handele sich bei Amerika um einen eigenen Kontinent, allerdings auch erst nach Vespuccis Tod durch den spanischen Konquistador Vasco Núñez de Balboa, der von der Ostküste Panamas aus den Pazifischen Ozean erreichte. Es ging also Richtung Westen weiter – Kolumbus hatte nicht mal den halben Weg zurückgelegt, den er sich eigentlich vorgenommen hatte.
Nun ist es allerdings so, dass mit den Entdeckungsreisen des Kolumbus die Erforschung und Besiedlung Amerikas durch die Europäer ihren Anfang nahm, leider einhergehend mit dem Tod eines Großteils der Ureinwohner, weswegen es sich natürlich trotzdem um einen Wendepunkt der Weltgeschichte handelt. Auch oder gerade weil es sich dabei um eine fortgeschrittene und umfassende Dummheit handelte. Ich will nicht bestreiten, dass Kolumbus von einem gewissen Entdeckergeist angetrieben war, immerhin nahm er hohe Risiken auf sich und wagte etwas für ihn und seine Zeitgenossen völlig Neues. Ähnliches wird auch für den berühmten Admiral Zheng He gegolten haben, der mit seinen Expeditionen zwischen 1405 und 1433 die Einflusssphäre des chinesischen Kaiserreichs stark erweiterte. Er war mit bis zu hundert Schiffen und fast 30 000 Mann Besatzung unterwegs und kam unter anderem bis nach Arabien und Ostafrika. Nach seinem Tod jedoch beschloss der Thron, solche Expeditionen einzustellen. Sie erbrachten finanzielle Defizite, und die von Zheng He herbeigebrachte Giraffe war gewiss interessant, aber sie legte leider keine Eier aus Gold, und man wollte seine Ressourcen nicht länger in der Ferne verpulvern.
Zur selben Zeit, im Jahr 1434, also nur wenige Jahrzehnte vor Kolumbus, wagte es der portugiesische Seefahrer Gil Eanes am südmarokkanischen Kap Bojador vorbei zu segeln. Das war eine im europäischen Mittelalter eigentlich unvorstellbare Leistung, denn man vermutete, jenseits des Kaps würde die See zu brodeln beginnen und alles Leben ausgelöscht. Daher trägt es auch den Namen Kap der Angst. Und dieser Name wirkte gründlich, denn die Expedition von Gil Eanes war bereits der fünfzehnte Versuch der Portugiesen binnen zwölf Jahren. Doch die Angst vor diesem Ende der Welt trieb alle anderen Kapitäne wieder in Richtung Heimat. Gil Eanes’ Mut war jedoch der erste Schritt für die Entdeckung der Seeroute ostwärts nach Indien und damit ein zentraler Grundstein für die europäische Expansion. Über die Frage, ob die Europäer es nicht besser gemacht hätten wie die Chinesen und »zu Hause geblieben« wären, ist es müßig zu streiten. Aber der Welt wäre viel Leid erspart geblieben.
In der frühen Neuzeit stellte sich nicht nur heraus, dass die Erde eine Kugel war, sondern auch ihre Position im Universum wurde im wahrsten Wortsinn verrückt. Es war der 21. Juni 1633, als Galileo Galilei öffentlich bekannte, dass er nicht mehr daran glaube, die Erde drehe sich um die Sonne, wie Kopernikus sagte. Er sagte, das sei alles ein grobes Missverständnis, er habe sich vertan, dies, das, die katholische Kirche habe selbstverständlich recht und man könne den Scheiterhaufen jetzt wieder ausmachen. Natürlich stehe die Erde still und die Sonne umkreise sie. Die Welt sei der Mittelpunkt der Welt und der Papst habe den schönsten roten Hut mit Goldkante. Wegen dieses Zugeständnisses verurteilte man Galileo »nur« zu lebenslangem Hausarrest. Womit man gewiss nicht die Erde zum Stillstand brachte, aber immerhin einen genialen Denker und Künstler.
Wir haben natürlich im Nachhinein immer leicht reden. Für die Menschen ihrer Zeit müssen Roger Bacon, Kopernikus und Galilei gewirkt haben wie Verrückte, denn ihre Ideen waren komplett anders als alles, was alle anderen sagten. Und anders als im heutigen Wissenschaftsbetrieb war es eben keinesfalls üblich, den gängigen Lehrmeinungen auch mal zu widersprechen und neue Lösungen für Probleme zu suchen. Erst Jahre, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später wurde dem Großteil der Menschheit klar, was da jeweils passiert ist. Und plötzlich wurden die gerade noch verrückten Ideen außerordentlich wertvoll. »Wir wissen, dass es die Natur des Genies ist, Idioten zwanzig Jahre später mit Ideen zu versorgen«, hat Louis Aragon dazu einmal geschrieben.
Aber glauben Sie nicht, dass es heute keine Zweifler am kopernikanischen Weltbild gibt, denn die gibt es reichlich. Und da kursieren noch ganz andere Weltbilder. Im Internet sehr beliebt sind die sogenannten Flat-Earther. Wenn man diese nicht kennt, ist man vermutlich überrascht, dass es sie gibt. Denn das sind Leute, die fest überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Für Flat-Earther spielt es keine Rolle, dass sich die Erdrotation mittlerweile experimentell nachweisen lässt, etwa mit einem foucaultschen Pendel. Oder, crazy genug, dass man einen gekrümmten Horizont sieht, wenn man aus einem Flugzeugfenster schaut oder gar aus dem Weltraum auf die Erde hinabblickt. Mittlerweile wissen wir im Gegensatz zu den mittelalterlichen Westeuropäern, dass die Erde nicht hinter dem Kap der Angst endet. Das alles jedoch bringt einen Flat-Earther nicht aus der Ruhe.
In einem der bekanntesten Filmbeiträge über Flat-Earther sieht man den Wissenschaftler Jeran Campanella, der seine These, die Erde sei eine Scheibe, mit einem einfachen Experiment beweisen will. Er stellt in einer Entfernung einen Laser auf und einen Empfänger, bei dem der Laserstrahl ankommen soll, wenn denn die Erde eine Scheibe ist. Der Gedanke dahinter ist, dass der Laserstrahl ja ganz gerade fliegt und daher in einer Ebene immer gleichweit vom Boden entfernt unterwegs sein müsste. Bis zum Ende der Welt. Und darüber hinaus.
Das Experiment verlief jedoch anders, als Campanella erwartet hat – der Laser verfehlte sein Ziel. Kein Grund für den selbst ernannten Wissenschaftler, nun aufzugeben und einzugestehen, dass seine Theorie von der Scheibenform der Erde falsch war. Obwohl er in Gegenwart eines Kamerateams den Beweis dagegen erbracht hatte. Nein, nun erklärte er plötzlich, es habe sich um einen Messfehler gehandelt. Dieses Phänomen nennt man kognitive Dissonanz, wir werden im Kapitel Aber: Glaube noch ausführlich darauf zu sprechen kommen. Erstaunlicherweise gibt übrigens immer noch Menschen, die finden, dass dieses Resultat und Campanellas Aussagen dazu zu seiner Glaubwürdigkeit beitragen. Uff.
Doch nicht nur in der Geografie, auch in der Biologie dauert es manchmal etwas länger, bis sich neue Erkenntnisse flächendeckend durchgesetzt haben. So erklärt Herman Melville in seinem berühmten Buch Moby-Dick äußerst ausführlich, warum Wale Fische sind. Seine Erläuterungen schrieb er jedoch rund hundert Jahre, nachdem Wale als Säugetiere eingestuft wurden. Fairerweise muss man sagen, dass manche Wale auf den ersten Blick eine gewisse Ähnlichkeit mit Fischen aufweisen, das kann man schon mal falsch zuordnen. Ich persönlich halte zum Beispiel bis heute Gras für die Haare der Erde und Hügel für die Ponys der Berge.
Jemand, der sich mit Tierarten noch etwas besser auskannte als Melville und ich, war Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck. Er lebte von 1744 bis 1829 und verbrachte geschätzte 50 Prozent seiner Lebenszeit damit, sich mit seinem Namen vorzustellen. Die restliche Zeit nutzte er noch besser, denn er verfasste enorm wichtige Beiträge zur Zoologie und Biologie. So war er beispielsweise der Erste, der eine ausformulierte Evolutionstheorie vorlegte. Was spielt es da groß für eine Rolle, dass diese auf mittlerweile verworfenen Annahmen beruhte?
Lamarck ging davon aus, dass die Evolution auf der Vererbung von erworbenen Fähigkeiten beruht. Überspitzt formuliert: Wenn eine Giraffe sich besonders lang streckt und ihr Hals dadurch über die Jahre länger wird, dann kriegt sie auch Kinder mit längerem Hals. Bevor Sie jetzt anfangen, an Ihrem Hals zu zuppeln oder andere Körperteile zurechtzuformen, die Sie bei Ihren Nachkommen verbessert sehen wollen: Ganz so einfach funktioniert das leider nicht. Charles Darwin, der alte Spielverderber, hat herausgefunden, dass der Prozess über Variation und natürliche Selektion funktioniert. Dann ist er auch noch hingegangen und hat zwanzig Jahre lang Beweise für diese Theorie zusammengetragen. Ein bisschen unfair war das schon, denn Lamarck konnte sich nicht mehr verteidigen, er war längst tot. Und als wollten sie seinen Theorien aus einem Ödipus-Komplex heraus trotzen, ist keins seiner acht Kinder ein berühmter Biologe oder eine wichtige Zoologin geworden. Aber sein ältester Sohn war immerhin keine Giraffe.
Was in einem Buch über Dummheit nicht fehlen darf, ist eine wirklich dumme Überleitung. Wo wir gerade von Giraffen sprachen: An welches technische Gerät erinnern Sie Hals und Kopf einer Giraffe? Richtig, natürlich an den Tonabnehmer eines Grammophons. Und damit hätten wir auch den unvermeidlichen Tagesordnungspunkt »Dumme Überleitung« abgearbeitet. Das auditive Wunderwerk namens Grammophon erfand übrigens Thomas Alpha Edison im Jahr 1877, allerdings mit einem überraschenden Hintergedanken. Seine Idee für die Nutzung des Geräts war nämlich zunächst, damit Nachrichten aufzuzeichnen und zu verschicken, damit sie jemand anderswo anhören könnte. Dazu brauchte der oder die Absender*in vermutlich nur ein Tonstudio und ein Presswerk für Vinylscheiben, und schon hatte man eine riesige runde Scheibe, die in keinen Briefumschlag passte. Daher musste man sie persönlich beim Empfänger vorbeibringen, wo das olle Ding dann auch nicht durch den Briefschlitz passte, und dann musste man klingeln.
Und spätestens, wenn man dann voreinander stand und sich schweigend die schwarze Scheibe überreichte, dämmerte es einem vielleicht: Hier läuft ironischerweise etwas nicht rund.
Erst Jahre später kristallisierte sich heraus, dass die Nutzung dieser Technologie zur Aufzeichnung und zum Abspielen von Musik weitaus mehr Interesse hervorrief. Aus heutiger Sicht wirkt das noch ein wenig lustiger, wenn man bedenkt, dass Edison im Prinzip die Sprachnachricht vorweggenommen hatte, die aktuell dabei ist, in weiten Teilen das klassische Telefonieren abzulösen. Heute spart man sich allerdings die Auslieferung der schwarzen Scheiben, man sitzt sich halt gegenüber und schickt sich gegenseitig Sprachnachrichten aufs Smartphone.
Ebenso »aus Versehen« erfunden wurde im 19. Jahrhundert hitzebeständiges Gummi. Der Chemiker Charles Goodyear hatte seinerzeit nämlich eigentlich mit seiner Frau abgemacht, dass er nicht mehr experimentieren, sondern sich einen Job suchen würde. Als sie eines Tages zu früh nach Hause kam, geriet er in Panik und wollte seine Experimente versteckten. Er sah sich um, fand keine Möglichkeit und war wohl schon kurz davor, sich seinem Schicksal zu ergeben, als sein Blick auf den Ofen fiel. Das wird schon passen, dachte er und versteckte seine Experimente darin. Was er dabei nicht bemerkt hatte, war jedoch, dass der Ofen noch warm war, und so entdeckte er unabsichtlich hitzebeständiges Gummi.
Ähnlich erging es Christian Schönbein, der ohne Absicht rauchloses Schwarzpulver erfand. Ihm waren seine Chemikalien vom Tisch gefallen, also wischte er sie mit der Schürze seiner Frau schnell weg und hängte diese dann zum Trocknen vor den Ofen. Dort explodierte die Schürze, und Herr Schönbein wird sich erst erschreckt, dann aber doch gefreut haben. Bei anderer Gelegenheit erfand jemand beim klassischen alchemistischen Versuch, aus Blei Gold zu erzeugen, mehr oder weniger aus Versehen das Porzellan. Ob er es vor Schreck fallen ließ, ist nicht überliefert.
Trotz aller Pläne, die sich der Mensch so macht, findet unsere Kreativität scheinbar oft einen Weg, der zunächst wie eine Störung wirken mag. Aber genau dieser Fehler, dieses Stolpern, bringt unabsichtlich Tolles hervor. Dieses Phänomen ist so bekannt, dass es sogar einen eigenen Namen hat, es heißt Serendipität. Benannt ist es nach den drei Prinzen von Serendip. Sie haben noch nie von Serendip gehört? Es ist der alte persische Name der Insel Sri Lanka. Die drei besagten Prinzen sind losgezogen, um einen Drachen zu erlegen. Was Prinzen eben so machen. Es scheint ein weltweit prinzentypisches Verhalten gewesen zu sein. Heutzutage werden sie höchstens mal vor ein paar blitzlichtspeiende Paparazzi geschubst. Die drei Prinzen von Serendip jedoch kamen ohne erlegten Drachen von ihrer Mission zurück, brachten aber stattdessen drei bildhübsche Prinzessinnen mit. Eine Win-win-Situation, insbesondere auch für den Drachen. Und so nennt man ungeplante positive Ergebnisse bis heute Serendipität. Ich bin ganz froh, dass diese Prinzen aus Serendip kamen und nicht aus Deutschland. Sonst hieße dieses schöne Phänomen jetzt womöglich Deutschlandität.
Apropos Deutschland, der niederländische Serendipitiologe Pek van Andel behauptet, über tausend Fälle solcher ungeplanten Errungenschaften, die sich im Nachhinein als Glücksgriff erwiesen, gesammelt zu haben. Seine Forschungen werden von der Fachwelt leider nicht ganz so ernst genommen. Vielleicht, weil man van Andel ansonsten hauptsächlich daher kennt, dass er als erster ein MRT von Menschen während des Geschlechtsverkehrs angefertigt hat. Aber mal im Ernst: Der experimentelle Charakter der Wissenschaft fordert dazu heraus, auch und insbesondere Ergebnisse zu finden, die den Hypothesen widersprechen. Auf diesem Weg erweitert sich unser Wissen umso mehr, denn wir wissen ja schon aus dem dritten Kapitel dieses Buches: In jeder Diskussion gewinnt nur der Unterlegene, denn er ist der Einzige, der etwas dazulernen kann.
Der britische Psychologe Richard Wiseman geht davon aus, dass es unsere Einstellung und Denkweise ist, die uns dabei hilft, solche Glücksgriffe zu landen: »Durch ihre Art zu denken und zu handeln steigern manche Menschen die Chance, außerordentliche Gelegenheiten in ihrem Leben zu schaffen, zu erkennen und zu ergreifen.« Ich würde noch ein bisschen weitergehen und sagen: Man muss die Fähigkeit haben, sich richtig dumm anzustellen, um außerordentliche Gelegenheiten zu schaffen und zu ergreifen. Da haben wir alle zum Glück ziemlich gute Karten.
Doch aus Versehen oder durch Ahnungslosigkeit entsteht natürlich nicht nur Serendipität, sondern gerne auch mal eine spektakuläre Fehleinschätzung. Wer uns in diesem Punkt als leuchtendes Beispiel voranging, war Dr. Dionysius Lardner. »Eisenbahnreisen mit hoher Geschwindigkeit ist unmöglich, denn die Passagiere wären unfähig zu atmen und würden allesamt ersticken«, schrieb er zum Beispiel im Jahr 1845. Während ich dieses Zitat abtippe, befinde ich mich tatsächlich gerade im ICE zwischen Wolfsburg und Berlin. Vor den Fenstern huscht die Magdeburger Börde mit atemberaubender Geschwindigkeit vorbei. Und dennoch: Ich atme. Wunder werden Wirklichkeit.
Dionysius Lardner war ein erstaunlicher Mann, der sich in seinem Leben mehrfach spektakulär täuschte und dabei wieder und wieder von ein und demselben Mann öffentlich zurechtgewiesen wurde: Isambard Kingdom Brunel. Der Mann hatte nicht nur den einzigen cooleren Namen als Dionysius Lardner, sondern gilt bis heute als einer der besten Ingenieure aller Zeiten. Er baute zum Beispiel das größte Schiff seiner Zeit, das zugleich das erste ozeantaugliche Eisenschiff war, und er baute den ersten Tunnel unter einem navigierbaren Fließgewässer. Man kann also sagen, Isambard Kingdom Brunel hatte es drauf.
Lardner hingegen dachte, es sei unmöglich, lange Eisenbahntunnel zu bauen, weil darin die Züge unkontrolliert beschleunigen würden. Und motorisierte Schiffsreisen über 2000 Seemeilen seien ausgeschlossen, weil ein Schiff nicht genug Treib stoff mit sich führen könnte. Oder eben, dass Eisenbahnreisen über einer bestimmten Geschwindigkeit tödlich wären. Brunel widerlegte Lardners Thesen eine nach der anderen. Es ist daher davon auszugehen, dass Lardner kein führendes Mitglied im Brunel-Fanclub war. Sein Plan, sich an Brunel zu rächen, indem er ihn in einen Hochgeschwindigkeitszug setzte, scheiterte ebenfalls. Damals war der ICE noch nicht erfunden. Andererseits ist Dionysius Lardner natürlich nicht der Einzige, der sich auf rückblickend erstaunliche Art gegen den Fortschritt äußerte. Leopold Loewenfeld beschreibt in seinem Buch Über die Dummheit, wie ein Expertenkomitee der Universität München Ende des 19. Jahrhunderts befürchtete, die blitzschnellen Bewegungen der Bahn könnten bei Reisenden eine Gehirnerschütterung auslösen. Ihr Vorschlag? Auf beiden Seiten der Bahnstrecken sollten Holzwände errichtet werden. Gut, dass das der arme Lardner nicht mehr mitgekriegt hat.
Apropos Kopfschmerzen: Im Jahr 1910 wurde die FAAS gegründet, eine Gruppe namens Farmer’s Anti Automobile Society. Diese Gruppe wollte, dass alle Automobile, die nachts auf Landstraßen unterwegs waren, jede Meile anhielten, also grob gesagt alle 1,5 Kilometer. Dann sei eine kleine Leuchtrakete zu starten und zehn Minuten zu warten, bis sicher sei, dass die Straße frei ist. Dann erst sollte man weiterfahren dürfen, aber zur Sicherheit viel hupen. Noch besser wäre, wenn bei jeder Fahrt ein Mensch vorneweglaufe und zur Warnung eine rote Fahne schwenke. Sollten einem jedoch Pferde entgegenkommen, ging der Spaß erst richtig los. Dann wollte die FAAS, dass der Autofahrer sein Auto am Straßenrand parkte und unter einer Decke versteckte, die im Idealfall wie die Umgebung gefärbt sei. Sollte das Pferd das Auto trotzdem entdecken und nicht passieren wollen, sollte es die Pflicht des Autofahrers sein, das Auto zu demontieren und die Teile im Straßengraben zu verstreuen. Erst wenn das Pferd diese Aktivität freundlich abnickte und weitertrabte, dürfte man sein Auto wieder zusammensetzen und weiterfahren. Zumindest 1,5 Kilometer, dann war es Zeit für die nächste Warnrakete. Es ist historisch nicht ganz gesichert, ob dieser Gesetzesentwurf jemals in Kraft trat. Heute gilt er jedenfalls nicht mehr. Das finde ich sehr schade, denn für mich wäre das eine sehr gute Motivation, das Reiten zu lernen.
Auch in scheinbar harmloseren Kontexten gab es übrigens Widerstand gegen neue Technik. So wehrten sich viele Menschen lange gegen Anschnallgurte in Autos. Und noch heute können Sie sich sicher sein, dass viele Leute sich nur deswegen anschnallen, damit sie keine Strafe zahlen müssen. Dass sie ohne Gurt schon bei einem kleinen Unfall ihr Leben riskieren, ist den Menschen hingegen scheinbar egal. Ich habe mal einen Taxifahrer gesehen, der hatte seinen Gurt aufgeschnitten, damit er den Stecker in den Anschluss stecken konnte, ohne wirklich angeschnallt zu sein. Denn das Piepsen des Warnlichts seines Autos nervte ihn mehr als die Aussicht auf den eigenen Tod.
Wir sehen daran, mit dem technischen Fortschritt entstanden immer auch neue Möglichkeiten für Dummheit. Aber die Entwicklung hält ja nicht an, im Gegenteil, ab dem frühen 20. Jahrhundert ging alles immer noch schneller – und bald wurde neben der Erde und dem Wasser auch der Luftraum erobert. Wenn im englischsprachigen Raum etwas sehr leicht zu verstehen ist, dann verwendet man gerne die Redewendung »This isn’t rocket science«. Im Umkehrschluss bedeutet das wohl, dass Robert Goddard ein kluger Mann gewesen sein muss, denn er war tatsächlich Raketenwissenschaftler. Bekannt ist er unter anderem als Erfinder der Bazooka, einer tragbaren Panzerabwehrwaffe. Er stellte den ersten Prototyp am 6. November 1918 vor, und sofort erkannte man sein Potenzial, zumal man sich im Ersten Weltkrieg befand. Nun endete der Erste Weltkrieg jedoch exakt fünf Tage später, und damit wurde auch die Entwicklung der Bazooka nicht weiterverfolgt. Ärgerlich, wenn einem ein Kriegsende so in die Waffenentwicklerkarriere reingrätscht. Gut für alle anderen, aber was wissen die schon?
Goddard ließ sich nicht unterkriegen, sondern widmete sich anderen Projekten im Raketenbereich. Seine Vision war, eine Rakete zu entwickeln, die es bis zum Mond schaffen könnte. Dazu schuf er unter anderem als Erster ein praktikables System für Raketentests, Raketen mit flüssigem Treibstoff und er bewies, dass Raketenantriebe auch im Vakuum Schub erzeugen konnten und die Weltraumfahrt somit theoretisch möglich war. Einige Zeitgenossen sahen das eher kritisch. Am 13. Januar 1920 titelte die New York Times »Eine schwere Belastung der Leichtgläubigkeit« und warf Goddard vor, nicht mal das grundlegende Wissen eines Highschool-Schülers zu haben. Goddard war hart getroffen, aber erklärte später gegenüber einem Reporter: »Jede Vision ist ein Witz, bis der Erste sie umsetzt – und wenn sie einmal umgesetzt ist, wird sie Allgemeinwissen.« Ein halbes Jahrhundert später war der erste Mensch auf dem Mond, denn Goddards Theorien waren inzwischen tatsächlich Allgemeinwissen geworden. Erst dann, im Jahr 1969, entschuldigte sich die New York Times öffentlich bei Goddard. Dieser wäre bestimmt erfreut gewesen, allerdings war er leider schon 24 Jahre tot.
Noch weniger Fortschrittsglauben als die damalige New York Times hatte Charles Duell, ein amerikanischer Patentamtsleiter. Er schrieb: »Alles, was erfunden werden kann, ist bereits erfunden worden.« Das wäre auch heute noch eine sehr schräge Aussage. Duell äußerte sie aber schon 1899. Die Erfindung des Flugzeugs kurze Zeit später dürfte ihn also doppelt überrascht haben. Vielleicht dachte er aber auch, dass es das Flugzeug schon seit Längerem gäbe. Am Rande bemerkt: Eine ähnliche Annahme muss den 45. Präsidenten der USA, Donald Trump, dazu gebracht haben, noch 2019 zu behaupten, das amerikanischen Militär habe während des Unabhängigkeitskriegs 1775 zahlreiche englische Flughäfen erobert. Vielleicht hatte ihm niemand gesagt, dass Roger Bacon leider nicht weiterforschen durfte und es darum nicht schon seit 750 Jahren das Flugzeug gibt.
Charles Duell war übrigens in bester Gesellschaft. Der renommierte Münchener Physikprofessor Philipp von Jolly, der mithilfe einer Bleikugel die Richtigkeit der newtonschen Gravitationsgesetze experimentell nachweisen konnte, wäre ein anderes gutes Beispiel. Noch deutlich besser kennt man ihn nämlich, weil er im Jahr 1874 einem potenziellen Studenten abriet, sich der theoretischen Physik zu widmen. Denn, so der Professor, da gäbe es kaum noch etwas Neues zu entdecken.
Dieser Student, ein gewisser Max Planck, machte es wie die Bleikugel und ließ sich nicht bremsen. Diesem wissenschaftlichen Ungehorsam verdanken wir so bedeutsame Dinge wie das plancksche Strahlungsgesetz, mit dem wir zum Beispiel kalkulieren können, wie viele Sonnenstrahlen die Erdatmosphäre aufnimmt und wie viele sie wieder in den Weltraum abstrahlt. Keine ganz unwichtige Frage, wenn man beispielsweise den Klimawandel berechnen will. Und wie kam Planck auf sein Strahlungsgesetz? Nun, indem er die Pfade der traditionellen Physik verließ und Energie nicht mehr als unendlich teilbar betrachtete. Stattdessen ging er davon aus, dass Strahlung in kleinen Paketen abgegeben werde, die er Quanten nannte. Dieser Bruch mit der Tradition ist insofern ganz spannend, als niemand so genau wusste, was das bedeuten sollte. Auch Planck konnte sein Konzept angeblich nicht genau erklären. Aber seine Theorie passte mit den beobachteten Daten überein. Erst als Albert Einstein Plancks Ideen ernst nahm und auf ihrer Basis bewies, dass Lichtstrahlen auch aus solchen Energiepaketen bestehen, den sogenannten Photonen, wurde die ganze Bandbreite der Entdeckung langsam deutlich.
Die Physik der Quanten ist eine wunderbare Übung, um sich den Kopf zu zerbrechen. Dazu muss man nicht mal ihre anspruchsvolle mathematische Basis in Betracht ziehen. Es reicht, zu bedenken, dass Licht gleichzeitig ein Teilchen und eine Welle ist. Als Teilchen ist es klar im Raum zu verorten, als Welle ist es im Raum »verschmiert« – beides gleichzeitig. So läuft das eben bei den Quanten, in dem Fall bei den Photonen. Und wenn man sich dann noch kurz die sogenannte heisenbergsche Unschärferelation vor Augen führt, wird es richtig knusprig. Die besagt nämlich, dass man von einem Quantum nur den Impuls oder den Ort genau wissen kann, niemals beides. Denn Quantenobjekte sind quasi ungefähr. Wenn man versucht, sie festzulegen, zerstört man damit Teile ihrer Information. Das klingt so, als würde man sagen, dass man von einem Auto wissen kann, wo es ist oder wie schnell es ist, aber es ist völlig ausgeschlossen, jemals beides zu erfahren. Denn wenn man den Ort bestimmt, kann man das zwar, aber man verzerrt durch eben diese Beobachtung die Geschwindigkeit.
Im Jahr 1935 schlug Erwin Schrödinger in seinem Aufsatz »Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik« ein Gedankenexperiment vor, um Quantenmechanik für den Otto Normalverbraucher begreiflicher zu machen. Dazu solle man eine Katze mit einem instabilen Atomkern, einem Geigerzähler und etwas Giftgas in eine Stahlkammer sperren. Ein ganz normaler Vorgang so weit. Da nicht vorherzusagen ist, wann genau der Atomkern sein Strahlungsquant freigibt und damit einen Mechanismus auslöst, der die Katze tötet, gilt: Bis jemand in die Kammer schaut, ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Was Schrödinger hier durch Übertragung in die makroskopische Welt veranschaulicht, ist der Umstand, dass quantenmechanische Messungen keine exakten, wiederholbaren Ergebnisse liefern, sondern immer verschiedene Werte aus einem ganzen Wertebereich. Eine Vorhersage scheint ausgeschlossen, was eines der größten ungelösten Probleme der Physik darstellt. Wobei Schrödinger betont, die Sache mit der Katze sei »verwaschen« und daher könnten wir sie in naiver Weise nicht gelten lassen. Im Atombereich ist ihm die Unbestimmtheit nichts Widerspruchsvolles: »Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten oder unscharf eingestellten Fotografie und einer Aufnahme von Wolken und Nebelschwaden.« Schrödinger erhielt in der Folge – nicht nur deswegen – einen Nobelpreis für Physik und hoffentlich ein Hausverbot im Tierheim.
Ich weiß ja nicht, ob Ihr Gehirn das verstehen möchte, meins klinkt sich da regelmäßig aus und spielt bei näherer Nachfrage aus Trotz nur noch die Titelmelodie der Serie Alf. Ich schreibe hier so beiläufig über die Rätselhaftigkeit der Quantentheorie, als ginge es darum, einen hängen gebliebenen Computer aus- und wieder anzuschalten – und wenn er wieder funktioniert, braucht man nicht zu verstehen, was da vor sich ging. Aber das Fragezeichen, auf das Max Planck da stieß, hat bis heute neben zahlreichen Antworten auch immer neue Fragezeichen aufgeworfen. Teilweise, so scheint es, sind diese Fragezeichen gekommen, um zu bleiben. Die Situation prä-Planck beschreibt (der ansonsten sehr unsympathische) John Searle als Aufklärungsoptimismus, den er so erklärt: »Von den wissenschaftlichen Revolutionen des siebzehnten Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte des zwanzigsten war es einem gebildeten Menschen möglich zu glauben, er könne zu Kenntnis und Verständnis darüber gelangen, wie das Universum im Wesentlichen funktioniert.« Ab den Anfängen des 20. Jahrhunderts ging das eben nicht mehr.
Aber ich bin diesbezüglich nicht weiter verunsichert. Zwar ist Alf eine wirklich alberne Serie, aber ich mag sie, zumal Alf klare Verhältnisse hätte schaffen können, weil er Schrödingers Katze einfach gegessen hätte. Mein Unverständnis für die Welt der Quanten ist nicht überraschend, wenn man Nobelpreisträger und Quantenphysiker Richard Feynman glauben darf, der einst sagte: »Ich glaube, mit Sicherheit sagen zu können, dass niemand die Quantenmechanik versteht.« Das mag erstaunlich klingen, denn wenn es jemand wie Feynman nicht versteht, dann wohl auch niemand anderes. Sind wir alle dumm? Aber nein, haben Sie keine Sorge: »Quantenphysik ist ein extrem erfolgreicher Beweis für die Leistungsfähigkeit unseres Denkens – und dafür, dass wir unseren Alltag mit diesem Denken so gut wie nicht verstehen«, sagt dazu der Philosophieprofessor Gert Scobel. Wir sind also nicht dumm, sondern bloß so klug, dass wir es selbst nicht verstehen können. Beruhigend, oder?
Ich gebe zu, dass ich das an der Stelle der Fortschrittskritiker Charles Duell und Philipp von Jolly auch nicht hätte kommen sehen. Rückblickend lässt sich natürlich immer klug daherreden. Der sprichwörtliche Captain Hindsight hat es leicht und lacht gerne mal über die Narreteien der Vergangenheit. Denken wir nur daran, wie Bill Gates einst sagte: »Das Internet setzt sich nicht durch.« Und, kaum weniger lustig: »512 Kilobyte reichen für alle Daten eines Menschen«. 512 Kilobyte reichen nicht mal für die MP3 eines Scooter-Songs. Das ist also vielleicht ein bisschen zu klein, dieses Daten-Quantum. Zum Glück weiß man nicht so genau, wo es ist. Und wie schnell.
Eine schöne Folge hatte übrigens die Quantentheorie für Niels Bohr. Er erhielt 1922 den Nobelpreis für seine Forschungen zur Struktur von Atomen, in die er als erster Erkenntnisse aus der Quantenmechanik einbringen konnte. Heute wird das Bohrsche Atommodell von 1913 nach wie vor an Schulen unterrichtet, wenn auch nur der Einfachheit halber. Was nun aber geschah mit Niels Bohr nach seinem Gewinn? Nun, er wurde in seiner Heimat Dänemark noch mehr verehrt als zuvor, und als Zeichen der Anerkennung legte die Carlsberg-Brauerei kostenlos eine Leitung direkt in sein Haus. Ja, richtig. Für seinen Nobelpreis erhielt Bohr lebenslänglich Freibier.
Auf mich wirkt das ja fast so, als wollte man einen allzu intelligenten Forscher wie Niels Bohr ein bisschen rückverdummen. Andererseits gibt es ja durchaus die Theorie, dass ein kleiner Schwips die Kreativität anregt. George Orwell ging noch weiter und formulierte einmal, ein Vollrausch sei wie ein Kurzurlaub. Die Theorie, dass Bohr aufgrund des Freibiers geistig flexibler und kreativer blieb als seine Kollegen Einstein und Planck, halte ich jedoch für ein bisschen weit hergeholt. Obwohl, oder gerade weil sie bei mir einen mittelmilden Bierdurst auslöst.
Aber nicht nur die Leute, die gegen Technik sind, stellen sich manchmal erstaunlich dumm an. Oft genug verhält es sich genau umgekehrt, und es ist der blinde oder zumindest kurzsichtige Glaube an die Technik, der die Menschen dumme Entscheidungen treffen lässt. So kam man wohl auf die Idee, Zeppeline mit Wasserstoff zu befüllen oder die Titanic für unsinkbar zu halten. Wobei manchen Leuten offenbar auch im Rückblick noch nicht klar war, was genau mit der Titanic passiert ist. Und ich meine jetzt nicht die Leute, die sich bis heute im Internet darüber streiten, ob im gleichnamigen Kinofilm die Tür nicht doch groß genug gewesen wäre für Leonardo DiCaprio und Kate Winslet.
Ich meine den realen Untergang und einen gewissen William Smith, der damals nicht der Prince von Bel Air war, sondern als Senator den Regierungsausschuss zur Untersuchung der Titanic-Katastrophe leitete. Er sorgte damals in der Presse für einiges Aufsehen, als er öffentlich die Frage stellte: »Warum retteten sich die Passagiere nicht in den wasserdichten Teil des Schiffes, um zu überleben?« Das erinnert mich ein bisschen an mich selbst in der Schulzeit, wenn ich mal wieder die Lektüre nicht gelesen hatte und versuchte, meine komplette Ahnungslosigkeit durch kreative Fragen zu überspielen. Allerdings mit dem Unterschied, dass ich auch als pubertärer Faulpelz schon wusste, wie ein Schiff funktioniert.
William Smith blieb lange das spektakulärste Beispiel dafür, wie man Regierungsausschüsse leiten kann, ohne die Spur einer Ahnung zu haben. Mindestens bis im April 2018 ein ebensolcher Ausschuss den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg befragte und es sich in weiten Teilen so anhörte, als würde Zuckerberg den Mitgliedern des Ausschusses erst mal das Internet erklären müssen. Die einzige Frage, die dabei nicht gestellt wurde: »Warum retteten sich die Facebook-Nutzer, deren Daten von Cambridge Analytica abgeschöpft wurden, denn nicht in den wasserdichten Teil des Internets?«
Ob es auch zu dem folgenden Vorgang einen Regierungsausschuss gab, ist mir nicht bekannt, aber wasserdicht war der Plan dahinter sicher nicht. Im Jahr 1962 kam die NASA-Sonde Marine 1 vom Kurs ab und wurde zerstört. Der Grund war, dass jemand bei der Berechnung der Flugbahn einen Bindestrich falsch gesetzt hatte. Der Kostenpunkt für diesen kleinen Flüchtigkeitsfehler: 18,5 Millionen Dollar. Diese Anekdote habe ich übrigens nur deswegen im Buch, weil ich mir sicher bin, dass sie meiner Lektorin gefallen wird.
Spaß beiseite, vierzig Jahre später, um die Jahrtausendwende, sagte sich die NASA: Wir haben schon lange nicht mehr durch einen falsch gesetzten Bindestrich zig Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Jemand wandte ein, dass es vielleicht nicht besonders clever wäre, diesen Fehler einfach zu wiederholen. Das sahen die Offiziellen ein und gingen darum diesmal subtiler vor, wenn auch nicht weniger dumm. So beauftragte die NASA, um Geld zu sparen, ein Privatunternehmen mit der Herstellung einer Raumsonde, die zum Mars fliegen sollte. Im Gegensatz zur NASA nutzte man beim Subunternehmer allerdings nicht das metrische System. Und bei der Übertragung der Daten wurde der Fehler nicht bemerkt. Die Sonde stürzte also nach Hunderten von Millionen Kilometern ungebremst auf die Marsoberfläche. Mit ihr knallten über hundert Millionen Dollar und jahrelange Entwicklungsarbeit in den roten Staub. Immerhin war diesmal nicht nur ein Bindestrich schuld.
Doch warum zu den Sternen schweifen, wenn das Dumme liegt so nah? Auch beim Versuch, die Welt zu retten, kann man sich dumm anstellen. So fand 1990 am Earth Day im New Yorker Central Park eine Großveranstaltung von Umweltaktivist*innen statt. Dort erschienen erfreulicherweise Hunderttausende von Menschen, um ihre Unterstützung für den Umweltschutz auszudrücken. Nicht ganz so erfreulich ist, dass sie den Park regelrecht mit Müll fluteten: Insgesamt 1543 Tonnen Müll mussten nachher aus dem Park entsorgt werden.
Der Zweck, etwas Gutes für die Umwelt zu machen, sollte nicht mit dem Mittel der Umweltzerstörung verfolgt werden. Klingt banal, ist aber scheinbar schwieriger zu befolgen, als man denkt. Den Fehler machte man zum Beispiel auch ein paar Jahre später im Vorfeld des Besuches des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton im Braulio Carrillo Nationalpark in Costa Rica. Clinton war angereist, um über Umweltschutz zu sprechen. Leider benötigte er zu der Zeit Krücken, und so beschloss sein Team, eine 120 Meter lange Schneise mitten in den Urwald hinein zu schlagen und zu asphaltieren, damit der US-Präsident gut laufen konnte. Man könnte spitzfindig anmerken, dass diese Aktion nicht nur den Boden des Regenwaldes untergraben hat, sondern auch die Glaubwürdigkeit von Clintons Rede.
Aber nicht nur beim Versuch, die Umwelt zu schützen, stellen sich Menschen dumm an. Am 22. April 2009 sagte die amerikanische Abgeordnete Michele Bachmann am Earth Day im US-Repräsentantenhaus, dass Kohlendioxid nichts Schädliches sei, sondern immer nur negativ dargestellt werde. Sie übersah dabei die Tatsache, dass der gegenwärtige Überschuss an CO2 für den Klimawandel verantwortlich ist und potenziell den Planeten unbewohnbar machen könnte. Vielleicht besitzt Frau Bachmann ja ein Ferienhaus auf dem Mars. Oder sie folgte nur einem berühmten Vorbild, nämlich dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Dan Quayle. Dieser sagte einst den berüchtigten Satz: »Nicht die Umweltverschmutzung schädigt die Umwelt, sondern die Verunreinigungen in Luft und Wasser.« Na dann. Zumindest aber ist es die lustigste Aussage, seit US-Präsident Calvin Coolidge sagte: »Wenn immer mehr Menschen ihre Arbeit verlieren, resultiert daraus die Arbeitslosigkeit.« Man darf sich wundern, warum manche US-Präsidenten den Nobelpreis gekriegt haben, andere jedoch nicht.
Dabei ist unser Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die zentrale Dummheit unseres Zeitalters. Dass wir gegenwärtig einen Klimawandel erleben und dass dieser durch die Menschheit verursacht wurde und wird, darin sind sich Wissenschaftler*innen erstaunlich einig. Es gab in den letzten Jahren zwei große Studien zu dem Thema, beide kamen zum Ergebnis, dass rund 97 Prozent der Klimaforscher*innen den Menschen als Ursache für den derzeitigen Klimawandel sehen. Das zentrale Gegenargument ist, es habe schon immer Schwankungen im Klima gegeben, auch in der vorindustriellen Zeit. Jedoch konnten Schweizer Forscher*innen im Juli 2019 nachweisen, dass es diese Schwankungen zwar tatsächlich gab, es sich aber um lokale Phänomene gehandelt habe. Der aktuelle Klimawandel hingegen betreffe den gesamten Planeten und unterscheide sich damit klar von vorigen, natürlich vorkommenden Vorgängen.
Es darf in Anbetracht dieser überwältigenden Einigkeit vermutlich als dumm gelten, den menschengemachten Klimawandel zu leugnen. Es ist zudem ganz sicher dumm, hierfür ins Feld zu führen, dass man durch diese Leugnung wie Galilei sei, weil man sich gegen den Konsens stelle. Denn genau das machen viele Personen, die Zweifel hegen am menschengemachten Klimawandel. Der Unterschied ist halt, dass Galilei – und mehr noch Roger Bacon – wissenschaftliches Denken einforderte und sich damit gegen einen Konsens stellte, der auf reinem Glauben basierte. Wer nun hingeht und aus reinem Glauben die Ergebnisse der Wissenschaft anzweifelt, verkehrt die Vorzeichen und nimmt Galilei als Argument, um Galileis Errungenschaften rückgängig zu machen.
Ganz am Rande sei bemerkt, dass der Einfluss des Menschen auf die Umwelt keinesfalls neu ist. Schon vor fast 200 Jahren kreideten die ersten Denker, zum Beispiel Alexander von Humboldt, die Umwelt- und Luftverschmutzung durch den Menschen an, und vor mehr als hundert Jahren wurde in der Öffentlichkeit diskutiert, dass die Industrie CO2 ausstieß und damit das Klima veränderte.
Der schwedische Forscher Svante Arrhenius stellte bereits 1896 Überlegungen an, wie die Konzentration bestimmter Gase in der Atmosphäre dazu beitrage, diese zu erwärmen. Der amerikanische Journalist Francis Molena griff diesen Gedanken auf und schrieb 1912 in der Zeitschrift Popular Mechanic darüber, wie die jährliche Verbrennung von Millionen Tonnen von Kohle dazu führen würde, dass sich in ferner Zukunft das Klima verändern würde. Allerdings war Molena ein bisschen optimistischer, als man es heute allgemein ist. Er begeisterte sich für die Errungenschaften des menschlichen Denkens, insbesondere des amerikanischen Gehirns, das er für fortschrittlicher und mutiger hielt als alle anderen Gehirne auf der Welt. Das Gehirn habe Maschinen geschaffen, die über den Wolken flögen, schneller als der Wind seien, die Kraft von hundert Menschen hätten und die durch ihre Verbrennungsmotoren und Abgase ganz nebenher die gesamte Welt veränderten. Denn durch den Wandel des Klimas könnten »zukünftige Generationen wärmere Winde genießen und unter sonnigeren Himmeln leben«. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt, trotz der Tatsache, dass Molena all diese Dinge immerhin mit einem amerikanischen Gehirn vorhergesagt hat.
Doch auch eher zeitgenössischen Wissenschaftler*innen kam leider viel zu lange etwas dazwischen, wenn es um das Thema Klimawandel ging. So sagte der Forscher James Black bereits 1977 mit erschreckender Präzision den Verlauf des CO2-Ausstoßes der Menschheit und die resultierenden Folgen für das Weltklima voraus – vor 42 Jahren. Das Problem daran war Blacks Arbeitgeber, denn dabei handelte es sich um den Ölkonzern Exxon. Dieser verbrachte die nächsten Jahrzehnte damit, die Erkenntnisse nicht nur zu verschweigen, sondern hat gezielt Zweifel an Klimaforschung gestreut und die Rolle fossiler Brennstoffe kleingeredet. Wäre das nicht so traurig, wäre es einfach ein tolles Beispiel dafür, wie Dummheit entsteht, wenn ein Motiv wie Profitgier den Einsatz des Verstands verhindert.