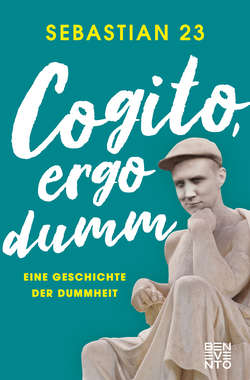Читать книгу Cogito, ergo dumm - Sebastian 23 - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Was heisst hier dumm?
Оглавление»Vielwisserei lehrt nicht Verstand haben.«
Heraklit
Wenn man einfache Lösungen mag, würde man wohl im Duden nachschlagen, was Dummheit ist, aber der Duden weiß das natürlich und streckt den Suchenden auf seine ganz eigene Art die Zunge raus. Dummheit wird hier definiert als »Mangel an Intelligenz«. Intelligenz hingegen wird definiert als Mangel an Dummheit. Und fertig ist die Laube. Leider stimmt das nicht, ganz so mutig ist die Duden-Redaktion nicht. Intelligenz ist ihr zufolge die Fähigkeit, abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal diesen Satz verstanden und bin mir daher recht sicher, dass wir alle ein bisschen dumm sind. Aber vielleicht schließe ich da auch wieder nur von mir auf andere.
Es scheint, wenn man verstehen will, was Dummheit ist, kommt es auch darauf an, was man so als Intelligenz betrachtet. Umfragen zufolge galt als intelligentester Deutscher lange Zeit niemand anderes als Günther Jauch. Das leuchtet ein, der wusste ja auch immer die Antworten auf alle Quizfragen, sogar die allerschwierigsten. Der muss ja wahnsinnig clever sein, ist logisch. Dass Herr Jauch die Fragen ja gar nicht selbst beantworten muss, sondern am Ende nur die Antworten der Kandidat*innen mit der richtigen Antwort aus der Redaktion vergleicht, spielt offenbar eine untergeordnete Rolle. Gut, okay, das hätte man auch einem mittelbegabten Huhn beibringen können, welches im Übrigen ähnlich undurchschaubar geguckt und zudem hübscheres Gefieder vorzuweisen gehabt hätte. Aber gut, das ist nicht meine Entscheidung, das müssen die Verantwortlichen bei RTL selbst wissen. Bisschen schade nur, dass mittlerweile nicht ein mittelbegabtes Huhn als intelligenteste Deutsche gilt, sondern stattdessen den misogynen Maskenball namens Germanys Next Top Model moderiert.
Immer wieder beeindruckt zeigen sich die Menschen auch von Kopfrechenkünstler*innen. Die gelten als überaus intelligent, wenn sie mal eben beim Frühstück zwischen Scheiblettenkäse und Mirabellenmarmelade dreistellige Zahlen im Kopf multiplizieren. Das kann ich übrigens auch, vorausgesetzt, die dreistelligen Zahlen sind 100 und 100. Da ist die Lösung einfach: 200. Wäre jedoch allein Kopfrechnen der Maßstab für Intelligenz, dann wäre bereits mein Taschenrechner eine übermenschliche künstliche Intelligenz, die uns alle unterjochen könnte: »Kniet nieder, ihr Narren, Fürst Casio X34 ist im Haus und jongliert lässig mit Zweierpotenzen!«
Glücklicherweise ist das nicht so und nur deshalb sind wir noch die überlegene Intelligenz auf diesem Planeten. Vor lauter Freude darüber nennen wir uns selbst Homo sapiens (etwa: der kluge Mensch), bis in die 1990er war sogar die Bezeichnung Homo sapiens sapiens verbreitet. Der kluge, kluge Mensch – das war unser Name. Mag sein, dass wir unser Recht als Erfinder der Sprache, alles zu benennen, da etwas zu unseren Gunsten verbogen haben: »Okay, du bist ein Huhn, du bist eine Katze und du bist ein Dorsch. So, haben jetzt alle Namen? Nein, ich selbst noch nicht? Okay, ich heiße der kluge, kluge Mensch. Hat jemand Einwände? Nein? Okay.«
Kann es da verwundern, dass niemand dumm sein will? Schließlich definieren wir nicht weniger als unsere eigene Gattung über unsere Klugheit. Und doch scheint die Dummheit unser steter Begleiter zu sein. Falls Sie heute noch nichts Dummes gemacht haben, sind Sie vielleicht einfach nicht ehrlich zu sich selbst. Schade im Grunde, dass man nur den IQ messen kann, aber nicht den Dummheitsquotienten, also quasi den SQ, wie man international abkürzen würde. So klagt Emil Kowalski in seinem hervorragenden Buch Dummheit. Eine Erfolgsgeschichte. Über diesen Punkt musste ich allerdings ein wenig schmunzeln. Denn den Dummheitsquotienten zu messen statt den Intelligenzquotienten ist ein wenig, wie die Dunkelheit statt der Helligkeit zu messen: »Ja, Herr Nachtigaller, wir wissen, wie hell es in diesem Raum ist. Aber die Frage bleibt: Wie dunkel ist es in diesem Raum?«
Es lohnt sich also doppelt, in diesem Buch einen genaueren Blick auf die Dummheit zu werfen. Denn die Reise geht immer auch an die Grenzen unserer Intelligenz. Und da wird es erfahrungsgemäß lustig. Ganz nebenbei finden wir vielleicht auch noch raus, ob wir den Ehrentitel Homo sapiens überhaupt verdienen oder in Zukunft eher Homo stultus heißen sollten.
Eine sehr naheliegende Methode, über die Intelligenz oder eben die Dummheit eines Menschen eine Aussage zu treffen, ist der IQ-Test. Der Franzose Alfred Binet erfand das Konzept von Testaufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Der deutsche Psychologe William Stern entwickelte 1912 aus diesem Test eine Maßeinheit: den Intelligenzquotienten, kurz IQ. Bei Leuten, die vorher gelebt haben oder einen solchen Test nie gemacht haben, kann man nur Mutmaßungen anstellen. Das gilt auch für Albert Einstein, dem ein IQ von 160 nachgesagt wird, der aber nie einen Test gemacht hat, also in Wirklichkeit überhaupt gar keinen IQ hatte. Und das, obwohl er 100 Prozent seines Gehirns nutzte. Ebenso wenig wissen wir über den IQ von Charles King, der 1927 die Präsidentschaftswahlen in Liberia mit 243 000 Stimmen Vorsprung gewann. Beeindruckende Zahlen, besonders bei nur 15 000 Wahlberechtigten im Land. Sein IQ war bestimmt mindestens fünf Milliarden. Aber dazu später mehr.
Die heute gebräuchlichen weiterentwickelten IQ-Tests gehen auf den US-Psychologen David Wechsler zurück. Wir haben uns inzwischen darauf geeinigt, dass alle zwischen 85 und 115 in der Norm liegen. Ab einem IQ von weniger als 70 spricht man von Intelligenzminderung, Minderbegabung, Schwachsinn oder Oligophrenie. »Etwa 5 Prozent der Gesamtbevölkerung weisen nach der psychologischen Definition eine Intelligenzminderung auf«, schreibt der Hirnforscher Ernst Pöppel. Der IQ-Test wird dabei übrigens regelmäßig normiert, dazu werden 30 000 bis 50 000 Probanden gemessen und ein Mittelwert gefunden, der dann als 100 definiert wird. Und es mag Sie vielleicht überraschen, dieser Mittelwert steigt stetig. Nach der Definition von Intelligenztests wird die Menschheit also scheinbar immer klüger. Spätestens dieses Phänomen, das in der Fachwelt als Flynn-Effekt bezeichnet wird, macht mich persönlich ja misstrauisch.
Vielleicht hat der Journalist Bob Fenster das Problem ganz gut eingegrenzt: »Intelligenz wird von Leuten eingeschätzt, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Intelligenz hoch einzuschätzen. Sie ist nämlich ihr einziges Ass im Ärmel.« Vielleicht denken Sie jetzt auch: Moment mal, ist das schon alles, was sich im menschlichen Denken abspielt? Nun, machen Sie sich auf ein paar Überraschungen gefasst. Zum Beispiel, dass Ihr gerade geäußerter Gedanke eine kritische Rückfrage ist und damit ein Zeichen für eine Form von Intelligenz, die so in IQ-Tests eben nicht gemessen wird. Nicht dass IQ-Tests deswegen dumm wären. Aber womöglich sind wir nicht so doof, wie mancher IQ-Test uns nahelegen will.
Das Volk der Luo im westlichen Kenia hat in seiner Sprache DhoLuo vier verschiedene Worte für Intelligenz: Rieko, Luoro, Winjo und Paro. Dabei entspricht nur Rieko derjenigen Intelligenz, die in IQ-Tests abgefragt wird, denn mit Rieko bezeichnen die Luo kognitive Kompetenz. Wie Professor Elias Mpofu von der Universität Johannesburg erklärt, bezieht sich Paro auf eine Art kreative Intelligenz und das Durchhaltevermögen bei der Umsetzung von Ideen. Bei Luoro und Winjo handelt es sich hingegen um soziale Fähigkeiten: Die Fähigkeit, andere zu respektieren und sich um sie zu kümmern, wird Luoro genannt, in Abgrenzung dazu bezeichnet Winjo das Verständnis und die Ehrerbietung für Erwachsene, Ältere oder Autoritätsfiguren. Auch in der westlichen Psychologie wird seit geraumer Zeit die emotionale Intelligenz und die damit zusammenhängende Sozialkompetenz diskutiert. Insbesondere der amerikanische Psychologe Daniel Goleman hat 1995 mit seinem Buch Emotional Intelligence. Why It Can Matter More Than IQ das Thema einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Darin prägt er auch das Gegenmodell zum IQ, nämlich den EQ, mit dem man die Emotionale Intelligenz messen kann.
Robert Sternberg, ebenfalls Psychologe, ging sogar noch einen Schritt weiter und entwickelte ein dreigeteiltes Konzept von Intelligenz: Analytische Intelligenz, Kreative Intelligenz, die bei ihm die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit neuen und ungewohnten Problemen ist, und Praktische Intelligenz, also die Anpassungsfähigkeit an Alltagsprobleme. Seitdem hat er sich der Erforschung und Publikation der Intelligenz und ihrer Grenzen hinter IQ und EQ gewidmet. Erfolg kann man im Leben nur haben, so seine These, wenn man eben auch Praktische und Kreative Intelligenz hat. Praktische Dummheit im Alltag ist dann vermutlich, wenn man morgens um 6:30 Uhr aufsteht, duscht, sich anzieht, Kaffee trinkt und frühstückt, zur Arbeit fährt und pünktlich um 7:59 Uhr vor der Bürotür merkt: Es ist Sonntag. Kreative Dummheit hingegen wäre es, dann seinen Kalender wegen unterlassener Hilfeleistung zu verklagen. Sie sehen, man kann auf ebenso viele Weisen dumm sein, wie man sich intelligent verhalten kann – beruhigend, oder? Die Luo würden sicher zustimmen: Um im Leben zurechtzukommen, braucht man eben mehr als nur Rieko. Und wissen Sie, wer noch zugestimmt hätte? Albert Einstein. Der hat tatsächlich mal – diesmal wirklich ehrlich – in einem Beitrag in der The Saturday Evening Post geschrieben: »Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.«
Da wir hier im Buch einiges dumm nennen werden, möchte ich einen wichtigen Einwand von Emil Kowalski nicht unerwähnt lassen: »Es sei ausdrücklich betont, dass wir physiologisch oder sozial bedingte Mängel an Intelligenz nicht als ›dumm‹ verstehen wollen, also keine Demenz oder andere krankhafte kognitive Störungen, und auch nicht gesellschaftlich bedingte Wissensdefizite. Menschen, die wegen Verletzung, Krankheit oder Alter ihre geistige Beweglichkeit einbüßen oder unter sozial unwürdigen Verhältnissen leben, sind nicht dumm im Sinne unserer Überlegungen. Sie verdienen keinen unserer Sarkasmen, sondern Hilfe und Verständnis.«
Ich finde das äußerst interessant, denn Kowalskis Versuch, jegliche Form von geistigem Elitarismus zu vermeiden, klingt sehr nachsichtig und umsichtig. Seine Ausnahmen von der Regel sind jedoch so umfangreich, dass am Ende so gut wie niemand mehr dumm zu nennen wäre. Ich glaube, es ist eher andersherum: Jeder Mensch ist dumm. Wir alle brauchen Hilfe. Ganz sicher nicht immer. Aber oft genug. Und nur von dieser Basis aus können wir die Dummheiten anderer Menschen betrachten und dürfen auch darüber lachen. Man kann die ganze Sache so betrachten wie Bob Fenster: »Die Intelligenz der allermeisten Menschen reicht aus, um im Leben zurechtzukommen.« Wie wichtig kann es da sein, wenn einer schneller weiß, ob ein gelbes Quadrat eine Reihe richtig vervollständigt oder ein weißer Kreis? Man sollte sich also keinesfalls schlechter fühlen, wenn man das grüne Dreieck angekreuzt hat. Oder einen anderen deswegen geringschätzen.
Überhaupt ist es doch so: Wir denken einfach nicht immer gerne nach. Viele Leute gehen dem Denken sogar sehr aktiv aus dem Weg. Und sie nehmen einiges in Kauf, um bloß nicht ins Grübeln zu geraten. Eine Studie an der Universität von Virginia, von der Timothy Wilson 2015 in einem Beitrag für das Magazin Science berichtete, ergab, dass mehr als die Hälfte der getesteten Teilnehmer*innen sich tatsächlich lieber selbst kleine Elektroschocks verpassten, als für sechs bis elf Minuten still zu sitzen und nachzudenken. Aua. Was soll man dazu noch sagen? Ich schließe mich dem Hofnarren und Gelehrten David Faßmann an. Dieser schrieb schon 1729, wenn es Leuten an Erinnerungsfähigkeit und Urteilskraft fehle und sie dann auch noch keine Lust zum Studieren haben, werden sie zu »Stock-Narren, Ertz-Matzen und Lappen«. Manchmal vermisse ich das 18. Jahrhundert ein bisschen.
Aber auch, wenn heute vielleicht nicht alle Stock-Narren und Ertz-Matzen sind: Dass wir alle von Zeit zu Zeit dumme Sachen machen, lässt sich schon aus logischen Gründen gar nicht bestreiten, denn so etwas zu sagen wäre selbst eine dumme Sache. Jede*r von uns ist schon mal falschrum in eine Drehtür gelaufen, hat seinen Kaffee auf dem Autodach vergessen, obwohl man mit dem Fahrrad unterwegs war, oder aus Versehen nicht verstanden, wie genau unser politisches System funktioniert. Oder ein Kühlschrank. Weiß irgendjemand hier, wie Kühlschränke genau funktionieren? Bitte aufzeigen!
Selbst die intelligentesten Menschen machen manchmal dumme Dinge. Aber sind sie dann nicht gleichzeitig dumm und intelligent? Wie soll das möglich sein? Das liegt ganz einfach daran, dass wir Worte wie dumm oft als Beschreibung eines vermeintlich fixen Zustands verwenden: »John ist dumm.« In diesem Sinne kann man einerseits ein kognitives Defizit meinen, das sich zum Beispiel in einem deutlich unterdurchschnittlichen IQ widerspiegelt. Oder man meint, dass John chronisch unwissend ist, etwa durch mangelhafte Bildung. Diese Formen von Dummheit würde ich allgemeine Dummheit nennen und nicht statische Dummheit, denn an den meisten Einschränkungen dieser Art kann man noch etwas ändern. Ebenso kann man das Wort dumm aber auch einsetzen, um das Verhalten in einer bestimmten Situation zu beschreiben: »Als John versucht hat, sein Smartphone im Toaster aufzuladen, war das ziemlich dumm.« Und ja, bezüglich der Situation mit dem Smartphone kann man dann auch völlig zu Recht sagen, dass John dumm ist. Aber er kann im nächsten Moment schon wieder etwas sehr Intelligentes sagen und durchschimmern lassen, dass er ein Harvard-Professor ist. In diesem Sinne ist es gar nicht widersprüchlich, dass John schlau und dumm ist. Das vermeintliche Paradox rührt nur daher, dass wir in der Alltagssprache oft unpräzise sind und Ausdrücke mehrere Sachen bedeuten können. Dumm kann eben allgemein kognitiv eingeschränkt oder unwissend heißen, aber sich auch auf situative Dummheit beziehen. Diese würde ich am ehesten als Unbedachtheit klassifizieren, auch wenn das vielleicht etwas verharmlosend klingt für die Aktion, sein Smartphone im Toaster aufzuladen.
Um etwas Dummes zu machen, muss man hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurückbleiben – ich möchte noch einmal an die Definition des Duden erinnern –, abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten. Situative Dummheit ist nicht-angewandte Intelligenz. Und klar, wer sich lieber Elektroschocks verpassen lässt, als mal eine Weile zu grübeln, der wirkt womöglich, als befände er sich auf einem Pfad in Richtung kompletter Nicht-Anwendung. Aber auch diese Personen können ihr Verhalten ändern, aus einer kommenden Situation etwas lernen, an einer Begegnung oder einem Erlebnis oder einem sehr schmerzhaften Elektroschock reifen, und würden vielleicht schon eine Woche später beim selben Test eine andere Entscheidung treffen. Wir sind zum Glück nicht eindimensional. Es gibt sogar für Ertz-Matzen und Stock-Narren noch Hoffnung.
Die Wissenschaftler Mats Alvesson und André Spicer schreiben völlig zu Recht, dass es zu einfach gedacht ist, wenn man Menschen, die dumme Dinge machen, einen niedrigen IQ, schlechte Erziehung oder ein verengtes Weltbild unterstellt. Auch wenn das bisweilen zutreffen mag, darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass einige der problematischsten Dummheiten von sehr intelligenten Menschen gemacht werden. Das liegt auch daran, dass wir dazu neigen, die allgemeine und die situative Verwendung von intelligent oder dumm zu verwechseln. Denn wenn wir vergessen, dass auch Expert*innen sich gelegentlich sehr dumm anstellen, dann überlassen wir ihnen womöglich zu viel Verantwortung.
Noch mal anders beschreibt es Robert Musil in seinem Vortrag »Über die Dummheit« von 1937. Nachdem er sich lange durch die scheinbar paradoxen Verwendungen des Wortes Dummheit manövriert hat, unterscheidet er zwischen der einfachen und schlichten Dummheit, die er lange Leitung nennt, und einer anderen Dummheit, die nicht auf einem generell schwachen Verstand beruht, sondern »auf einem Verstand, der bloß im Verhältnis zu irgendetwas schwach ist, und diese ist die weitaus gefährlichere«.
Damit stellt sich die Frage, im Verhältnis zu was der Verstand denn schwach ist, wenn intelligente Menschen etwas Dummes machen. Irgendetwas muss die Menschen dazu antreiben, unbedacht zu bleiben, es muss ein stärkeres Motiv dafür geben, nicht in Ruhe zu überlegen und seinen Verstand zur Anwendung zu bringen. Das kann natürlich passieren, wenn unsere Gefühle die Kontrolle übernehmen. Wenn wir Angst oder Hass oder Gier oder Lust oder Arroganz an die Zügel lassen, dann ist es gut möglich, dass der Verstand nichts mehr zu melden hat. Oder zumindest nicht mehr viel. Ebenso gilt das für unsere Moralvorstellungen, woher auch immer wir diese gerade nehmen oder kriegen. Manchmal folgen Menschen lieber einer Sekte, einer Ideologie oder einem Anführer, als sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, was Musil damit meinte, dass diese Form von Dummheit gefährlich sein kann. Wir werden sehen, dass Unbedachtheit aber eben auch überaus lustig sein kann. Und keine Sorge, wir dürfen alle getrost darüber lachen, denn wir sind in diesem Punkt alle weitgehend auf Augenhöhe. Und zwar mit einem Kieselstein.
Fassen wir unsere Erkenntnisse so weit noch mal zusammen, kann man drei Dinge unterscheiden, die wir aber alle Dummheit nennen: kognitive Beeinträchtigung, die angeboren ist, biografisch bedingte Unwissenheit und situative Dummheit, die wir zur Abgrenzung auch Unbedachtheit genannt haben. Bei letzterer überwiegt eine andere Motivation und führt dazu, dass man eben nicht von seinem Verstand Gebrauch macht. Und zwar weder von seiner rationalen Intelligenz noch von der emotionalen Intelligenz und Sozialkompetenz, weder von seiner praktischen Intelligenz noch von seiner kreativen Intelligenz. Die situative Dummheit ist locker in der Lage, alle Formen unserer Intelligenz auszuhebeln. Hinzugefügt sei noch, dass sich die drei Dummheiten übrigens explizit nicht gegenseitig ausschließen. Ein Beispiel? Ich würde sagen, bei dem Mann im nordhessischen Bad Zwesten, der ohne jede Maske oder Waffe eine Bank überfiel und auf den Hinweis der Bankangestellten, größere Auszahlungen könne man nur gegen Beleg ausgeben, bereitwillig seine Personalien angab, kam so ziemlich jede Form von Dummheit zusammen.
Im Folgenden wollen wir uns hauptsächlich auf die situative Dummheit konzentrieren. Wie schon gesagt, sie ist die lustigste Form der Dummheit, und es lässt sich sicher sagen, dass wir alle manchmal unbedacht sind: Niemand macht keine Fehler. Ganz besonders nicht diejenigen, die sich für unendlich klug halten. Und davon werden wir in diesem Buch so einige kennenlernen. Ich halte mich da an den italienischen Schriftsteller Alberto Moravia, der einmal sagte: »Dummheiten können reizend sein, Dummheit nicht.« Werfen wir trotzdem getrost einen Blick auf all jene Stock-Narren, Ertz-Matzen und Lappen der Geschichte.