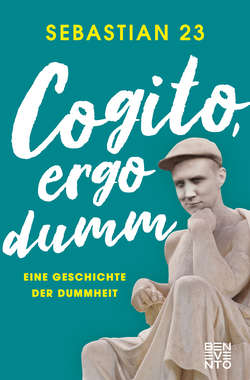Читать книгу Cogito, ergo dumm - Sebastian 23 - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Unheilbar dumm
Оглавление»Mit jemandem zu argumentieren, der die Vernunft ablehnt, ist wie die Verabreichung von Medizin an Tote.«
Thomas Paine
Man muss nicht mit Nietzsche übereinstimmen, der an einem seiner fröhlicheren Tage einmal vom Stapel ließ, dass diese Welt viele Krankheiten habe und die schlimmste hieße Mensch. Aber als sicher darf gelten, dass Menschen schon immer krank wurden. Böse Zungen sagen, dass auch dieses Buch Kopfschmerzen bereiten kann, wenn man in zu kurzer Zeit zu viel über Dummheiten liest.
Die Geschichte der Medizin jedenfalls lässt sich bis weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. Vor fast 4000 Jahren gab es zum Beispiel den Codex Hammurabi, eine zwei Meter hohe Stele mit 282 in Keilschrift verfassten Gesetzen. Nicht ganz so handlich wie ein Smartphone, aber alt, alt, alt! Im Codex Hammurabi war zum Beispiel festgehalten, dass ein Arzt für eine erfolgreiche Operation mit einem Bronzemesser an einem Edelmann ein Honorar von zehn Silberschekeln zu erhalten habe. Das entsprach damals dem Jahresgehalt eines Handwerkers. Bevor sich jetzt die Ärzt*innen unter Ihnen in diese Zeit zurückwünschen, sollten Sie allerdings auch in Betracht ziehen, was als Strafe bei Misserfolg einer solchen Operation bestimmt wurde: das Abhacken der Hand. Ob dieses Wissen gegen ein leichtes Zittern beim Operieren geholfen haben mag?
Wenn man sich die Geschichte der Medizin bis heute anschaut, gibt es eine Konstante: Schon immer gab es Behandlungsmethoden, deren Wirksamkeit man anzweifeln darf und deren Rezepturen absurd klingen. So empfahl das Papyrus Ebers um 1550 vor Christus in Ägypten als Mittel gegen Kahlköpfigkeit einen Trank aus Eselhoden, einem Gemisch aus Vulva- und Penisextrakten und einer Eidechse. Ohne die Eidechse klappt das natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auf mich wirkt das ein bisschen so, als wollte der Verfasser dieses Papyrus über Leute mit Haarausfall seinen Spott ergießen. Aber man darf davon ausgehen, dass Heiler zu anderen Zeiten in anderen Kulturen auch ganz anders getickt haben. Man denke nur an den damaligen Klistierexperten des Pharaos mit dem schönen Namen Iri, Hirte des Afters. Ich möchte aus eigener Erfahrung hinzufügen: Der gleichnamige Film aus dem Erwachsenenbereich ist nicht für jeden Geschmack gleichermaßen geeignet. Aber falls Ihnen dabei vor Schreck die Haare ausfallen, wissen Sie ja jetzt ein tolles Mittel dagegen.
Die Behandlung von Krankheiten in der Antike war natürlich nicht immer gefährlich oder anstrengend. Nehmen Sie das Asklepieion in Griechenland. Dabei handelte es sich um einen dem Asklepios geweihten Tempel, in dem die Kranken mittels des sogenannten Tempelschlafs behandelt wurden. Die Patient*innen schliefen dabei im Angesicht einer Statue des Asklepios und wurden entweder im Schlaf vom Gott selbst geheilt oder er sandte einen Traum, der von einem Priester gedeutet wurde und die Heilung beschrieb. Klingt entspannt, oder? Wobei, andererseits, wenn man bedenkt, was man manchmal für einen Schnurz zusammenträumt – vielleicht sollte man vorsichtig sein, bevor einem der Arzt rät, sich von 500 pinken Elefanten mit Madonna-Masken durch den Arc de Triomphe tragen zu lassen. Als Mittel gegen Haarausfall, selbstverständlich.
Ebenfalls im antiken Griechenland unterwegs war Hippokrates, von dem Sie gewiss schon mal gehört haben. Er lebte von 460 bis circa 370 vor Christus und war der Erste, der sich radikal von religiösen Erklärungen für Krankheiten abwandte. Über Epilepsie schrieb er zum Beispiel, sie scheine ihm »um nichts göttlicher zu sein als die übrigen, vielmehr scheinen auch die anderen Krankheiten eine natürliche Ursache zu haben, aus der jede einzelne von ihnen entsteht, eine natürliche Ursache und einen Grund scheint aber auch sie zu haben«.
Hier haben wir also wieder einen Fall von jemandem, der mit den tradierten Denkweisen brach und damit die Menschheit einen entscheidenden Schritt weiterbrachte. Andererseits ist eine andere seiner Neuerungen inzwischen auch nicht mehr der Hit, der sie mal war. Denn Hippokrates gilt gemeinsam mit seinem Schüler Polybos als Urheber der Vier-Säfte-Lehre. Das klingt ein bisschen nach Multivitaminsaft, gemeint ist aber die Humoralpathologie, die Lehre der Flüssigkeiten im Körper. Zunächst wurden den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft die vier Eigenschaften heiß, kalt, trocken und feucht zugeordnet. Im Corpus Hippocraticum wurden diesen dann die vier Körpersäfte entsprochen: Blut, Schleim, gelbe Galle und Cyberpunk. Na gut, okay, der vierte Saft ist leider nicht Cyberpunk, sondern schwarze Galle.
Hippokratische Ärzte bevorzugten diätische Behandlungen vor Arzneien: »Der erste Koch war auch der erste Arzt«, heißt es da. Und es darf vermutet werden, dass es zumindest stimmt, dass man umso gesünder bleibt, je weniger altägyptisches Haarwuchsmittel man sich hinter die Gurgel kippt. Allerdings muss man hinzufügen, dass das griechische Wort diaita nicht nur Diät bedeutet, sondern allgemeiner auch Lebensweise. Dementsprechend war nach Hippokrates eine gute Lebensweise der Schlüssel zur Gesundheit. Beispiel aus dem Corpus Hippocraticum gefällig? »In dieser Jahreszeit übe man auch den Beischlaf häufiger aus und zwar mehr die älteren als die jüngeren Leute«. So geht ganzheitliche Medizin: immer schön den Winter wegbumsen.
Es scheint, dass es Ganzheitlichkeit nicht nur in der traditionellen chinesischen Medizin gibt, bei der die Einbeziehung aller Lebensbereiche in die Gesundheit und Heilung von zentraler Bedeutung ist. Aber lassen Sie uns jetzt nicht zu Schlüssen springen und annehmen, es sei womöglich der Umstand, dass wir uns heutzutage hauptsächlich Burger fressend gegenseitig auf Facebook anschreien, der uns alle dumm und krank macht. Mens sana in corpore sano? Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper? Das klingt einerseits ganzheitlich gedacht, zugleich aber auch superökospießig. Her mit Fritten und Cola, ihr Stock-Narren und Ertz-Matzen!
Dass man auch ganzheitlich ganz danebenliegen kann, bewiesen antike Ärzte, indem sie zur Heilung vieler psychischer Erkrankungen bei Frauen eine Heirat als Therapie vorschlugen. Man fragt sich, was sie zur Heilung bei offenliegender Frauenfeindlichkeit vorgeschlagen hätten. Bleiben wir aber lieber noch einen Moment bei der Vier-Säfte-Lehre. Denn nachdem Galenos diese im zweiten Jahrhundert nach Christus weiterentwickelt hatte, wurde sie bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine zentrale Säule der europäischen Medizin. Dieser römische Arzt und Anatom ordnete den vier Säften vier Temperamente zu: cholerisch, phlegmatisch, sanguinisch und melancholisch.
Galenos schätzte seinen Einfluss selbst so ein: »Ich habe für die Medizin so viel getan wie Trajan für das Römische Reich, als er Brücken baute und Straßen durch Italien baute. Ich und nur ich allein habe den wahren Weg der Medizin aufgetan. Zugegebenermaßen hat Hippokrates diesen Weg bereits gewiesen … er bereitete den Weg, aber ich habe ihn begehbar gemacht.« Es scheint, obwohl er selbst davon genug hatte, hat Galenos das fünfte Temperament übersehen: superprotzig. Die zugehörige Körperflüssigkeit ist übrigens Champagner.
Jedoch muss man eine Sache klar formulieren: So seltsam einem Galenos’ Selbsteinschätzung vorkommen mag und so antiquiert die Säftelehre heute wirken mag: Sein methodisches Vorgehen stellte einen riesigen Fortschritt dar und prägte die Medizin über die unvorstellbar lange Zeit von mehr als eineinhalb Jahrtausenden. Zumindest in Westeuropa allerdings mit einer kleinen Unterbrechung namens Mittelalter, in der seine Schriften ein Schattendasein in den Bibliotheken einiger weniger Klöster und Domschulen fristeten.
Bevor wir jedoch darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch den Arzt Alexandros von Tralleis erwähnen, der im 6. Jahrhundert lebte, also genau im Übergang von der Antike zum Mittelalter. Dieser hatte nämlich herausgefunden, dass Bilsenkraut nur wirksam ist, wenn man es zwischen linkem Daumen und Zeigefinger hält und der Mond im Zeichen der Fische oder des Wassermanns steht. Muss man wissen. Doch es war gewiss nicht Alexandros von Tralleis’ Schuld, dass es die formelle Medizin im Mittelalter schwer hatte. Einen großen Teil der Schuld trägt hingegen die Vorherrschaft der Religion, auch wenn man dieser Behauptung entgegenhalten kann, dass ohne Mönche das medizinische Wissen der Antike im Westen ganz verloren gegangen wäre. Und Hospitäler, so rückwärtsgewandt ihre Methoden gewesen sein mögen, entstanden auch aus der Motivation christlicher Nächstenliebe.
Doch es gab eben auch Männer wie Bernhard von Clairvaux, der sagte, Ärzte aufzusuchen und Arzneien einzunehmen sei »wider die Religion und unlauter«. Ein gängiger Spottspruch des Mittelalters lautete: ubi tre physici, dui athei. Ja, man spottete in Latein, das war damals hip. Der Satz heißt übrigens übersetzt: »Unter drei Ärzten sind zwei Atheisten.« Die Haltung der Kirche war deutlich: Krankheiten und Seuchen sind Strafen des gerechten Gottes, und der Körper ist der Seele unterzuordnen. Daher hatte sich das Heilen kirchlichen Vorschriften unterzuordnen, wie etwa dem Laterankonzil von 1215, in dessen Folge Ärzte offiziell eine kirchliche Genehmigung zur Behandlung benötigten.
Im Hochmittelalter jedoch begann auch ein Umdenken in der Medizin, ganz vergleichbar mit Entwicklungen, die wir in anderen Feldern noch sehen werden. Einige Gelehrte, wie Alphanus, gingen auf Reisen nach Konstantinopel und brachten das dort erhaltene Wissen der griechischen Antike mit zurück in den Westen. Und wie dringend benötigt diese Wende war, kann man vielleicht am besten daran ablesen, wie Außenstehende den Stand der Medizin im Abendland wahrgenommen haben. So forderte ein westlicher Statthalter in Muneitra im Libanongebirge eines Tages beim dortigen Emir von Cheyzar einen Arzt für einen Notfall an. Der Emir kam der Bitte nach, jedoch war der Arzt schon nach wenigen Tagen wieder da. Darüber verwundert ließ sich der Emir schildern, was geschehen war. Der Arzt hatte einen Ritter mit einem Abszess am Bein behandelt, indem er ihm einen Salbenverband auflegte. Bald schon schwoll das entzündete Bein ab, und der Arzt war optimistisch. Zumindest bis ein westlicher Mediziner dazukam und behauptete, der arabische Arzt verstünde nichts vom Heilen. Vor den entsetzten Augen des arabischen Arztes ordnete der Franke eine Amputation des Beines durch einen anderen Ritter mit einer Axt an. Der Patient starb noch während der laienhaften Durchführung, und der völlig fassungslose arabische Arzt wurde wieder nach Hause geschickt.
Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Epoche, die wir als Mittelalter bezeichnen, war nicht überall auf der Welt gleichmäßig finster. Aber in Europa war es in vielen Bereichen so zappenduster, dass man die eigene Barbarei vor lauter Idiotie nicht sehen konnte. Wobei natürlich nicht alles barbarisch anmutet, manches ist aus heutiger Sicht einfach nur skurril. Im Mittelalter glaubte man zum Beispiel, dass man die Pest mit Hühnern behandeln könne. Dazu wurden die Hinterfedern der Hühner gerupft und das Huhn sitzend auf dem Kopf getragen. So sollte das Gift aus dem Körper gezogen werden. Eventuell gab es einfach auch sonst sehr wenig zu lachen zur Zeit des Schwarzen Todes.
Woher kam diese Methode, die tatsächlich einige Jahrhunderte populär war? Nun, ihr Ursprung könnte bei Avicenna liegen, einem persischen Gelehrten und Arzt, der auch die westliche Medizin nachhaltig beeinflusste. Nur, falls Sie gerade geglaubt haben, ich wollte hier den Eindruck erzeugen, im Westen seien alle dumm gewesen und im Orient hätten alle vor lauter Erleuchtung einen Schwarm Motten als Stalker gehabt. Nein, Avicenna mag ein Universalgenie gewesen sein, aber die Sache mit dem nackten Hühnerhintern auf dem Kopf, die war wirklich albern.
Aber nicht, dass Sie jetzt glauben, damit sei irgendein Tiefpunkt erreicht gewesen und von hieran ginge es bergauf. Selbst mit dem Ende des Mittelalters wurde es kein bisschen besser. Eher im Gegenteil. Ein Beispiel gefällig? Der britische König Charles II. fühlte sich am Morgen des 2. Februar 1685 nicht wohl und war auch etwas blass um die Nase. Gemäß dem medizinischen Standard ließ man erst mal 450 Milliliter seines Bluts ab. Als das nicht direkt half, verschrieben ihm die besten Ärzte des Landes im Laufe der nächsten vier Tage sechzig weitere Behandlungen, unter anderem Steine aus einem Ziegenmagen und Schnaps aus einem Menschenschädel. Man rasierte seinen Schädel und legte heiße Eisen auf, um schlechte Energie aus seinem Gehirn zu ziehen. Andere Teile seines Körpers verbrannte man mit heißen Bechern. Man verabreichte ihm Brechmittel. Und natürlich mehrere weitere Aderlässe. Nach vier Tagen starb der König, und die Ärzte waren überrascht, dass ihre besten Methoden kein besseres Ergebnis hervorgebracht hatten. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal hervorheben, dass der ursprüngliche Grund für diese Behandlung ein morgendliches Unwohlsein war. Vielleicht war König Charles ja einfach schwanger. Wir werden es nicht mehr herausfinden können.
Wenn Ihnen das schon zu eklig war, dann überspringen Sie einfach den folgenden Absatz. Ehrlich, vertrauen Sie mir. Sie werden von einigen wirklich unschönen Details verschont. Allerdings verpassen Sie dann auch einen wirklich unglaublichen Vorgang, der zwei der bekanntesten Komponisten der klassischen Musik verbindet.
John Taylor galt als der Starchirurg seiner Zeit. Am 30. März 1750 behandelte er Johann Sebastian Bach wegen dessen Kurzsichtigkeit. Dazu – und jetzt wird’s etwas eklig – macht er einen Einschnitt in dessen Augen und injizierte eine Mischung aus Taubenblut, Salz und Blei. Nach einigen Tagen wurde der Eingriff wiederholt. Bach verlor in der Folge sein Augenlicht und litt an extremen Schmerzen, vier Monate später starb er. Das hielt Taylor nicht davon ab, acht Jahre später auch Georg Friedrich Händel mit derselben Methode zu behandeln und blind zu machen. Ja, Sie haben richtig gelesen, derselbe Arzt hat mit derselben Methode erst Bach und dann Händel blind gemacht.
Doch natürlich gab es in der Medizingeschichte nicht nur Idioten, das muss klar gesagt werden. Im Gegenteil, es ist unglaublich, welch große Geister die Medizin zu ihren heutigen Möglichkeiten gebracht haben. Und man kann nur mutmaßen, dass wir noch viel weiter wären, wenn sie dabei nicht von Narren umgeben gewesen wären. Nehmen wir Ignaz Semmelweis. Er war Mitte des 19. Jahrhunderts Arzt in Wien, und ihm fiel im Krankenhaus ein deutlicher Unterschied zwischen zwei Gebärstationen auf: In der einen kam es zu deutlich weniger Todesfällen und Komplikationen bei und nach Geburten. Er bemerkte, dass in der anderen Station die Ärzte oft mit ungewaschenen Händen zu Werke gingen. Also stellte er die Theorie auf, dass es vielleicht gut wäre, wenn Ärzte sich vor der Arbeit gründlich die Hände reinigen würden. Klingt einleuchtend, oder?
Semmelweis wurde jedoch für diese Idee nicht nur ausgelacht, sondern sein Hang zur Reinlichkeit führte schließlich dazu, dass er entlassen und kurz darauf, am 30. Juli 1865, unter Vorwänden in eine Irrenanstalt gelockt und dort eingesperrt wurde. Er starb zwei Wochen später. Heute wissen wir, welch wichtigen Beitrag seine Erkenntnisse darstellten und können nur mutmaßen, wie viele Leben hätten gerettet werden können, wenn man direkt auf ihn gehört hätte. Und wir reden hier nicht über das Mittelalter, das ist gerade mal 150 Jahre her. Aber gut, da ist auch wieder Captain Hindsight im Spiel, diesmal begleitet von dem Umstand, dass es uns heute regelrecht bizarr erscheint, dass sich nicht mal die Ärzte vor der Arbeit die Hände gewaschen haben. Gott behüte, was in den damaligen Fast-Food-Restaurants los gewesen sein muss.
Noch etwas später, im Jahr 1897, reichte ein junger Mediziner namens Ernest Duchesne eine Doktorarbeit ein, die auf einer Beobachtung aus einem Pferdestall beruhte. Genauer gesagt hatte Duchesne erstaunt festgestellt, dass einige arabische Stallknechte die Sattel der Pferde in einem dunklen feuchten Raum aufbewahrten, damit sich an ihnen Schimmelpilz bilden konnte. Duchesne fragte natürlich nach, warum sie das täten, und die Stallknechte erklärten ihm, dass damit die wund gescheuerten Rücken der Pferde schneller heilten.
Was die Stallknechte durch Zufall entdeckt hatten, prüfte Duchesne im Labor an erkrankten Meerschweinchen. Nach Verabreichung einer Lösung aus den Schimmelpilzen wurden sie alle gesund: Duchesne hatte das Antibiotikum entdeckt. Er fasste seine Forschungsergebnisse zusammen und reichte sie beim Institut Pasteur in Paris als Doktorarbeit ein. Was ist denn daran dumm, fragen Sie? Nun, so weit nichts. Außer, dass das Institut die Doktorarbeit ablehnte, denn Duchesne war erst 23 Jahre alt und bis dahin ein völlig Unbekannter. Seinem Drängen auf weitere Forschung in dieser Richtung kam man ebenso wenig nach, und ihn selbst hielt in der Folge der Militärdienst von dieser Betätigung ab. Es brauchte gut dreißig Jahre und eine weitere eher zufällige Beobachtung, um der Menschheit die Vorzüge des Antibiotikums zuteilwerden zu lassen. Und damit endlich ein wirksameres Mittel gegen die Pest als ein nackter Hühnerhintern. Es war Alexander Fleming, dem bei seiner Forschung 1928 im Labor aus Versehen Schimmelpilze in eine Probe von Bakterien geraten waren. Er forschte weiter, entwickelte das Penicillin und hat damit unzähligen Menschen das Leben gerettet. Man darf nur nicht drüber nachdenken, wie viele Menschen zwischen 1897 und 1928 an bakteriellen Infektionen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen, wenn man damals der Jugend etwas mehr zugetraut hätte.
Eine Randnotiz sei noch hinzugefügt: Womöglich gab es schon vor tausend Jahren Medizin mit antibiotischer Wirkung. Im Jahr 2015 haben Historiker*innen und Mikrobiolog*innen gemeinsam einen Artikel veröffentlicht, der weltweit Schlagzeilen machte: A 1000 Year Old Antimicrobial Remedy with Anti-Staphylococcal Activity. In einer alten Handschrift hatten sie ein Rezept für eine Salbe entdeckt, das unter anderem auf Zwiebeln und Knoblauch basierte. Als sie die beschriebene Salbe herstellten, hatte diese zumindest im Labor sogar Wirkung gegen multiresistente Bakterien. Vielleicht haben wir nicht nur die Jugend von damals unterschätzt, sondern auch das Mittelalter.
Es ist zu bezweifeln, dass das mittelalterliche Wundermittel aus Zwiebeln und Knoblauch besonders gut roch. Vermutlich wäre Wilhelm Fliess kein großer Fan davon gewesen, denn bei ihm stand die Nase gewissermaßen im Mittelpunkt – nicht nur des Gesichts. Er wurde jedoch nicht ganz so berühmt wie ein Freund von ihm. Sigmund Freud und Wilhelm Fliess standen nämlich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in regem Austausch, denn Fliess war einer der wenigen, der schon früh offen war für Freuds revolutionäre Ideen. Allerdings entzweiten sich die beiden schon bald über die Frage, ob die Entwicklung von Neurosen psychologische oder physische Ursachen habe. Fliess vertrat den überraschenden Ansatz, dass es eine direkte Verbindung zwischen Nase und Genitalbereich gäbe. Unter anderem nahm er an, dass Coitus interruptus und Selbstbefriedigung in der Nase einen charakteristischen Fernschmerz verursachten. So erklärt sich vermutlich auch, dass Fliess annahm, man könne sexuelle Dysfunktion bei Frauen behandeln, indem man Kokain in ihren Nasen anwendet. Eine Aussage, die man wohl eher einem zwielichtigen Zuhälter zutraut als einem Psychologen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es damals nicht unüblich war, mit Kokain zu experimentieren. Auch Sigmund Freud wagte recht häufig den Selbstversuch und entdeckte unter anderem seine Verwendungsmöglichkeit zur lokalen Betäubung. Der Versuch, einen anderen Freund, den Physiologen Ernst Fleischl von Marxow, mithilfe von Kokain von seiner Morphiumsucht zu befreien, war hingegen weniger von Erfolg gekrönt. Von Marxow wurde rückfällig und war, aus heutiger Sicht wenig überraschend, von da an auch noch kokainsüchtig.
Dieser Fall ist nur eines der vielen Beispiele für medizinische Versuche, die man mit dem Wissen der Gegenwart betrachtet und denkt: Das hätte man doch damals auch wissen können. Aber das ist eben nicht der Fall, das ist nur wieder Captain Hindsight. Was uns heute als selbstverständlich gilt, mussten Wissenschaftler*innen über Jahrtausende herausfinden. Das gilt natürlich auch und insbesondere im Gesundheitsbereich. Mit dem fortschreitenden medizinischen Wissen der Menschheit gibt es stets neue Möglichkeiten, die Grenzen des Machbaren neu auszuloten. Die Wissenschaft läuft auf Hochtouren, und es werden neue Mittel und Therapien entwickelt. Da ist es durchaus okay und gewünscht, wenn sich manche Hypothesen als falsch herausstellen.
Doch es gibt bei aller Freude an der Experimentierlust und am Scheitern auch in der Medizingeschichte Dinge, bei denen klar ist: Das hätte nicht sein müssen. So versuchte zum Beispiel 1927 der sowjetische Wissenschaftler Ilya Iwanowitsch Iwanow ernsthaft eine neue Kreatur durch Kreuzung von Menschen und Schimpansen zu erzeugen. Das ist nicht nur aus heutiger Sicht gruselig, sondern war auch schon damals keine gute Idee. Vielleicht denken Sie jetzt: Moment mal, sind wir nicht 2020 wieder genau an der Stelle, genetisch ein Mittelding zwischen Mensch und Tier zu schaffen, genauer gesagt eine Chimäre aus Mensch und Schwein. Und ja, Sie haben natürlich recht, und auf den ersten Blick klingt das ebenso gruselig wie die Ideen von Iwanow. Allerdings steckt eine andere Idee dahinter als Iwanows Wunsch, Darwins Theorien der nahen Verwandtschaft zwischen Schimpansen und Menschen auf eine sehr befremdliche Weise zu beweisen. Heute geht es den Wissenschaftler*innen darum, Schweine genetisch so zu manipulieren, dass ihnen menschliche Organe wachsen. Diese könne man dann zur Organtransplantation nutzen, so der Gedanke. Über die Frage, ob das ethisch vertretbar ist, kann man sicherlich ein eigenes Buch schreiben und stundenlang mehr oder weniger entspannt diskutieren. Besonders entspannt, wenn man gerade nicht auf eine Spenderleber wartet.
Die Gentechnik ist ein überaus spannendes Feld und verspricht neben quasi unendlichem Diskussionsstoff für Ethikseminare in naher Zukunft die ein oder andere medizinische Revolution. Insbesondere seit der Entwicklung von CRISPR/Cas9, einer neuen Technik zur Manipulation von Genen, die eine massive Vereinfachung darstellt. CRISPR/Cas9 wird auch die Gen-Schere genannt, denn man kann mit dieser Technik quasi einzelne Abschnitte aus Gensequenzen ausschneiden und andere einsetzen, was weitaus präziser und einfacher ist als die vorher angewendeten Methoden wie etwa der Einsatz von Chemikalien und/oder Bestrahlung. Dadurch hat sich in den letzten Jahren die Entwicklung exponentiell beschleunigt und die Fantasien und Hoffnungen der Wissenschaftler*innen beflügelt. So gibt es nicht wenige, die davon ausgehen, dass wir in naher Zukunft in der Lage sein werden, Krebs zu heilen und damit eine der häufigsten Todesursachen zu besiegen.
Doch auch die Gentechnik begann mit einigen Startschwierigkeiten. Am 11. Dezember 1951 wies der Direktor des Cavendish Labors der Universität Cambridge nach einer gescheiterten Demonstration ihrer Ergebnisse zwei seiner Mitarbeiter an, ihre Forschungen mit sofortiger Wirkung einzustellen. Dabei waren Francis Crick und James Watson den Geheimnissen der DNA auf der Spur, und Watson hielt später fest, dass der Direktor ganz offensichtlich nicht einmal wusste, wofür das Kürzel DNA stand. Als sie einige Jahre später die Arbeit wiederaufnahmen, kamen sie der Struktur der DNA auf die Spur, der wohl wichtigsten biologischen Erkenntnis des 20. Jahrhunderts. Apropos DNA: Wussten Sie eigentlich, dass Menschen rund 50 Prozent ihres Erbguts mit Bananen teilen? Ich finde, dass erklärt einiges. Auch, wenn ich neuerdings ein komisches Gefühl dabei habe, in eine Banane zu beißen.
Die genetische Verwandtschaft zur Banane gilt auch für die klügsten Menschen. Und dass Klugheit nicht vor Dummheiten schützt, haben wir ja bereits gelernt. Anders kann man es kaum erklären, was 1977 einer Frau namens Tina Christopherson passierte. Bei ihr war ein IQ von 189 gemessen worden, einer der höchsten dokumentierten Werte. Doch Christopherson war von der ständigen Angst begleitet, sie könnte an Magenkrebs sterben wie zuvor ihre Mutter. Das ist natürlich eine nachvollziehbare Sorge, zumal solche Ängste sich nicht immer rational wegargumentieren lassen. Auch nicht mit einem himmelhohen IQ. Stattdessen versuchte Christopherson einen anderen Weg der Prävention: Sie trank sehr viel Wasser. Sehr, sehr viel Wasser, um genau zu sein. Es wird berichtet, dass sie teilweise bis zu fünfzehn Liter pro Tag getrunken haben soll. Nun soll man ja durchaus viel trinken, aber es ist mit Wasser wie mit allem anderen: Die Dosis macht das Gift. Und fünfzehn Liter sind definitiv zu viel. Sie führten zu einem Nierenversagen, an dem Christopherson starb. Nun konnte man schon 1977 wissen, dass das bei der Aufnahme von derartig viel Wasser passieren würde. Und in Anbetracht eines IQs von 189 hätte Christopherson das vielleicht sogar selbst klar sein müssen. Aber wenn eben eine starke Gegenmotivation wie Todesangst vorhanden ist, dann hat auch der beste Verstand das Nachsehen.
Apropos dummer Tod eines Genies: 1983 starb der berühmte Autor Tennessee Williams, als er sich nach hinten lehnte, um Nasentropfen zu nutzen und ihm dabei der Deckel des Nasensprays in den Hals fiel. Das war eher ein tragisches Missgeschick, aber trotzdem ein wirklich dummer Tod. Dabei war es eben ausgerechnet Tennessee Williams, der einen der meistzitierten Sätze zum Thema Dummheit geprägt hat: »Jede Dummheit findet einen, der sie macht.« Uff.
Statt Plastikdeckeln sollte man definitiv lieber Gemüse zu sich nehmen, wenn man gesund leben will. Wie sagte schon der weise Gelehrte Helge Schneider? »Tu mal lieber die Möhrchen!« Darauf achtet teils sogar die Regierung, wenn es etwa um das Menü in Schulkantinen geht. Mal mit mehr, mal mit weniger guten Ideen. Unter Ronald Reagan wollte die US-Regierung beispielsweise durchsetzen, dass Ketchup im Schulessen als Gemüsebeilage gilt. Gemüse ist gesund und wichtig, aber so hätte sich viel Geld sparen lassen. Allerdings wurde nach einer großen öffentlichen Debatte Abstand von diesem Plan genommen. So können die Schüler*innen in den USA heute leider nicht sagen: Ketchup ist mein Gemüse.
Apropos Ernährung, eine kleine Anekdote am Rande: Einem belgischen Fernfahrer wurde von seinem Arzt gesagt, er ernähre sich unausgewogen und bräuchte mehr Eisen. Dass der Mann umgehend in einen Haushaltswarenladen ging und sich eine Packung Nägel kaufte und schluckte, kann man ihm da kaum vorwerfen, oder? Mit seinen inneren Verletzungen kam er sofort ins Krankenhaus. Beim nächsten Mal wird der Mann nicht noch mal was Spitzes essen, sondern lieber Löffel oder eine Pfanne. Wenn Sie einen Löffel essen wollen, sagen Sie aber bitte Uri Geller nichts davon, er liebt die Dinger.
Deshalb lieber noch mal kurz zurück zu Ronald Reagan: Berüchtigt ist auch seine Aussage, Bäume würden mehr zur Umweltverschmutzung beitragen als Autos. Das klingt erst mal, als hätte ihn die Unfähigkeit zur Lüge nicht davon abgehalten, Unsinn zu erzählen. Und richtig, bis heute werden Witze über dieses Zitat gemacht. Allerdings, und das mag Sie jetzt erschrecken, hatte Reagan gar nicht wirklich unrecht: Bäume erzeugen zum Beispiel Ozon. Klar, das ist in Bodennähe nicht übermäßig schädlich, aber es ist da. Und sicher, Bäume filtern CO2, festigen durch ihre Wurzeln den Boden und sehen fesch aus. Aber trotzdem: Reagans Aussage ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Dabei hätte allen klar sein müssen, dass Ronald Reagan die Wahrheit gesagt hatte, denn, wie er einst öffentlich bekannte: »Ich bin nicht klug genug, um zu lügen.«
Auf Dauer noch ungesünder, als sich einen Sack Nägel in den Hals zu kippen, ist Kettenrauchen. Also nicht Ketten rauchen, Kettenrauchen. Das ganze Metall-Thema war da vielleicht etwas missverständlich. Vergessen Sie das mit der Kette: Rauchen ist auch so ungesund, das weiß man spätestens, seitdem mindestens drei der Darsteller des berühmten Marlboro-Manns an den Folgen des Rauchens gestorben sind. Am 28. November 2000 veröffentlichte das Tabakunternehmen Philip Morris jedoch eine Studie, die es in Tschechien hatte durchführen lassen. Darin wurde beschrieben, dass Rauchen eine positive Auswirkung auf die Wirtschaft des Landes hat. Wenn man die Kosten zur Behandlung von rauchbedingten Krankheiten und den Steuerausfall durch früh verstorbene Raucher*innen gegen das Geld, das der Staat an Renten und Altenpflege spare, aufrechne, käme man auf eine Ersparnis von 147 Millionen Dollar, so die Studie. Da Philip Morris etwa 80 Prozent des in Tschechien gerauchten Tabaks herstellte, war man offensichtlich recht stolz auf diese Zahlen und publizierte sie flächendeckend. Es klang fast, als könnte man seinen Staat aus der Krise rauchen.
Im Nachhinein versuchte der Firmensprecher Robert Kaplan zu beschwichtigen, es habe sich ja nur um »eine Wirtschaftsstudie, nicht mehr und nicht weniger« gehandelt. Vor allem wolle man nicht den Eindruck erwecken, die Gesellschaft könne einen Nutzen aus den Leiden ziehen, die das Rauchen verursache, erklärte er weiter. Wie stellte er sich das vor? »Hört mal, ihr spart eine Menge Geld, aber wir sagen euch das nicht, damit ihr denkt, das wäre zu eurem Vorteil!« Oder meinte er eher, dass es nicht die Gesellschaft sei, die in erster Linie am Leiden der Raucher*innen profitiere, sondern der Tabakkonzern Philip Morris. Andererseits muss dieser ja auch gefühlt alle halbe Stunde einen neuen Marlboro-Mann anheuern, das geht bestimmt auch ins Geld. Oder, wie die Schauspielerin Brooke Shields es mal auf den Punkt brachte: »Rauchen bringt dich um. Bist du tot, dann hast du einen sehr wichtigen Teil deines Lebens verloren.« Danke für den Hinweis, Brooke.
Eine weitere Dummheit bringen die Autoren Christian Schiffer und Christian Alt in ihrem Buch mit dem reizenden Titel Angela Merkel ist Hitlers Tochter – im Land der Verschwörungstheorien elegant auf den Punkt. Oft werde man in Facebook-Gruppen mit dem Hinweis konfrontiert, die eigene Mutter habe als Kind Masern gehabt und auch überlebt: »Das Problem ist nur: Wenn die eigene Mutter als Kind an den Masern gestorben ist, gibt es keine Nachkommen, die das dann auf Facebook posten können«, so Schiffer und Alt weiter.
Nicht nur, aber auch und insbesondere im Gesundheitsbereich wird offenbar gerne mit Beispielen aus dem persönlichen Umfeld argumentiert. Vermutlich kennt jede und jeder die Geschichte eines Kettenrauchers, der beinah hundert Jahre alt geworden wäre. Wenn er nicht mit 35 Jahren an Lungenkrebs gestorben wäre. Natürlich funktioniert das in beide Richtungen, und es ist nur sehr schwer möglich, auf dieser persönlichen Ebene etwas Argumentatives vorzubringen, ohne eben persönlich zu werden. Oder persönlich genommen zu werden. Also lassen wir mal eben unsere Mütter aus dem Spiel und auch den Cousin dritten Grades, der durch Handauflegen von seiner Oligophrenie geheilt wurde. Betrachten wir mal einen Moment ein paar Fakten.
Nach den Plänen der Weltgesundheitsorganisation WHO sollten die Masern bis 2020 ausgerottet sein. Die Zahl der Infektionen nimmt jedoch seit einigen Jahren wieder deutlich zu, im Jahr 2018 um mehr als 30 Prozent. Und um den Ernst der Lage zu unterstreichen, der hinter dieser »Kinderkrankheit« steckt: Im Jahr 2017 allein gab es weltweit 110 000 Tote durch Masern. Dabei war man bis vor Kurzem auf einem guten Weg: Nach Schätzungen der WHO sind allein zwischen 2000 und 2017 21,1 Millionen Tote durch flächendeckende Masern-Impfungen verhindert worden, die Infektionsrate sank tatsächlich um 80 Prozent. Was ist also passiert?
Nun, in allererster Linie veröffentlichte 1998 der Brite Andrew Wakefield in der Zeitschrift The Lancet einen Artikel, in dem er einen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus herstellt. In der Folge sank der Impfspiegel in Großbritannien massiv. Nun muss man wissen, dass Wakefield nur zwölf Kinder untersucht hatte. Erste Untersuchungen kleiner Gruppen sind in der Wissenschaft nicht unüblich, erfordern aber, bevor sie wirklich aussagekräftig sind, die Überprüfung ihrer Ergebnisse in größeren Studien. Eine Reproduktion von Wakefields Ergebnissen ist allerdings in der Folge nicht gelungen, im Gegenteil. Studien an Zigtausenden von Kindern haben keinen Zusammenhang herstellen können, ob in Kanada, Dänemark, Japan oder anderswo. Was man jedoch herausfand, war, dass Wakefield im Vorfeld der Studie Gelder von einer Gruppe Anwälte erhalten hatte, die einige der zwölf Kinder und deren Familien vertraten und eine Klage gegen den Hersteller des Impfstoffs vorbereiteten und dafür Belege benötigten, die die Studie liefern sollte. Als das ans Licht kam, wurde die Studie komplett zurückgezogen und Wakefield 2010 die Zulassung als Arzt entzogen. Er hat seine Fehler eingesehen und lebt nun zurückgezogen in einer Hütte in den schottischen Highlands, wo er Schafe züchtet.
Ich mach nur Spaß, natürlich hat sich Wakefield nicht zurückgezogen, im Gegenteil: Er ist inzwischen eine Art Galionsfigur der Bewegung der sogenannten Impfgegner, oder, noch euphemistischer: Impfskeptiker. Zu denen gehört seit einiger Zeit auch US-Präsident Donald Trump. Wie mächtig die Bewegung nach wie vor und trotz aller Gegenbeweise ist, sieht man daran, dass Masern nach wie vor und in wachsendem Maße ein Problem sind. Ich sag das noch mal ganz langsam: Eine Studie, deren Macher bestochen wurden und deren Ergebnisse widerlegt sind, ist bis heute so einflussreich, dass sie verhindert, dass die Masern ausgerottet werden. Stattdessen sterben weiterhin zigtausend Kinder pro Jahr, darunter nicht wenige, die noch zu jung für eine Impfung waren. Allein auf der Südseeinsel Samoa, auf der lediglich 200 000 Menschen leben, starben im Herbst 2019 bei einem Masernausbruch 42 Menschen, fast alles kleine Kinder. Was für eine Katastrophe. Gerade, weil sie so vermeidbar wäre.
Insbesondere in sozialen Netzwerken wie Facebook wird jedoch weiterhin ungebremst gegen Impfungen Stimmung gemacht; Gegenredner*innen werden niedergemacht und übel beschimpft. Obwohl das übrigens nicht so sein müsste, wie das soziale Netzwerk Pinterest vorgemacht hat. Nachdem die Plattform kritisiert wurde, weil sich dort viele Impfgegner*innen tummelten, verbot sie kurzerhand die Verbreitung solcher Inhalte. Und bevor Sie jetzt »Zensur« schreien, bedenken Sie bitte, dass die WHO die Impfgegner selbst inzwischen als weltweites Gesundheitsrisiko eingestuft hat, gemeinsam mit Dingen wie Ebola, Antibiotikaresistenzen und Luftverschmutzung. Nicht die Masern oder die Impfungen, sondern die Impfgegner*innen!
Und ja, ich weiß und alle anderen wissen auch, dass Impfungen Nebenwirkungen haben können. Aber erstens sind diese sehr überschaubar, zweitens bestehen diese ganz sicher nicht in Autismus, und drittens würden zumindest Masernimpfungen bald nicht mehr nötig sein, ebenso wenig wie Impfungen gegen Pocken: Die Menschheit könnte diese gefährliche Krankheit nämlich vergleichsweise einfach komplett besiegen. Es gäbe sie dann nicht mehr, damit wären ironischerweise auch Impfungen überflüssig. Wenn wir uns halt nur nicht so unglaublich dumm anstellen würden. Mal am Rande gefragt, selbst wenn Wakefields hanebüchene These wahr wäre: Was ist eigentlich so schlimm an Autismus, dass man lieber zigtausend Kinder sterben lässt?
Aber es gibt ganz aktuell Anlass zur Hoffnung, auch oder gerade weil die Zahlen sich weiter verschlechtern. In der ersten Hälfte 2019 sind die Masernfälle noch mal rapide angestiegen, laut WHO gab es in Europa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Verdopplung der Infektionen. Das Gesundheitsministerium plant nun, während ich diese Zeilen hier schreibe, im März 2020, also genau dann, wenn dieses Buch erscheint, die Masernimpfpflicht einzuführen. Wer weiß, vielleicht ist dieser Abschnitt also schon reif für den Papierkorb der Medizingeschichte, wenn Sie das lesen. Es wäre zu hoffen.
Wo ich mich gerade schon in Rage geredet habe: Soll ich vielleicht noch einen Absatz über Homöopathie hinterhersetzen? Unglaublich stark verdünnte Mittel, die allen Ernstes durch eine bestimmte, abgezählte und per Hand durchgeführte Schütteltechnik ihre Wirksamkeit erhalten sollen, jedoch (Überraschung!) laut Dutzenden wissenschaftlichen Studien nachweislich keine über den Placeboeffekt hinausweisende Heilwirkung haben?
Wie bitte, ich soll nicht alle Naturheilmethoden verdammen, weil Ihr Cousin dritten Grades mal durch Handauflegen von seiner Oligophrenie geheilt wurde? Was hat denn das … ne, Moment, Moment! Wissen Sie was? Vielleicht sollten Sie das Buch einfach nicht weiterlesen. Schneiden Sie alternativ eine stecknadelkopfgroße Ecke dieser Seite aus und lösen Sie diese in warmem Wasser. Die entstandene Lösung verdünnen Sie um 100 000 000 Grad, dann schütteln Sie das Ganze genau zwölfmal und pressen die erzeugte Lösung mit etwas Zucker zu einem winzigen Kügelchen. Schließlich werfen Sie dieses Kügelchen beim nächsten Vollmond in das nächstgelegene Fließgewässer und denken dabei ganz fest daran, dass Ihre Behandlungsmethoden von den Menschen der Zukunft weitaus lächerlicher gefunden werden als die altägyptischen Mittel gegen Haarausfall oder ein nacktes Huhn als Hut gegen die Pest.
Statt endlos verdünntem Wasser sollten wir vielleicht lieber mit dem Kopf schütteln – aber nicht zu sehr, damit das Huhn nicht herunterfällt! Ich freu mich schon auf die heiteren Zuschriften von Homöopathie-Fans, die schon in der Vergangenheit durch Shitstorms gegen Kritiker*innen gezeigt haben, wie gut sie vernetzt sind. Aber wissen Sie, was noch besser vernetzt ist? Die Nervenzellen im Gehirn im Kopf, den ich gerade schüttele. Obwohl es über einhundert Milliarden Zellen sind, ist jede einzelne mit jeder anderen über maximal vier Ecken verbunden. Nicht zuletzt deshalb ist unser Gehirn der komplexeste Gegenstand, den die Menschheit kennt. Nun ist unser Gehirn aber natürlich auch die Instanz in uns, die Dinge kennt, und vielleicht kann es einfach nichts Komplexeres als sich selbst erkennen. Oder was meinen Sie? Kann unser Gehirn einen Gedanken denken, der so komplex ist, dass er unser Gehirn übertrifft? Denken Sie mal darüber nach, am besten am Gehirn vorbei.
Was die Medizin sicher weiß, ist, dass bestimmte Areale im Gehirn für bestimmte Denkleistungen verantwortlich sind. Das ist schon recht früh aufgefallen, weil bei manchen Unfällen bestimmte Teile des Gehirns verletzt wurden und die überlebenden Patient*innen daraufhin bestimmte Dinge nicht mehr konnten. Und das trotz aller Vernetzung und der Tatsache, dass manche Bereiche des Gehirns unter bestimmten Umständen in der Lage sind, die Aufgaben anderer Bereiche zu übernehmen. Vielleicht haben Sie schon mal vom Broca- und Wernicke-Areal gehört. Dies sind die beiden Sprachzentren im Gehirn. Es gibt auch ein Areal im Hirn, das für die Gesichtserkennung zuständig ist, es trägt den Namen Gyrus Fusiformis. Das bei mir sehr ausgeprägte Areal, welches dumme Wortspiele liebt, heißt hingegen Fußförmiges Gyros. Es gibt allerdings auch eine sehr verbreitete Fähigkeit, für die es kein eigenes Areal im Gehirn gibt. Und das Verrückte ist, dass ich weiß, dass Sie das können, auch wenn wir uns noch nie getroffen haben. Mehr noch, ich weiß, dass Sie es jetzt gerade machen. Bevor Sie jetzt aus einem Missverständnis und aus Trotz heraus aufhören zu atmen: Das meine ich nicht. Ich rede vom Lesen.
Tatsächlich ist Schrift ja eine vergleichsweise neue Erfindung, und wenn wir lesen, passiert im Prinzip eine komische Mischung aus optischer Wahrnehmung und Sprache. Um diese Fähigkeit zu erwerben, beanspruchen wir einen Teil unseres Gehirns, der eigentlich dafür nicht vorgesehen war, insbesondere das Brodmann Areal 17. Es gibt Neurologen, wie etwa Ernst Pöppel, die meinen, dass man deshalb sagen könnte, dass Lesen uns Teile unserer Denkfähigkeit raubt und uns auf diese Art quasi ein bisschen dümmer macht. Ich halte hingegen für möglich, dass diese allzu steile These aufgestellt wurde, damit mehr Leute Herrn Pöppels Bücher lesen. Was ja einer gewissen Ironie nicht entbehrte.
Weniger heiter ist eine »Therapie«, die ein Arzt namens António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz entwickelt hat, nachdem er erfuhr, dass Gedanken und Emotionen klar im Gehirn zu verorten sind. Das brachte ihn nämlich auf die Idee, dass man Menschen durch die absichtliche Zerstörung eines Teils des Gehirns, der auf unerwünschte Weise funktionierte, kurieren könnte. Diese Methode nennt sich Lobotomie, und sie wurde insbesondere durch den Amerikaner Walter Freeman verbreitet, der sie »verbesserte«, sodass sie ein Laie, mit lokaler Betäubung und ohne Narben am Schädel zu hinterlassen, durchführen kann. Überspringen Sie den nächsten Absatz, wenn Sie einen empfindlichen Magen haben.
Freemans Methode war es, mit einem schmalen, sehr spitzen Gegenstand durch das Auge des Patienten nach oben zu stechen, durch den dünnen Knochen an der Augenhöhle in den Schädel einzudringen und nach Gefühl weiter zu bohren, bis man eben dachte, an der richtigen Stelle zu sein. Dann zerstörte man durch ruckartige Bewegungen Teile des frontalen Kortex. Zurück blieb meist nur ein blauer Fleck – und ein apathischer Patient oder eine apathische Patientin. Diese konnten in der Regel nicht mehr wirklich viel, aber stellten damit eben auch kein Problem mehr für sich und ihre Umwelt dar. Wenn Sie meinen, das sei aber eine ziemlich grobe Methode, dann seien Sie getrost, dass das selbst Walter Freeman höchstpersönlich auch so gesehen hat: »Die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Fantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft.« Was man so alles als Erfolg bezeichnen kann, ist schon manchmal erstaunlich. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Moniz für seine Erfindung tatsächlich den Nobelpreis in Medizin erhielt. Eine Weile lang gab es einen regelrechten Hype um die Lobotomie, nicht zuletzt, weil Walter Freeman sie gekonnt vermarktete.
Der vielleicht dümmste Auswuchs dieser »Mode« war es, als 1967 drei Wissenschaftler in einem Leserbrief an das Journal of the American Medical Association schrieben, die Ursachen der damaligen Unruhen in Detroit lägen in einer »fokalen Hirnstörung«, die man operativ entfernen sollte, wenn man weitere Unruhen verhindern wollte. Gemeint waren übrigens Proteste der Bürgerrechtsbewegung. Was die Autoren also scheinbar sagen wollten: Nicht-weiße Menschen sind eigentlich okay, aber wenn sie Krawall machen, zerstört ihre Gehirne und macht sie zu roboterähnlichen, kontrollierbaren Individuen.
Mir persönlich hilft der Gedanke nur eingeschränkt weiter, dass Lobotomie inzwischen glücklicherweise verboten ist, meinen Glauben an die Menschheit wiederzufinden. Vor allem habe ich nach diesem Kapitel irgendwie so gar keine Lust mehr, krank zu werden. Denn Gründe, nicht krank werden zu wollen, gibt es aktuell immer noch genug. Heutzutage sind die Zeitungen gut gefüllt mit Skandalen rund um angebliche Behandlungsfehler, Unfälle in Krankenhäusern oder andere Fehlleistungen von Ärzt*innen. Oft kommt es dann zu aufsehenerregenden Prozessen, denn die Mediziner*innen lassen sich scheinbar ungern Vorwürfe gefallen. Nicht zuletzt deswegen kursiert das Klischee der Halbgötter in Weiß. Nun ist es sicher so, dass Patient*innen nicht immer im Recht sind, wenn sie sich über Ärzt*innen beklagen. Und nicht alle Fehler, die tatsächlich passieren, haben dramatische Konsequenzen. Doch es ist auch klar, dass es nicht vermeidbar ist, dass manchmal gravierende Fehler vorkommen. Und es gibt eine erstaunliche Studie dazu, wie man am besten damit umgehen kann.
Moralisch betrachtet ist es recht einfach: Wer einen Fehler macht, sollte in der Lage sein, diesen zuzugeben und so den Verarbeitungsprozess auf beiden Seiten zu ermöglichen. Doch es zeigt sich, dass es womöglich auch aus finanzieller Sicht viel besser für eine Klinik ist, Fehler einzugestehen. In einem Fachartikel dazu schildern Richard Boothman und seine Kolleg*innen, wie die Universitätsklinik von Michigan ab 2001 anfing, ihren Umgang mit geschädigten Patient*innen und Vorwürfen von Behandlungsfehlern komplett neu aufzustellen. Es mag kontra-intuitiv erscheinen, aber ihr Modell namens Offenlegung und Angebot basiert auf Eingeständnissen und Transparenz, statt auf strikter Verteidigung des eigenen Standpunkts. Es zeigte sich in der Folge, dass dadurch die Prozesskosten und auch die Schadensersatzsummen massiv gesenkt wurden. Mehr noch, es scheint, der generelle Umgang zwischen Ärzt*innen und Patient*innen hat sich deutlich verbessert.
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei John Taylor geholfen hätte, nachdem er Johann Sebastian Bach Blei und Taubenblut ins Auge injiziert hatte. Aber einen Versuch wäre es vielleicht wert gewesen, denn wir machen alle Fehler, so viel ist klar. Dumm ist es nicht, das zuzugeben, sondern das zu bestreiten.