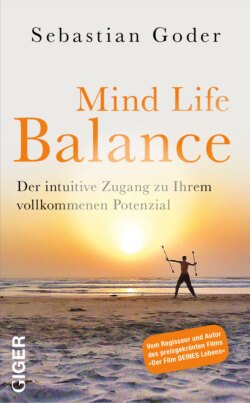Читать книгу Mind life balance - Sebastian Goder - Страница 13
Die Kraft innerer Bilder Rettung vor der Stasi
ОглавлениеBis zu meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr lebte ich im Osten Deutschlands. Mit 20 Jahren stellte ich einen sogenannten Ausreiseantrag, um die DDR zu verlassen. Sie war damals ein geschlossenes System, das seine Einwohner gefangen hielt, um nicht im Massenexodus unterzugehen. Seit meinem 16. Lebensjahr wollte ich dieses Land um jeden Preis verlassen. Mein Vater war als Professor ein sogenannter Reisekader und durfte zu internationalen Kongressen ins westliche Ausland fahren. Meine Mutter, meine Schwester und ich blieben dafür als »Fleischpfand« im Land, damit mein Vater einen Grund hatte, zurückzukehren. Da ich mir auf der Flucht nicht in den Rücken schießen lassen wollte, stellte ich einen Ausreiseantrag. Er konnte genehmigt werden oder auch nicht. Ich war damit der Willkür des Staates ausgesetzt.
Um den Vorgang der Ausreisegenehmigung zu beschleunigen, veranstalteten meine Freunde und ich regelmäßig »staatsfeindliche« Aktionen. Entweder wir spielten mit unserer Theatergruppe Stücke unliebsamer DDR-Autoren oder wir setzten uns auf die Straße und provozierten. Damit wollten wir erreichen, dass wir als »unliebsame Personen« schneller in den Westen abgeschoben werden.
Eine dieser Aktionen, ich war inzwischen 23 Jahre alt, sollte an einem Mittwochmittag um 13:00 Uhr stattfinden. Man muss wissen, dass jeden Mittwochmittag um 13:00 Uhr in der gesamten DDR die Sirenen ertönten. Eine Maßnahme, die nicht nur zur Überprüfung der Funktionalität der Sirenen stattfand, sondern jedes Mal die Macht des Staates über seine Bürger demonstrierte. Ältere Einwohner des Landes erinnerte das an Kriegsszenarien wie Fliegeralarm und die darauf folgenden Bombenabwürfe. Nicht wenige von ihnen litten nach wie vor an starken Kriegstraumata.
Wir planten also, an einem Mittwochmittag um ein Uhr im Zentrum der Stadt ein kleines Happening zu veranstalten. Wir hatten vor, pünktlich um 13:00 Uhr, wenn die Sirenen ertönten, uns alle flach auf den Boden zu werfen und »Fliegeralarm« zu spielen. Wir wollten so daran erinnern, was die Sirenen eigentlich auslösten. Nun ja, wir waren jung.
Besagter Mittwoch brach an und ich legte mir eine Zahnbürste und einen Schlafanzug zurecht. Man konnte ja nie wissen, ob man abends wieder nach Hause kam oder verhaftet war.
Genau dazu sollte es an diesem Mittwoch schneller als erwartet kommen. Um neun Uhr klopfte es laut an meiner Wohnungstür. Ich hörte vor der Tür eine Stimme in bestem Sächsisch bellen: »Herr Godaa, machen Se uff, mir wissen, dass Se da sinn.« Ich hatte außen auf meiner Wohnungstür einen TUI-Aufkleber, auf dem in großen Lettern stand: »Nix wie weg hier.« Als ich die Tür öffnete, kratzte einer der drei Herren in Zivil bereits am Aufkleber: »Un das hür gommd ab.«
»Sind Sie der Hauswart?«, entfuhr es mir ein wenig zu rasch. Der Herr verstand selbstverständlich keinen Spaß. »De Witze wern Ihn noch vorgeen. Gommse mit zur Glärung eines Sachvohalts.«
Da wurde ich also in einem Stasi-Wagen durch die halbe Stadt kutschiert, um in der Keibelstraße, der damaligen Zentrale der Staatssicherheit, abgeliefert zu werden. Ich muss nicht betonen, dass mir die Witze vergingen. Es gab in der DDR keinerlei Rechte für Dissidenten. Wenn Vater Staat in Form der Stasi gewollt hätte, dass ich für die nächsten Jahre in den Knast wandere, wäre das im Handumdrehen geschehen gewesen. Die Situation war also alles andere als komisch.
Als hinter mir die Zellentür zugeschlagen wurde, war ich Gefangener des Willkürsystems. Kein Mensch wusste, wo ich war. Es hätte also alles geschehen können. Ich saß in einer drei mal zwei Meter großen Zelle mit einem Rudiment von Tisch und einem unerreichbar hohen Fenster. Es glich mehr einer Schießscharte. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange ich dort saß. Ich hörte nur immer wieder Stiefelabsätze auf dem Flur entlangpatrouillieren. Beschlagene Absätze. Wie bei der SS. Dazwischen immer wieder Sätze wie: »Isser scho so weit?« »Nee, der braucht noch.« Was immer die Jungs da auf dem Gang meinten, es bedeutete nichts Gutes.
Ab einem bestimmten Punkt der Anspannung begann ich allerdings wegzudriften. Die Reisen auf den Rauchkringeln meines Opas gehörten zwar der Vergangenheit an, aber ich hatte mir in der Schule etwas Neues, sehr Innovatives zugelegt. Den »Taucher«, wie ich ihn nannte. Eine Form von Sekundenschlaf, in der ich beides konnte: Schlafen und gleichzeitig wach sein, um an Informationen zu kommen, die ich im Tagesbewusstsein nicht erlangte. Ich war durch die Anspannung in der Zelle so müde und gleichzeitig so überdreht, dass ich von einem Moment zum nächsten immer wieder in einen spontanen Schlaf fiel.
Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass es keinen Plural für das Wort Schlaf gibt? Gibt es etwa nur einen Schlaf? Ist unser Leben möglicherweise ein einziger Schlaf? Träumen wir, wenn wir wachen? Werden wir uns des Traumes bewusst, wenn wir beginnen, den Moment zu erleben? Ich könnte stundenlang über solche Themen philosophieren.
Jetzt aber saß ich im Knast der Deutschen Demokratischen Republik. Im ersten Sekundenschlaf, der mich aus dem Diesseits trug, saß ich plötzlich auf einer Schaukel im Garten meiner Kindheit. Ich übte Weitsprünge. Dabei schaukelte ich bis zum höchsten vorderen Punkt und sprang in hohem Bogen ab. Ich war aber nicht mehr Kind, sondern 23 Jahre alt. Vor mir tollte mein Hund. Mein treuer Rastan, der, als ich 18 Jahre alt war, eingeschläfert werden musste, da er an unheilbarer Hüftdysplasie litt. Er konnte zuletzt nicht mehr selbstständig aufstehen. Ich sah also meinen verstorbenen Rastan, während ich schaukelte. In dem Moment tauchte ich aus dem Flash des Sekundentraums auf und fühlte mich plötzlich sehr geborgen, sehr beschützt. Mein lieber Rastan gab mir weit über seinen Tod hinaus das Gefühl tiefen Selbstvertrauens. Ich spürte augenblicklich, dass sich mein wahres Leben auf einer anderen Ebene abspielte. Auf einer weit freieren als in dieser Zelle hier. Es ist schwer zu verstehen, wie sehr mir dieser kurze Traum Halt gab. Am ehesten ist dieses Gefühl vielleicht mit einer sehr fernen Umarmung aus Kindertagen zu vergleichen, wenn man auf dem Schoß der Mutter saß und nach großem Schmerz in den Schlaf gewiegt wurde. Es ist ein Gefühl tiefer Bodenhaftung. Es ist unerschütterliches Vertrauen in etwas, das größer ist als wir. So etwas wie eine helfende Hand, die uns auf unserem Weg führt.
Auf dem Flur redeten die Offiziere gerade laut über mich: »Er wird gleich vorgeführt. Nu, da würd ihm das Lachen scho noch vergehn.« Selbst das infantile Gerede und die hohlen Drohungen der Stasi konnten mir nichts mehr anhaben. Weder Angst noch Unruhe machten sich in mir breit, nur tiefer innerer Frieden. Ich sank abermals ins Land der Träume.
Mit einem großen Satz sprang ich über meinen freudig bellenden Rastan von meiner Schaukel ab. Ich kam aber nicht auf dem Boden auf, sondern flog. Flog über Gärten, Äcker, Wiesen und Städte. Flog hin zu einer sehr hohen Mauer, die ich mit Leichtigkeit nahm.
»Herr Godaaa, gommse. Ab zum Verhöör.« Der Offizier, der plötzlich vor mir in der Zelle stand, schaute etwas pikiert, als ich ihm mit einem breiten Grinsen folgte. Den gesamten Weg durch die engen Korridore der Stasizentrale hielt ich an meinem Kurztraum fest. Ich war mir instinktiv sicher, dass ich meinen »Flug« über die Mauer in den Westen gesehen hatte. Ich wusste, dass das die Ausreise aus diesem Staat bedeutete, der mich seit meiner Kindheit gefangen hielt. Ich war mir so sicher, dass sie mir nichts tun würden, mir nichts anhaben könnten, dass ich beinahe vor Glück in die Luft sprang.
Der Oberst, der mich verhörte, arbeitete mit allen Mitteln. Zuerst mit der Drohung, dass, »wenn ich vorhätte, im sozialistischen Arbeiter– und Bauernstaat unangemeldet Theater zu spielen, ich in diesem Land auch beerdigt werden würde.« Damit spielte er eindeutig auf die vielen unaufgeklärten Morde durch die Stasi an. Ich schaute auf die Uhr. Es war genau ein Uhr Mittag. Ich hörte keine Sirene. »Ganz schön schalldicht, der Kasten hier«, dachte ich. Als der Oberst mir drohte, dass meine ganze Familie nicht glücklich werden würde, wenn ich »irgendwelche Aktionen auf der Straße« vorhätte, schaute er nervös auf seine Uhr. Immer noch war keine Sirene zu hören. »Ihre Eltern wären sicher nicht glücklich, wenn sie ihre Berufe verlieren würden. Oder?« Ich ließ das Ganze in tiefer Seelenruhe über mich ergehen. Woher nahm ich nur diese Kraft?
Man muss wissen: Andere, Gleichgesinnte, waren an diesem Punkt, in genau dieser Situation, bereits verurteilt und für Jahre weggeschlossen worden.
Ich wusste durch meinen Tauchgang und meinen Flug über die Mauer, dass ich etwas gesehen hatte, das eintreten würde. Plötzlich sah ich meinen Rastan in der Ecke neben dem Vernehmer stehen. Er wedelte freudig mit dem Schwanz. Er schaute mich direkt an und schien tatsächlich zu lächeln. Das machte mir unglaublich viel Mut. Ich sah ihn ebenfalls an und musste lachen. Das verunsicherte den Vernehmer. Er war es gewohnt, seine »Gäste« einzuschüchtern und zu Unterschriften zu bewegen, die ihr Schicksal besiegelten. Viele inoffizielle Mitarbeiter der Stasi sind auf diese Weise rekrutiert worden. Ich schmiss in Gedanken Stöckchen, die mein Rastan freudig apportierte. Dabei sabberte er glücklich meinem Vernehmer auf die Uniformhose. Ich konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Der Oberst fragte, ob ich mir der Tragweite meiner Taten bewusst sei. »Unangemeldetes Theaterspielen.« »Provokative Aktionen auf öffentlichen Plätzen.« »Kontaktaufnahme zum Klassenfeind.« Das waren die Vorwürfe, die in der DDR jahrelangen »Wegschluss« rechtfertigten. Er drohte mir mit Untersuchungshaft, da man wisse, dass ich am Abend zuvor dem »Imperialistischen Klassenfeind« ein Interview gegeben hätte.
Ich hatte tatsächlich dem Reporter eines Westberliner Senders ein Interview gegeben, nachdem wir auf unserem Dachboden ein Stück mit dem Titel »Technik des Glücks« aufgeführt hatten. Es ging selbstverständlich um das Thema Ausreise.
»Für stootsfeindlische Hetze gibt’s bis zu fünf Jahren Bau! Das wissen Se hoffentlisch.« Ich hatte nichts zu verlieren. Egal was ich gesagt hätte, sie hätten mir in jedem Fall einen Strick daraus gedreht.
In diesem Moment sah ich meinen Rastan eines meiner Bücher zerfleddern. Eigentlich hatte er das nur als Welpe mit meinen Turnschuhen getan. Jetzt war es aber eindeutig ein Buch. Mein Gehirn lief auf Hochtouren. Ich war so gebannt von der Szenerie, dass ich tatsächlich keine Zeit für Angst hatte. Ich wollte wissen, was das für ein Buch war. Und in dem Moment stand in einem klaren Flash deutlich ein Buchtitel vor meinem geistigen Auge: »Wo der Hund begraben liegt.«
Das war der Titel eines meiner Lieblingsbücher von Pavel Kohut. Ein tschechischer Autor und Dissident, der sehr oft vom tschechischen Geheimdienst verhaftet worden war. In diesem Buch beschreibt Kohut, wie er regelmäßig Zahnbürste und ein gutes Buch in seine Umhängetasche legt, damit er das Notwendigste im Falle einer Verhaftung bei sich trägt. Er hatte während des Verhörs immer folgenden Satz parat: »Mein Name ist Pavel Kohut, ich bin geboren am …, wohne in … und gebe zu Protokoll, dass ich ab jetzt nichts mehr sage.«
Die Duplizität der Ereignisse wurde mir erst viel später bewusst. Auch ich hatte meine Zahnbürste zurechtgelegt. Auch ich hatte einen Lieblingshund, der mich obendrein auf den Buchtitel brachte, der Bände spricht. Nicht zuletzt mein Flug über die Mauer. Bei dem Gedanken daran bekomme ich heute noch eine Gänsehaut. Zum damaligen Zeitpunkt aber rettete es mir wahrscheinlich das Leben. Ich war so überwältigt von der Inspiration, beziehungsweise dem Hinweis meines Hundes auf das Buch und den Satz von Pavel Kohut, dass ich instinktiv das Richtige tat. Ich sagte: »Mein Name ist Sebastian Goder, ich wohne in …, bin geboren am … und gebe zu Protokoll, dass ich ab jetzt nichts mehr sage und unterschreibe.«
Sosehr der Vernehmer sich auch mühte zu erfahren, wer meine Freunde seien, was wir weiterhin vorhätten, was der Inhalt unserer Aktionen sei. Warum es mir in der DDR nicht mehr gefalle, bis hin zu: »So jemand wie Sie wäre als Mitarbeiter in unseren Reihen stets willkommen«, er hörte von mir an diesem Tag nichts weiter als: »Mein Name ist Sebastian Goder, ich wohne in …, bin geboren am … und gebe zu Protokoll, dass ich ab jetzt nichts mehr sage und unterschreibe.«
Während ich das sagte, verlor mein Rastan immer mehr an Kontur und löste sich schwanzwedelnd Stück für Stück auf. Tatsächlich hatte er seine treue Schuldigkeit getan. Mein liebster Rastan, ich danke dir von Herzen und werde dich nie vergessen.
Nach acht Stunden in der Stasizentrale war ich wieder auf freiem Fuß. Hatte ich nur Glück gehabt? Oder waren es der Traum und die Gegenwart meines Hundes, die mir das Leben gerettet, beziehungsweise die Freiheit geschenkt hatten? Oder wäre ich auch ohne die Vision davongekommen? Was wäre gewesen, wenn ich voller Angst geredet und alle Fragen des Verhörers beantwortet hätte? Ich bin fest davon überzeugt, dass mir meine Traumreise enorm geholfen hat.
Unser Traum-Ich hält eine Bandbreite von unzähligen Möglichkeiten für uns bereit. Diejenige, die uns im Tagesbewusstsein am stärksten motiviert, stellt einen Persönlichkeitsfaktor dar, der gelebt werden sollte.