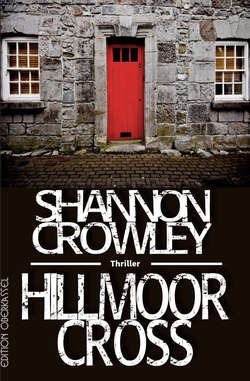Читать книгу Hillmoor Cross - Shannon Crowley - Страница 4
Kapitel 2
ОглавлениеNachdem Jake Hillmoor Cross hinter sich gelassen hatte, gab er Gas. Er wollte zu einer ganz bestimmten Stelle an den Cliffs of Moher, wo der Fels absolut senkrecht in die Tiefe ging und man nur bäuchlings bis zur Kante vorrutschen durfte, weil einen sonst der Schwindel packte und hinunterzog. Jetzt, wo es praktisch schon dunkel war, würde an dieser riskanten Stelle niemand außer ihm oder jemand, der lebensmüde war, so wahnsinnig sein, sich dort aufzuhalten. Den Wagen konnte er in circa hundert Meter Entfernung seitlich bei einigen Büschen abstellen. Jake war es, als hätte sich eine eiserne Hülle um ihn gelegt, die für den Moment Hysterie und Entsetzen von ihm fernhielt. Möglicherweise platzte die Hülle, sowie der Junge die Klippen hinunterstürzte. Jakes Magen krampfte sich zusammen. Nur nicht nachdenken – es änderte nichts mehr. War das Kind im Meer verschwunden, musste er, so rasch es ging, zurück nach Hause. Er musste sich unbedingt um Martha kümmern, die bestimmt längst wieder bei Bewusstsein und einem Herzinfarkt nahe war. Außerdem brauchte sie allabendlich ihr Medikament gegen den Bluthochdruck.
Jake drückte das Gaspedal tiefer. Der Himmel über ihm wurde dunkler und ein fahler Mond schimmerte durch die Wolken. Links und rechts der Fahrbahn erstreckte sich die Landschaft, auf der einen Seite in kleinen Hügeln, auf der anderen sanft abfallend, und verschmolz mit der Dunkelheit. In größeren Abständen schimmerte das Weiß verstreut liegender Steine und Felsbrocken durch die Nacht, reflektiert durch die Scheinwerfer des Wagens. Die Straße war schmal und schmiegte sich in unzähligen Krümmungen in die Natur, was die halsbrecherische Fahrt zum Risiko machte. Jake fuhr hoch konzentriert. Weiter, nur weiter, das Kind entsorgen und die Großmutter befreien, ehe diese das Entsetzen nicht überlebte. Er kniff die Augen zusammen und bremste den Wagen ab. Unvermittelt waren in einiger Entfernung Lichter aufgetaucht. Er glaubte einen Querbalken zu erkennen, auf dem kreisrunde gelbe Lampen blinkten, und bemerkte ein Straßenschild, das wegen Reparaturarbeiten auf eine Totalsperrung der Strecke bis zum nächsten Morgen hinwies. Am Straßenrand parkte ein Lkw, einige Arbeiter in orangefarbenen Anzügen mit Reflektorstreifen hantierten mit Geräten. Einer hob den Kopf und blickte zu Jakes Wagen. Jake fluchte, schlug mit der Hand aufs Lenkrad, legte hastig den Rückwärtsgang ein, um an geeigneter Stelle zu wenden, und fuhr mit quietschenden Reifen die Straße zurück. Warum war die Sperrung nicht fünf Kilometer weiter vorn an der Kreuzung angekündigt worden?
Im Schein der Rücklichter erkannte er eine kiesige Ausweichstelle seitlich der Straße und lenkte den Wagen schwungvoll hinein. Er rutschte von der Kupplung, und das Auto machte einen Satz nach hinten. Er spürte einen Schlag gegen das Fahrzeug und hörte ein knirschendes Geräusch. Seine Kiefer mahlten aufeinander. Vermutlich hatte er einen größeren Stein geschrammt und nun eine Delle an der hinteren Stoßstange. Egal, es gab Wichtigeres. Wieder trat er aufs Gas. Die Reifen drehten auf dem bröckligen Untergrund durch, ehe sie griffen. Die Klippen konnte er vergessen. Sämtliche weiteren Stellen, die er in halbwegs akzeptabler Zeit erreichen konnte, wiesen auf dem Weg in die Tiefe Felsvorsprünge auf, teilweise bewachsen mit hohem Gras oder auch ganz kahl. Er wollte einfach nicht, dass der Junge auf einem dieser Vorsprünge aufprallte und liegen blieb, sichtbar für jeden, der nach Tagesanbruch einen Blick über die Klippen warf. Einen Grund dafür hätte er nicht nennen können, außer dass er das Gefühl hatte, dass, wenn der Junge auf alle Zeit verschwände, auch ein Teil seines unheilvollen Planes ausgelöscht wäre. Ja, er brauchte eine andere Lösung. Wenn er vorn an der Kreuzung die N 59 nahm, die Galway mit Clifden verband, kam er an den Moorgebieten vorbei. Das Moor würde den Jungen auf Nimmerwiedersehen in sich hineinsaugen. Nach wenigen Minuten war Jake wieder an der Kreuzung, bemerkte das Hinweisschild für die Sperrung, das er zuvor übersehen hatte, und bog in die N 59 ein.
Ein Schatten bewegte sich am Straßenrand, schwankte und zwang Jake, das Steuer zu verreißen. In letzter Sekunde erkannte er einen Radfahrer und sah, dass dieser drohend die Faust hob. Eben noch bezwang er sich, zornig die Hupe zu drücken. Jake zerrte an seinem Kragen. Es wurde höchste Zeit, die Angelegenheit zu Ende zu bringen. Er hatte einfach nicht die Nerven dafür. Mit einem Kind für zwei Stunden seinen Spaß zu haben, noch dazu so, dass es sich später nicht erinnern konnte, war eine Sache. Es zu töten und zu entsorgen, eine andere.
Nach weiteren zehn Minuten Fahrt durch kleine Waldstücke und an endlosen Wiesen vorbei bog er von der Straße ab in einen schmalen Nebenweg, der genau genommen Radfahrern und Spaziergängern vorbehalten war. Wer sich in der Gegend nicht auskannte, dem fiel der Weg nicht auf. Beschilderungen, die auf das Moorgebiet hinwiesen, gab es keine. Wanderer mussten sich ihre Wege selbst erschließen und achtgeben, nicht in riskante Zonen zu geraten. Jake schaltete Licht und Motor des Autos ab, stieg aus und vergewisserte sich, so gut es in der Dunkelheit ging, alleine zu sein. Vereinzelt ragten ein paar Tannen und knorrige, noch unbelaubte Bäume in die Höhe, der Mond schien schwach durch die Wolken und reichte als Lichtquelle nicht aus. Er würde die Taschenlampe seines Handys benötigen, um eine passende Stelle zu finden und nicht Gefahr zu laufen, selbst vom Weg abzukommen. Jake holte zum dritten Mal an diesem Tag das Kind aus dem Kofferraum und ließ es in der Decke eingewickelt. Er schulterte den Jungen, leuchtete sich den Weg und näherte sich dem Moor.
Eine halbe Stunde später war er wieder auf dem Rückweg. Obwohl er eine besonders nasse Stelle im Sumpfland kannte, hatte es etliche Minuten gedauert, ehe das Kind versunken war. Um den Vorgang zu beschleunigen, hatte er ein paar Steine unter die Kleidung des Jungen gestopft. Blieb nur zu hoffen, dass diese zunächst noch an Ort und Stelle blieben und nicht vorschnell herausrutschten. Und dass es den Kleinen während der Nacht weiter in die Tiefe zog und er nicht etwa wieder auftauchte. Die Einweghandschuhe hatte er ineinandergesteckt und das Kondom dazu, und alles zusammen, gleichfalls mit einem Stein beschwert, an anderer Stelle mit aller Kraft ins Moor hinausgeworfen. Ähnlich war er mit dem Klebeband und der Paketschnur verfahren, die er zu einem Knäuel zusammengedreht und weit ins Moor geschleudert hatte. Diese Utensilien würde mit Sicherheit niemand finden, und falls doch, so mochte der Sumpf alle verwertbaren Spuren vernichtet haben. Jake war es schrecklich kalt, hinter seinen Schläfen bohrte und pochte es, und seine Glieder fühlten sich bleischwer an. Im Grunde konnte er nicht fassen, was er getan hatte. Er wollte nicht darüber nachdenken und hatte auch keine Zeit dafür, denn jetzt ging es um Großmutter Martha. Er zog sein Handy aus der Jackentasche und sah auf die digitale Anzeige. Gleich sieben Uhr. Seit fast vier Stunden war die alte Frau jetzt eingesperrt. Es mochte die Hölle für sie sein, und das hatte er wahrhaftig nicht gewollt.
Jake fuhr rückwärts aus dem Nebenweg, stieß in die N 59 und trat aufs Gaspedal. Eine gute halbe Stunde brauchte er mindestens noch, bis er zu Hause war. Er war entsetzlich müde und sehnte sich nach einer Dusche und ein oder zwei Whiskey. Doch das musste warten. Er kurbelte das Fenster auf halbe Höhe. Vielleicht half ein kühler Fahrtwind gegen die Erschöpfung. Er steigerte die Geschwindigkeit. Jede Minute zählte. Er würde Martha erzählen, er sei in Brendas Internetcafé gewesen, um für eine anstehende Prüfung in der Uni zu lernen. Jake brauste die Straße entlang. Als sein Handy zu klingeln anfing, erschrak er dermaßen, dass der Wagen ins Schlingern kam. Der Range Rover schoss über den Straßenrand hinaus. Jake versuchte das Tempo zu drosseln und gegenzulenken, doch das Auto sprang in wilden Sätzen übers Gelände, das an dieser Stelle abschüssig war, und er verlor vollends die Kontrolle. Das Fahrzeug überschlug sich, Jakes Kopf prallte gegen die Scheibe und der Wagen blieb auf der Seite liegen. In seinem Schädel rauschte es und er verspürte einen starken Brechreiz. Sein Magen schien sich umzustülpen, der Schmerz in seinem Kopf explodierte und Jake wurde ohnmächtig.
*
»Was war das? Hast du das gehört?« Zoe schob Victor von sich, der unermüdlichen ihren Hals mit Küssen bedeckte und seine Hand unter ihrem Rock hatte.
»Ja«, erwiderte Victor und schob die Hand höher. »Das ist bestimmt ein Jäger, der einen Hirsch erlegt hat.«
»Unsinn. Das war kein Schuss.« Zoe richtete sich auf und drehte die Rückenlehne des Beifahrersitzes hoch. Verärgert ließ Victor von ihr ab.
»Himmel, Sweetheart. Ich bin doch nicht mit dir hierher in den Wald gefahren, damit du dich von jedem Geräusch erschrecken lässt. Ich dachte, wir waren uns einig und genießen den Abend!«
»Irgendwas ist passiert. Das klang, als wäre jemand gegen einen Baum gefahren. Lass uns nachsehen, vielleicht braucht derjenige Hilfe«, sagte Zoe und schloss die Knöpfe ihrer Bluse.
»Wenn du es dir anders überlegt hast, sag es einfach. Ich bin dann zwar sauer, aber noch viel saurer bin ich, wenn ich mit Ausreden abgespeist werde«, knurrte Victor. Zoe legte ihm die Hand aufs Knie.
»Fahr vor zur Straße bitte. Wenn ich mich geirrt habe, kehren wir wieder um und ich mach alles gut, okay?«
Victor seufzte. Das Schäferstündchen auf dem Waldparkplatz konnte er vergessen. Wenn er ehrlich war, hatte sich der krachende Laut wirklich nicht nach einem Schuss angehört. Victor ließ den Motor an.
*
Lacey Stone lag noch einen Augenblick still im Bett und lauschte in die Dunkelheit hinein, nachdem der Wecker geklingelt hatte. Wie herrlich ruhig es im Haus war. Kein Stöhnen, Quengeln und Sabbern von nebenan. Kein Winseln und keine klagenden Geräusche mehr, wenn sie nicht sofort zur Stelle war. Niemand zwang sie jetzt noch, ihre Zimmertür offen stehen zu lassen, damit sie jederzeit gerufen werden konnte. Dabei hatte Sophie sie sowieso nicht rufen können, sondern stattdessen ein lautes, gurgelndes Geräusch ausgestoßen und mit der flachen Hand an die Wand geklatscht, wenn sie nach Lacey verlangte. Und sie hatte ständig nach ihr verlangt, wenn sie zu Hause war. Lacey sollte ihr Geschichten vorlesen, ihr beim Stapeln der bunten Holzbausteine helfen, sie mit Grießbrei füttern oder ihre eine neue DVD mit einem Zeichentrickfilm einlegen. Letzteres war noch am angenehmsten, denn anschließend konnte sie sich mit etwas Glück aus dem Zimmer schleichen. Wenn Lacey nicht daheim war, war für all dies Emma zuständig, eine staatlich bezahlte Pflegekraft, deren Unterstützung Lacey für die behinderte Schwester mehrere Stunden am Tag zustand, damit sie selbst arbeiten gehen konnte oder auch mal ein wenig Freizeit zur Erholung hatte. Emma war 65 Jahre alt gewesen, ausgebildete Krankenschwester und ein rechtes Biest, das häufig an Lacey herumkritisiert hatte. Küche und Bad seien nicht sauber genug, der Inhalt von Kühlschrank und Vorratskeller weder frisch noch vollwertig, und Lacey selbst sei angeblich permanent die personifizierte schlechte Laune, was nicht gut für die Verfassung der Schwester sei. Nebenbei war sie der Ansicht, dass Sophie Krankengymnastik brauchte, um die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten und den Muskelabbau zu bremsen, sowie Förderunterricht für ihre geistigen Fähigkeiten. Vielleicht lernte sie ja doch wieder ein paar Worte sprechen? Immer wieder setzte sie ihr zu, sich um diese Zweckdienlichkeiten für die Schwester zu kümmern.
Auch mit Sophie hatte sie stets in harschem Ton gesprochen. Warum die Schwester dennoch bei Emma meist friedlich gewesen war, verstand Lacey bis heute nicht. Während sie selbst ständig rennen musste, um die Schwester zufriedenzustellen, hatte Emma mit schöner Regelmäßigkeit am Küchentisch gesessen und Zeitung gelesen, wenn Lacey nach Hause kam, und Sophie war ruhig und offensichtlich gut versorgt gewesen. So lange, bis hinter Emma die Tür klappte. Dann hatte Sophies Gejammer und Genörgel das kleine Einfamilienhaus am Rande von Clifden sofort wieder erfüllt, sodass Lacey oft froh darum war, dass die nächsten Nachbarn an die 500 Meter entfernt wohnten.
Aber dies alles war jetzt vorbei. Ein gnädiges Schicksal hatte Sophie unerwartet und sozusagen über Nacht von ihrem tristen eingeschränkten Dasein erlöst und damit auch Lacey von einer Last befreit. Manchmal wurde das Leben eben doch etwas besser.
Lacey knipste die Nachttischlampe an und schob die Beine über die Bettkante. Es war neun Uhr abends. In einer Stunde begann ihr Nachtdienst in der Uniklinik in Galway. Wenn sie nicht zu spät kommen wollte, wurde es Zeit. Sie ging ins Bad, das direkt an das Schlafzimmer angrenzte, putzte sich die Zähne und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Rasch fuhr sie mit der Bürste durch ihr dunkles Haar, das in großen Locken auf ihre Schultern fiel, löschte das Licht und verließ das Bad. Am Fußende ihres Bettes hing das braune Wollkleid, das sie schon die letzten Tage getragen hatte. Es war schlicht und strapazierfähig, engte weder Bauch noch Busen ein, verdeckte ihre unförmigen Waden und genügte vollkommen für den Weg zur Arbeit.
Lacey ging in die Küche, schaltete gewohnheitsmäßig das Radio ein, setzte Teewasser auf und legte ein Croissant in den Tischbackofen, der auf der Arbeitsfläche stand.
Zwanzig Minuten später stieg sie in ihre kniehohen, gefütterten Winterstiefel aus schmucklosem braunen Wildleder, schlüpfte in ihre schwarze Steppjacke, die über ihren kräftigen Hüften spannte und knapp über dem Po endete, und verließ das Haus. Vor der Tür parkte der orange-rote R5, den sie von ihren Eltern geerbt hatte. Jetzt im Frühjahr waren die Nächte zwar noch kalt, aber nicht so kalt, dass sie den seltenen Frost befürchten musste, der sie zwang, die Scheiben freizukratzen, ehe sie losfuhr. So gestattete es sich Lacey, den Wagen nicht in die Garage zu fahren. Sie brauchte zwei Versuche, ehe das störrische Auto beim dritten Mal ansprang und gemächlich lostuckerte.
Zehn Minuten vor zehn Uhr stellte sie das Fahrzeug auf dem Parkplatz für die Angestellten hinter der Uniklinik ab und hastete zum Eingang. Sie atmete schwer und ihr Gesicht hatte eine ungesunde rote Farbe, als sie zwei Minuten nach zehn Uhr als Letzte ins Schwesternzimmer schlüpfte, wo Oberschwester Hanna vor zwei Kolleginnen stand und eben die Übergabe für die Nachtschicht machte. Hanna warf ihr einen missbilligenden Blick zu.
»Noch mal für Lacey, die es aus mir nicht erklärbaren Umständen nach wie vor nicht schafft, pünktlich zu sein. Heute Abend um zwanzig Uhr wurde ein Autounfall eingeliefert. Eine Person, männlich; dem Ausweis nach, den er bei sich trug, 25 Jahre alt. Der Mann heißt Jake Almond. Er ist momentan ohne Bewusstsein, wie es aussieht, aber glimpflich davongekommen. Er hat eine Gehirnerschütterung, eine zwanzig Zentimeter lange Schnittwunde am linken Bein, die genäht werden musste, sowie reichlich Kratzer und Prellungen. Wir haben versucht, Angehörige ausfindig zu machen und zu verständigen. Unter der einzigen Telefonnummer, die wir gefunden haben, geht aber niemand ran. Wir müssen abwarten, ob ihn jemand vermisst meldet, oder warten, bis er zu sich kommt. Er liegt auf Station II und damit in deinem Zuständigkeitsbereich, Lacey. Ansonsten hatte Grace Murphy heute Nachmittag einen Kreislaufkollaps, ist aber inzwischen wieder stabil …«
Lacey hörte nur noch mit halber Aufmerksamkeit zu. Inzwischen bekam sie wieder Luft, und ihr Puls, der von der Hektik des Umziehens und der Eile, noch rechtzeitig zur Schichtübergabe zu erscheinen, gejagt hatte, hatte sich wieder beruhigt. Dafür brannte nun der Zorn in ihr. Musste Hanna sie stets kritisieren und vor den anderen vorführen? Letzten Endes war sie nur zwei Minuten zu spät gekommen. Solange Sophie noch gelebt hatte, hatte sie für ihre Unzulänglichkeit noch ein wenig Verständnis erwarten können. Doch seit die Schwester nicht mehr war, war das vorbei. Hanna wies gern und ungeniert vor aller Ohren darauf hin, dass Lacey die einzige der Angestellten war, die keine Familie hatte, die berücksichtigt werden wollte, und dennoch öfter zu spät kam als andere mit Mann, Kindern und Schwiegermutter. Damit trat sie mitten in Laceys wunde Stelle.
»So, das war es«, schloss die Oberschwester ihre Ausführungen. Die beiden Kolleginnen, die auf den Stationen III und IV Nachtdienst hatten, verließen den Raum. Lacey wollte sich ihnen anschließen, als Hanna sie zurückhielt.
»Lacey, einen Moment noch«, verlangte sie. Lacey blieb auf ihrem Stuhl sitzen und schwieg mit zusammengepressten Lippen. Statt der erwarteten Maßregelung setzte sich Hanna schwerfällig auf die Tischkante, ein für sie sehr ungewöhnliches Verhalten.
»Du bist jetzt seit über zehn Jahren hier an der Klinik, Lacey. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich gehe vorzeitig in Ruhestand. Ich bin einfach fertig nach all den Jahren und will noch was vom Leben haben. Jedenfalls wird damit die Stelle der Oberschwester frei. Der Chef hätte in Erwägung gezogen, sie dir zu geben, wenn du nicht kommen und gehen würdest, wie es dir passt.«
Lacey stieg flammende Röte in die Wangen.
»Jetzt kriegt Ruth den Posten. Allerdings denke ich, sie wird ihn nicht lange behalten wollen. Ich hab was flüstern hören, dass sie ihren George heiraten will. Dann zieht sie wohl zu ihm nach Dublin. Also reiß dich zusammen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.«
Lacey verschränkte die Arme vor der Brust. Auf ihrer Zunge hockten jede Menge Widerworte. Hanna stemmte ihr Gewicht vom Tisch.
»Nun sieh nach dem Autounfall, am besten alle halbe Stunde. Er liegt auf Zimmer 14. Der Doc sagt, es ist das reinste Wunder, dass er so davongekommen ist. Der Wagen muss Schrott sein. Hat sich überschlagen und ist auf der Fahrerseite liegen geblieben. Wenn sich nicht ein junges Paar in der Nähe herumgedrückt hätte, das ihn gefunden hat, wäre er möglicherweise verblutet. Ein Metallstück hatte sich in sein Bein gebohrt und ist kaum einen Millimeter an der Arterie vorbei stecken geblieben. Gut, dass die beiden so schlau waren, ihn nicht aus dem Wagen zu zerren.«
Lacey gab keine Antwort.
»Schau nicht so finster, du verschreckst ja die Patienten. Ich wünsch dir eine ruhige Nacht. Bis übermorgen.«
Ihr war schlecht vor Ärger. Hanna hörte sich an wie Emma. Am liebsten hätte Lacey mit der Tür geknallt, als sie das Schwesternzimmer verließ. Sie machte sich auf den Weg zu Zimmer 14.
*
Obwohl es bereits nach 22 Uhr war, gab sich Katie Ward keine besondere Mühe, die ausgetretenen hölzernen Stufen zu ihrer Wohnung im zweiten Stock leise hinaufzugehen. Im Treppenhaus roch es nach Sauerkraut, Knoblauch und Zigaretten, aber das fiel ihr schon lange nicht mehr auf. Die schief getretenen Absätze ihrer vergilbten, ehemals weißen Stiefeletten klackten geräuschvoll auf dem Boden. Für alle Fälle hatte sie ein paar bissige Antworten parat, falls einer der Nachbarn den Kopf in den Flur streckte und sich über ihre Rücksichtslosigkeit zu später Stunde aufregen wollte. Katie war nicht bereit, sich irgendetwas gefallen zu lassen. Sie kramte in dem aus bunten Kunstlederflicken zusammengesetzten Beutel nach ihrem Schlüsselbund, und als sie ihn schließlich gefunden hatte, entglitt er ihr und fiel scheppernd zwei Stufen hinunter. Mit unbewegter Miene hob sie ihn auf und öffnete die Wohnungstür. Es war still und dunkel in ihrem Quartier. Gut so, dann schlief Sebastian wenigstens. Sie wollte in Ruhe ein Glas Wein trinken, ein oder zwei Zigaretten am offenen Küchenfenster rauchen und dann ins Bett gehen.
Katie schlüpfte aus ihren Schuhen, hängte die Strickjacke aus grobem grauen Wollstoff an den Haken im Flur und die Tasche dazu. Sie ging in die Küche und knipste das Licht an, das sich fahl aus einer fettüberzogenen und mit verendeten Mücken verklebten Deckenlampe über den kleinen Raum ergoss. Sie ignorierte den Berg schmutzigen Geschirrs, an dem die Essensreste der letzten Tage hafteten und einen undefinierbaren, abgestandenen Geruch verbreiteten, holte den Weißwein aus dem Küchenschrank und öffnete das Fenster. Im Haus gegenüber bewegte sich ein Vorhang hinter einer Fensterscheibe im dritten Stock. Katie verzog ironisch die Mundwinkel. Die alte Milla konnte offensichtlich wieder mal nicht schlafen und beobachtete die Straße und das Kommen und Gehen der Nachbarn, in der Hoffnung etwas zu bemerken, was sie weitertratschen konnte. Viel sehen würde sie heute nicht. Der Mond war von Wolken verborgen, und von vier Straßenlaternen brannten seit Wochen nur zwei. Entweder hatte die Gemeinde Hillmoor Cross kein Geld für neue Glühlampen, oder den Verantwortlichen war es schlichtweg egal, dass die Bewohner der ärmsten Ecke ihrer Kommune nachts kaum das Licht hatten, die Haustüren aufzusperren. Katie schnippte die Asche ihrer Zigarette aus dem Fenster.
Eine halbe Stunde später beschloss sie, ins Bett zu gehen. Auf dem Weg in ihr Schlafzimmer kam sie an Sebastians kleiner Kammer vorbei. Die Tür war geschlossen, und das machte sie stutzig. Sebastian bestand immer darauf, sie nur anzulehnen. Katie drückte sie sacht nach innen auf. Das Bett ihres Sohnes war zerwühlt, aber leer. Ihr Blick ging automatisch zum Badezimmer, das der Kammer gegenüberlag. Hinter dem Milchglaseinsatz auf Kopfhöhe war es dunkel. Auf dem Klo war er also auch nicht.
»Sebastian?«, rief sie und wusste bereits, dass er nicht hier war. Trotzdem sah sie noch ins Wohnzimmer, ob er verbotenerweise ferngesehen hatte und auf dem Sofa eingeschlafen war. Welch ein Unsinn – sie hätte den Fernseher ja hören müssen, auch wenn Sebastian den Ton immer leise drehte, in der Hoffnung die Rückkehr der Mutter rechtzeitig zu bemerken und das Gerät rasch auszuschalten.
Verärgert runzelte sie die Stirn. Es war einfach unerhört, was der Junge sich herausnahm, und Maya sowieso. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Gleich elf Uhr nachts. Unmöglich, noch bei Maya anzurufen. Aber morgen würde sie ihr Bescheid sagen und Sebastian natürlich auch.
Katie ging in ihr Schlafzimmer, zog die gestreifte Jeans, die braune Cord-Weste und das helle T-Shirt aus und ließ sich in Unterwäsche und Socken ins Bett fallen. Wenigstens konnte sie ausschlafen, wenn der Junge bei Maya war. Wäre es nach ihr gegangen, hätte er auch ganz bei ihr bleiben können, aber das würde Maya nicht umsonst machen. Außerdem riskierte sie damit ihr Kindergeld und den Zuschlag für Alleinerziehende. Schade um das Geld. Katie zog die Decke bis zum Kinn und schlief sofort ein.
Sie wachte am nächsten Morgen gegen zehn Uhr auf. Nach einer Tasse Kaffee und zwei Zigaretten rief sie bei Maya an. Das Gespräch war wenige Minuten später beendet. Katie war geschockt und wütend. Sebastian war nicht bei Maya, der Mutter seines Kindergartenfreundes Robin. Er war nicht einmal zur Feier des St. Patrick’s Days erschienen. Katies Magen krampfte sich in heißem Zorn zusammen. Damit war klar: Finn hatte sich den Jungen geholt. Wie er in seiner Position damit durchkommen wollte, wie er überhaupt die plötzliche Existenz des Kindes erklären wollte, war ihr schleierhaft. Sie zerrte die nächste Zigarette aus der Packung und zündete sie mit fahrigen Fingern an. Vielleicht hatte sie ihre letzte Forderung an ihn doch übertrieben. Aber das Leben war teuer, und erst recht das Leben mit einem Kind. Finn Brady hatte immerhin ein solides Einkommen, davon sollte seinem Sohn ruhig etwas zugutekommen. Hektisch inhalierte sie den Rauch. Die Frage war, was sie jetzt machen sollte. Andererseits, warum sollte sie überhaupt etwas machen? Finn würde die Bürde, die er sich aufgeladen hatte, bestimmt nicht lange durchstehen. Sie war sicher, er würde sich über kurz oder lang bei ihr melden. Katie drückte ihre Zigarette in dem Plastikaschenbecher aus, den sie kürzlich in einer Kneipe hatte mitgehen lassen. Am besten Ruhe bewahren und abwarten. So, wie sie Finn kannte, würde er sie schon deshalb anrufen, weil er der Ansicht war, sein Vorgehen anders nicht vor sich und dem Herrn verantworten zu können.
*
Lacey Stone öffnete ein letztes Mal während ihrer Nachtschicht, die in einer halben Stunde zu Ende war, die Tür zu Zimmer 14. Der Patient, ein gewisser Jake Almond, war noch immer ohne Bewusstsein. Über die Monitore, an die er angeschlossen war und die hinter seinem Bett standen, flimmerten gleichmäßige grüne Zacken, die Herzfrequenz und Herzrhythmus wiedergaben. In bunten Zahlen konnte sie die Werte für Blutdruck, Puls und Temperatur ablesen. Alles in Ordnung, auch die Messung der Atemfrequenz lag im Normbereich. Lacey machte eine Notiz im Krankenblatt. Jake Almonds Werte waren stabil.
Sie musterte das ebenmäßige Gesicht, auf dessen Wangen und Kinn sich dunkle Bartstoppeln abzeichneten. Auf der Stirn, dicht unter dem Ansatz des vollen dunklen Haares, klebte verkrustetes Blut, durch das sich zwei schwarze, verknotete Fäden zogen. Die kleine Platzwunde würde wahrscheinlich eine Narbe hinterlassen, die aber mit entsprechender Frisur gut zu verbergen war. Was für ein attraktiver Mann. Er hatte volle Lippen, die bestimmt wunderbar weich waren. Ob er verheiratet war? Ihr Blick ging zu seinen Händen, die seitlich seines schlanken, muskulösen Körpers auf der dünnen Bettdecke lagen. Sie waren sehr gepflegt. Es waren die Hände eines Akademikers, nicht die eines Arbeiters oder Handwerkers. Jake Almond trug keinen Ring – immerhin. Aber das mochte nicht viel heißen. Laceys Blick ging zu dem Stuhl, der an der Wand gegenüber dem Bett stand. Darauf lag die Kleidung des Patienten. In den Zimmern der Überwachungsstation gab es keine Kleiderschränke. Lacey begann, die Taschen von Jacke und Hose zu durchsuchen. Sie fand einen Geldbeutel mit vierzig Euro in Scheinen sowie etliche Münzen. In den Steckfächern befanden sich ein Personalausweis, eine Kreditkarte der Anglo Irish Bank, ein Studentenausweis der Uni Galway und ein Ausweis für eine Leihbücherei. Er war also Student. Lacey schob das Portemonnaie zurück in die Hosentasche. In der inneren Brusttasche der Jacke des Mannes befand sich ein Handy. Es war zufällig das gleiche Modell, das auch Lacey besaß, jedoch war ihres von dunkelroter Farbe und dieses hier schwarz. Neugier durchzuckte sie, gepaart mit der Furcht, es könnte gerade jetzt jemand ins Zimmer kommen oder der Patient aufwachen. Doch wer hätte schon kommen sollen? Sie war im Augenblick die einzige Schwester auf Station. Erst musste die Nachtschicht übergeben werden, Visite war sowieso erst in zwei Stunden. Jake Almond regte sich noch immer nicht. Lacey berührte den Touchscreen. Das Mobiltelefon hatte keinen Passwortschutz. Ungehindert öffnete sich das Menü. Der Telefonnummernspeicher war leer; es gab einige wenige Kurznachrichten an einen Justin mit banalem Inhalt wie »Sorry, wird etwas später« und Ähnlichem sowie einen unbeantworteten Anruf.
Sie klickte auf den Menüpunkt Bilder. Ein kleiner Junge in blauer Badehose erschien auf dem Display. Er stand an einem felsigen Strand und blickte aufs Meer. Auch auf dem nächsten Foto war ein Junge zu sehen. Er spielte im Sand, neben sich Eimer und Schaufel. Lacey hätte nicht sagen können, ob es sich um das gleiche Kind handelte, da beide Bilder in einigem Abstand aufgenommen worden waren. Vom Flur her ertönte das gleichmäßige Brummen des Schwesternrufes. Sie schloss das Menü des Mobiltelefons, schob es zurück in die Jackentasche und warf einen letzten Blick auf den Patienten. Ob der Junge sein Kind war? Dann gab es eine Mutter dazu. Oder der Kleine war sein Neffe? Das war herauszufinden. Vielleicht war Jake Almond alleinstehend. Angehörige hatten sich jedenfalls bisher nicht gemeldet, und laut der Oberschwester war auch niemand auffindbar beziehungsweise erreichbar gewesen, den man hätte verständigen können. Dann konnte er ein wenig Aufmerksamkeit gebrauchen, wenn er wieder zu sich kam. Lacey zog die Tür von Zimmer 14 hinter sich zu und sah nach der Patientin, die nach ihr gerufen hatte.