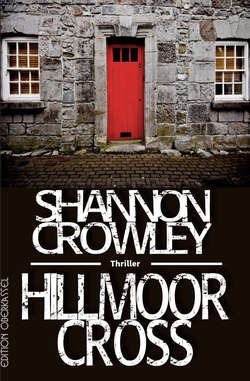Читать книгу Hillmoor Cross - Shannon Crowley - Страница 7
Kapitel 5
ОглавлениеJake ging bedächtig und mit schleppenden Schritten über den mit terrakottafarbenen Pflastersteinen belegten Fußweg zur Haustür. Vereinzelt knirschten einige der Kieselsteinchen unter seinen Turnschuhen, die Großmutter Martha regelmäßig sorgfältig zwischen die Fugen kehrte, damit möglichst wenig Unkraut wuchs. Er steckte den Schlüssel in Schloss, vergewisserte sich noch einmal, dass der Taxifahrer bereits das Weite gesucht hatte, und drückte die Haustür nach innen auf. Klamme Kälte lag wie ein schwerer nasser Mantel um seine Schultern und wollte ihn zu Boden drücken. Er öffnete den Mund, um versuchsweise nach der Großmutter zu rufen, und klappte ihn wieder zu. Eine eiskalte Faust drückte ihm die Kehle zu, presste seinen Adamsapfel nach innen und drohte ihn zu ersticken. Sein Herz drosch gegen die Rippen. Großmutter Marthas Koffer stand im Flur, ihr Schlüsselbund lag auf dem Schuhschrank. Im Haus herrschte Stille. Grabesstille. Jake drückte die Haustür hinter sich zu.
›Sie ist tot‹, hämmerte es wie ein Stakkato hinter seiner Stirn. ›Sie liegt unten und ist tot.‹ Ein stechender Schmerz flammte in seinem Schädel auf.
›Ich muss hinunter und nach ihr sehen‹, dachte er. Vielleicht gab es ja noch eine winzige Chance. Seine Beine waren stocksteif und er brauchte alle Willenskraft, zur Kellertreppe zu gehen, die zum Erdgeschoss mit einer Tür verschlossen war. Mit feuchtkalten Fingern klammerte Jake sich am Treppengeländer fest und nahm Stufe für Stufe hinunter. Zitternde Schwäche und grauenvolle Furcht saßen wie kleine hässliche Teufel in jeder Zelle seines Körpers. Dann stand er vor dem Verschlag. Die hölzerne Tür war zu, der Metallriegel noch immer vorgeschoben, dahinter war kein Laut zu vernehmen. Es kostete ihn übermenschliche Kraft, die Sperre zurückzuschieben und die Tür zu öffnen.
Großmutter Martha lag auf der Seite in zusammengekrümmter Haltung. Ihre Augen waren starr und halb geöffnet, ebenso ihr Mund, als hätte sie mit letzter Kraft geschrien und mitten in einem Atemzug das Leben aus sich herausgestoßen. Die rechte Wange, die er sah, war eingefallen, ihre Haut war fahl, die Finger der rechten Hand krallten sich in den erdigen Boden, der über 200 Jahre lang festgetreten worden war. Mit bebenden Gliedern ging Jake neben der Toten in die Hocke. Seine Wunde am Bein durchjagte ein stechender Schmerz, den er ignorierte. Er zwang sich, nach Marthas Handgelenk zu greifen und nach dem Puls zu suchen. Die Haut war kalt und wächsern, und er gab es auf. Vielleicht am Hals? Vielleicht war da noch Leben? Vorsichtig tastete er den Bereich ab, an dem er die Schlagader vermutete. Die unbewegten Augen der Großmutter starrten unter den halb gesenkten Lidern ins Leere.
Jake quälte sich in aufrechte Haltung. Es war vorbei. Die alte Frau, die ihn umsorgt und großgezogen hatte, die ihm Mutter und Vater ersetzt hatte, die stets ein wenig unterkühlt und doch von rauer Fürsorge für ihn gewesen war – sie war tot. Gestorben durch sein Handeln und seine Schuld. Alleine und elendig verendet. Zugrunde gegangen an seiner panischen Reaktion, weil sie ihn mit dem kleinen Jungen erwischt hatte. Der Junge. Ihn hatte er fast vergessen. Jake sah hinunter auf Martha, die wie ein unförmiger Embryo zu seinen Füßen lag. Er konnte nichts mehr tun. Aber mit ihr musste er etwas tun, und das sofort. Außerdem konnte er hier drinnen nicht länger atmen. Es war, als hätte sie alle Luft in dem kleinen Raum verbraucht, in ihrem Kampf ums Überleben. Sein Mund war trocken, auf seiner Stirn kribbelte es, und als er mit dem Handrücken darüber fuhr, spürte er, dass sie nass von kaltem Schweiß war.
Er musste Martha wegschaffen. Hier konnte sie nicht bleiben. Doch wohin und wie? Er hatte kaum die Kraft gehabt, in den Keller hinunterzugehen. Wie sollte er die kräftige alte Frau transportieren? Und womit? Er hatte ja nicht einmal mehr einen Wagen. Jake schleppte sich aus dem Verschlag und drückte die Tür hinter sich zu. Der Anblick der Toten hatte ihm das Denkvermögen ausgesaugt. Er setzte sich auf die Holzkiste, auf der noch immer die Metalldose mit den restlichen Kondomen lag, und streckte das verletzte Bein von sich. Die Wunde pochte und stach. Seine Kopfschmerzen waren besser, aber nicht weg. Es war, als habe sich das Medikament zwischen ihn und sein geprelltes Gehirn geschoben und ihm damit vorübergehend Linderung verschafft. Jake stützte einen Ellbogen auf das gesunde Bein und das Kinn in die Hand. Er konnte die Großmutter nicht aus dem Haus schaffen. Er wusste nicht, wohin mit ihr, und er wusste nicht, wie er sie hätte transportieren sollen, ohne Auto. Er brauchte eine andere und schnelle Lösung. Er stemmte sich von seinem Sitzplatz hoch. In der Garage lagen genug Mauersteine, und ein Sack Mörtel war auch noch da. Großmutter Martha würde ihre letzte Ruhe hier im Haus finden.
Jake arbeitete drei Stunden lang. Zeitweise fürchtete er, vor Erschöpfung und Schwäche ohnmächtig zusammenzubrechen, doch irgendwann war dieser Punkt überwunden und er bewegte sich monoton und ohne Pause vorwärts. Er schleppte die Steine einzeln über die Verbindungstreppe von der Garage ins Haus, weil ihm die Kraft für mehrere Steine gleichzeitig fehlte und er sich zudem am Geländer festhalten musste. Er rührte den Mörtel im Keller an, hob die Holztür aus den Angeln, was viel leichter ging, als er vermutet hatte, und schob sie zur Großmutter in den Verschlag. Sorgsam und der Länge nach legte er die Tür hinter dem gekrümmten Rücken der alten Frau ab, mit etwa einem halben Meter Abstand.
Widersinnigerweise ging ihm durch den Kopf, dass sie sich im Rücken wehtun könnte, wenn sie sich für eine bequemere Lage umdrehte und auf die Türklinke stieß. Er verdrängte seine verrückten Gedanken, brach die Angeln aus den alten Mauern des Kellers, verschmierte die Bruchstellen mit Mörtel und packte Stein auf Stein. Ehe er die letzte Reihe schloss, warf er noch einen Blick auf die Tote. Es war unfassbar. Er hatte das nicht gewollt, wahrhaftig nicht. Heiß durchzuckte es ihn. Er hatte den schmalen Lichteinlass unter der Kellerdecke übersehen. Schweiß sammelte sich an seinem Hals.
Der Spalt, ursprünglich ein Fenster von etwa zwanzig Zentimeter Höhe auf dreißig Zentimeter Breite, war seit Jahrzehnten von unten bis zur Hälfte mit einem Holzbrett abgedichtet. Marthas Vater war, so hatte ihm die Großmutter erzählt, der Meinung gewesen, dass zu viel Tageslicht in den Verschlag drang, in dem er Kartoffeln lagerte. Ganz verschließen wollte er das Fenster aber auch nicht, damit der Luftaustausch funktionierte. Jake rieb sich den Nacken. Er war hysterisch. Von außen kam niemand an den Lichteinlass heran, denn mittlerweile wucherten an entsprechender Stelle seitlich des Hauses Rosenbüsche mit dichtem Unterholz. Kein Grund also, die mühsam errichtete Mauer teilweise wieder einzureißen, um ein vermeintliches Versäumnis nachzuholen – zumal er völlig am Ende seiner Kräfte war.
Jake mauerte den Verschlag dicht, verschmierte reichlich Mörtel, um ja keinen Spalt offen zu lassen, und betrachtete sein Werk. Die frisch gesetzten Steine waren dunkler als die übrigen im Keller. Deutlich hob sich der ehemalige Durchgang ab. Er würde etwas davorstellen, einen Schrank oder das schmale Regal mit Rückwand, in dem Großmutter Martha immer ihr eingelegtes Obst aufbewahrte. Aber das hatte Zeit bis morgen. Er klebte vor Schmutz, weigerte sich nicht länger, die zitternde Schwäche wahrzunehmen, und er hatte tatsächlich Hunger. Jake schleppte sich die Treppe ins Haus hinauf. Morgen würde er im Keller aufräumen, das Werkzeug in die Garage zurückbringen, den leeren Papiersack, in dem der Mörtel gewesen war, im Ofen verbrennen, das Regal vor die auffällige Stelle an der Wand schieben. Morgen. Jetzt wollte er duschen, diese schrecklichen Klamotten loswerden und etwas essen, falls noch etwas da war. Und unten lag Martha und kam nie wieder. Nie wieder würde sie seine Wäsche waschen, ihm etwas zu Essen hinstellen oder sich nörgelnd erkundigen, ob er denn auch genug für die Uni und sein Studium tat. Die Uni – er war seit Tagen nicht mehr dort gewesen. Er würde auch die nächsten Tage zu keiner Vorlesung gehen. Erst musste er versuchen, seinem Leben wieder ein Stück Normalität zu geben. Er würde mit einer Dusche anfangen.
Äußerlich fühlte sich Jake eine dreiviertel Stunde später etwas besser, nachdem er Schmutz, Schweiß und Staub abgespült und frische Wäsche angezogen hatte. An seiner Verletzung am Oberschenkel war einer der Fäden gerissen, die die Wunde zusammenhielten. Blut war sein Bein hinuntergelaufen, und die Stelle klaffte klein, aber hässlich auf. Er hatte ein Pflaster darüber geklebt.
Jake war auf dem Weg zur Küche, als das Schrillen des Telefons die Stille des Hauses durchschnitt. Bestürzt hielt er im Laufen inne, und nackte Panik kroch seinen Rücken hinauf. Das Läuten wollte nicht aufhören, und langsam löste sich seine Erstarrung. Egal wer der Anrufer war – er konnte und würde ihm nichts tun. Niemand außer ihm wusste, dass er eben seine Großmutter im Keller eingemauert hatte. Er ging in den Flur zum Schuhschrank, auf dem der altmodische Apparat stand, der noch eine Wählscheibe hatte, und nahm den Hörer ab. Neben dem Telefon lag Marthas Schlüsselbund. Mechanisch hob er ihn auf und hängte ihn an die Hakenleiste neben der Garderobe.
»Almond«, meldete er sich.
»Jake? Bist du es? Hier ist Lydia. Ist Martha gut heimgekommen? Kann ich sie sprechen?«
Lydia Clarks. Wie der Stich eines Pfeils traf es Jake von der Kehle bis in den Magen. Großmutters Freundin aus Dublin, bei der er sie zu Besuch vermutet hatte, an jenem unglückseligen Nachmittag. Vor seinen Augen wurde es dunkel und sein Gehirn verknotete sich.
»Jake? Bist du noch dran?«
»Klar.« Nachdenken, er musste nachdenken.
»Ich versteh das nicht, Lydia. Ich dachte, Großmutter ist bei dir?« Er musste Zeit gewinnen. Welches Datum war heute? Heute Morgen war der 19. März gewesen, also war noch immer der 19. März. Martha hatte am 22. März zurückkommen wollen. Gut, daran konnte er sich festhalten.
»Bei mir?« Lydia schnappte hörbar nach Luft. »Sie war bei mir. Sie ist aber schon vor ein paar Tagen zurück nach Hause gefahren. Gerrit hat vorzeitig Wehen bekommen, und ich musste ex und hopp nach Manchester fliegen. Sie ist also nicht da? Hat sie sich denn gar nicht gemeldet?«
Deswegen also war Martha eher nach Hause gekommen. Lydias Tochter, die ein Kind nach dem anderen produzierte, war mal wieder schwanger und hatte die Hilfe ihrer Mutter gebraucht, die existierenden Blagen in Schach zu halten, während das nächste kam.
»Nein.« Er versuchte, Verwunderung in seine Stimme zu legen.
»Das passt überhaupt nicht zu Martha. Meine Güte, wo könnte sie denn sein?«
»Ich hab ehrlich keine Ahnung. Wann genau ist sie denn von Dublin losgefahren?«
»Am Montag. Sie hat den Zug um zwölf Uhr zehn genommen. Ich hab sie hingebracht und bin dann weiter zum Flughafen.«
»Du erschreckst mich jetzt wirklich, Lydia. Ich hab von Großmutter nichts gehört und nichts gesehen. Ist aber andererseits kein Wunder, ich war ein paar Tage im Krankenhaus.« Kurz erzählte er Lydia von seinem Unfall.
»Das ist ja alles ganz furchtbar. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß niemand, mit dem Martha sich noch für ein paar Tage getroffen haben könnte, noch dazu, ohne sich zu melden«, klagte Lydia. »Ich mache mir beileibe Sorgen.«
Für einen Augenblick war Jake in Versuchung, Lydias Befürchtungen kleinzureden. Dann überlegte er es sich anders.
»Du hast recht, das passt nicht zu Großmutter. Wir müssen etwas tun, ich weiß nur nicht, was. Außer dir hat sie keine Freunde, bei denen sie ein paar Tage bleiben würde. Es sei denn, sie ist alleine irgendwo.«
»Nein, nein. Allein ist sie nirgends. Es muss was passiert sein. Martha fährt doch nirgends allein hin. Da wüsste sie gar nichts mit sich anzufangen. Du musst sie vermisst melden. In den Zug ist sie gestiegen, das weiß ich. Sie hat ihn quasi im letzten Moment erwischt. Wir haben uns extra beeilt, zum Bahnhof zu kommen, weil das die einzige Verbindung an dem Tag war, bei der sie nicht umsteigen musste. Sie meinte, bis spätestens vier Uhr zu Hause zu sein.«
»Liebe Zeit, das ist schon sehr seltsam.« Jake rieb sich den Nacken, und für einen Moment glaubte er selbst daran, dass Martha irgendwo auf ihrer Heimreise verschwunden war.
»Jake, du musst zur Polizei gehen! Hier stimmt was nicht.«
»Ja. Ja, das mache ich. Ich rufe sofort an. Entschuldige Lydia, ich bin noch nicht ganz fit und das gibt mir eben echt den Rest. Ich hab in der Klinik noch gesagt, es darf auf keinen Fall jemand Großmutter von meinem Unfall berichten, damit sie sich nicht unnötig aufregt. Und jetzt erfahre ich, dass sie seit Tagen wieder daheim sein sollte. Lass uns auflegen. Ich sag dir Bescheid, sowie ich was in Erfahrung bringe, okay?«
»Mach das. Und dir auch gute Besserung«, wünschte Lydia.
Jake blieb neben dem Apparat stehen. Seine Kopfschmerzen schwollen wieder an, das Medikament ließ rasant in der Wirkung nach. Lydia hatte recht. Er musste Großmutter Martha vermisst melden. Über kurz oder lang würde es Fragen geben, wo die alte Dame abgeblieben war. Vom Postboten, der immer schlecht gelaunt war, weil er keine Lust hatte, die Post und die Tageszeitung in diese Einöde zu bringen, in der die alte Schaffarm lag. Oder von Marthas Hausarzt, mit dem sie ab und an telefonierte. Nicht weil es gesundheitlich erforderlich war, sondern weil sie mit seinem Vater zur Schule gegangen war und sie Doctor Thomas Darragh wie einen Neffen ansah. Sogar die Bäckersfrau aus Clifden musste er befürchten, denn sie rief Martha immer an, wenn sie Cheddar-Scones im Sortiment hatte, und fragte, ob sie ihr ein Pfund dieser käsehaltigen Brötchen beiseitelegen sollte. Er konnte ja schlecht allen Leuten gegenüber behaupten, sie sei zu Hause ausgezogen und er wüsste nicht, wohin. Jake nahm aus der obersten Schublade des Schuhschrankes das abgegriffene Telefonbuch und suchte die Rufnummer der Polizeistation in Galway heraus. Er ließ sich mit der Abteilung für vermisste Personen verbinden. Der zuständige Constable reagierte gelangweilt, nachdem Jake sein Anliegen mit besorgter Stimme vorgetragen hatte.
»Wann, sagten Sie, sollte sie nach Hause kommen?«, fragte er bereits zum zweiten Mal. Jake hörte, dass er während des Gespräches in einen Computer tippte.
»Am Montag, dem 16. März. Gegen vier Uhr.«
»Und es kann nicht sein, dass sie gekommen ist und gleich wieder gegangen? Da sind Sie sicher?«, hakte der Mann nach.
»Ja.«
»Das heißt, Sie haben auf sie gewartet und sie ist nicht erschienen?«
»Gewartet habe ich nicht auf sie. Ich wusste ja nicht, dass sie eher nach Hause kommen wollte. Aber ich war hier und sie ist nicht erschienen«, erwiderte Jake.
»Haben Sie schon die Krankenhäuser angerufen? Vielleicht ist sie umgekippt, hatte einen Schwächeanfall oder so«, schlug der Constable vor.
»Nein. Daran hab ich nicht gedacht«, erwiderte Jake. Er sehnte sich nach einem Stuhl. Nun stand er schon minutenlang im Flur und telefonierte.
»Ich schlage vor, Sie rufen zuerst dort an. Wenn das nichts ergibt, können Sie sich ja noch mal melden. Aber ich sage Ihnen gleich, dass wir eigentlich nichts tun können, wenn nicht der Verdacht auf ein Verbrechen vorliegt. Ihre Großmutter ist eine erwachsene Frau, sie kann gehen, wohin sie will, und muss auch niemandem Bescheid sagen.«
»Da haben Sie sicher recht. Aber ich kenne meine Großmutter. So ein Verhalten passt nicht zu ihr«, gab er zurück.
»Das haben schon viele gedacht. Wenn sie ursprünglich erst am 22. zurückkommen wollte, kann sie sich unterwegs überlegt haben, bis dahin noch jemand anderen zu besuchen. Vielleicht fallen Ihnen noch Bekannte oder Freunde ein, bei denen sie sein könnte.«
»Ja, vielleicht.«
»Gut. Dann verbleiben wir so. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Fragen Sie nach Russ Gibson, falls Sie noch mal anrufen möchten.«
»Danke, Mister Gibson.«
Jake legte den Hörer auf. Er war sich nicht sicher, ob das Gespräch gut gelaufen war. Er hatte vergessen, den gesundheitlichen Zustand von Martha zu erwähnen, und dass sie ihre Medikamente brauchte. Das hätte dem Constable vielleicht Druck gemacht und hätte ihn, Jake, überzeugender wirken lassen. Er stopfte das Telefonbuch in die Schublade zurück. Er brauchte etwas zu essen, zwei Schmerztabletten und endlich erholsamen Schlaf. Nicht den künstlichen, durch Arzneimittel erzeugten Schlaf, aus dem man völlig verwirrt und zerschlagen wieder auftauchte.
Im Kühlschrank lagen Speck und Eier, im Gefrierfach etliche Scheiben Toast. Das reichte für ein Abendessen. Jake briet den Speck aus, schlug die Eier darüber und steckte das Brot in den Toaster. Er aß langsam. Obwohl er Hunger hatte, fiel ihm jeder Bissen schwer. Im Keller direkt unter ihm lag die Großmutter. Sie würde nie wieder in der Küche herumwerkeln, während er am Tisch saß und aß. Es schnürte ihm den Magen zu. Er hatte die halbe Portion geschafft, als wieder das Telefon schellte. In der Annahme, Lydia wollte sich vergewissern, ob er die Vermisstenmeldung aufgegeben hatte, ging Jake schwerfällig an den Apparat.
»Almond.«
»Jake, hier ist Justin. Alles okay bei dir? Du bist seit Tagen bei keiner Vorlesung mehr gewesen, und auf meine SMS heute Nachmittag hast du nicht geantwortet.« Jake überlegte flüchtig, wo sein Handy überhaupt war. Es musste noch in seiner Jackentasche sein.
»Nix ist okay, gar nix.« Er hatte genug davon, im Stehen zu telefonieren, nahm den Apparat vom Schuhschrank und setzte sich damit auf den Boden, um Justin Bericht zu erstatten. Justin war einer der wenigen Kommilitonen, mit denen sich Jake auch außerhalb der Uni ab und an traf. Vor allem war er einer der wenigen, die ihn nicht ständig damit nervten, sich mit dem anderen Geschlecht zu vergnügen.
»Schöne Scheiße«, fasste Justin zusammen, nachdem Jake mit seinen Ausführungen fertig war. »Dann ist deine Großmutter am selben Tag verschwunden, als du den Unfall hattest.«
»Allerdings. Und die auf der Polizei reagieren nicht. Der Constable sagt ernsthaft, Großmutter sei schließlich erwachsen. Was mach ich denn, wenn sie gar nicht mehr zurückkommt?«, fragte er aufgebracht.
»So weit ist es ja noch nicht. Vielleicht hat sie sich wirklich überlegt, noch jemand zu besuchen.«
»Ich wüsste nicht, wen. Ich rufe trotzdem morgen jeden an, mit dem sie Kontakt hat. Vielleicht weiß jemand was«, sagte Jake. »Ach, da fällt mir was ein. Mein Auto ist hinüber. Hat dein Vater gerade was Günstiges zu verkaufen? Ich brauch nix Besonderes, es muss nur schnell gehen. Ich bin ja hier draußen völlig von der Welt abgeschnitten ohne Wagen.«
»Klar, Vater hat immer was. Ich sprech mit ihm, und wenn was für dich dabei ist, bring ich dir das Auto. Du musst mich hinterher nur wieder heimfahren. Was darf es denn kosten?«
»So wenig wie möglich.«
»Schauen wir mal. Ich melde mich, okay?«
Jake beendete das Gespräch. Er fühlte einen Funken Erleichterung, zumindest das Auto-Problem bald gelöst zu haben. Justins Vater, der seit Jahrzehnten in Ennis einen Gebrauchtwagenhandel betrieb, würde ein finanzierbares Gefährt für ihn auftreiben. Er war in Versuchung, den Apparat abzustecken, ließ es dann aber. Es sollte alles so normal wie möglich aussehen. Lydia brachte es fertig und schickte ihm sofort die Polizei ins Haus, wenn sie ihn nicht mehr erreichte. Und seine Handynummer dürfte sie kaum haben. Apropos, das Handy. Jake fand es, wie vermutet, in der Jackentasche. Die Jacke hatte einen Riss auf der rechten Vorderseite und war voll getrocknetem Blut. Er würde sie wegwerfen.
Jake öffnete das Menü des Mobiltelefons, las Justins SMS, in der er nur fragte, ob alles in Ordnung wäre, und sah einen unbeantworteten Anruf. Er klickte ihn an. Die Nummer sagte ihm nichts, aber Datum und Uhrzeit des Eingangs. Es war Montag, der 16. März, Punkt 19 Uhr. Blitzartig war die Erinnerung wieder da. Er war in hoher Geschwindigkeit über die N 59 gebraust, um so rasch wie möglich Martha zu befreien, als der Apparat geklingelt hatte. Vor Schreck hatte er das Steuer verrissen, dann war er über den Straßenrand hinausgeschossen. Damit hatte der Anrufer sozusagen für den Unfall und infolgedessen für Marthas Tod gesorgt. Jake drückte auf ›Nummer verwenden‹. Nach dem zweiten Läuten kam die Bandansage einer Telefongesellschaft, die Werbung für einen neuen Mobilfunkvertrag machte. Jake ließ den Arm sinken, mit dem er das Gerät ans Ohr gehalten hatte. Seine Großmutter war wegen eines Werbeanrufes gestorben, der ihn bei überhöhter Geschwindigkeit erschreckt hatte. Hätte er sich nicht so kraftlos gefühlt, er hätte das Handy zertreten mögen. Sein Blick fiel auf Marthas Koffer, der wie eine stumme Anklage im Flur stand. Er sollte ihn sofort wegräumen. Eine gewaltige Schwäche überkam ihn, und er fühlte kalten Schweiß aus sämtlichen Poren kriechen. Der Koffer musste bis morgen warten.
Jake nahm zwei Schmerztabletten und legte sich ins Bett. Die Tabletten wirkten nach einer halben Stunde, der Schlaf aber wollte nicht kommen. Als er im Morgengrauen schließlich doch eindämmerte, plagten ihn Albträume. Schweigend und übergroß stand Martha vor ihm, hinter ihm und über ihm, wie eine Macht die ihn umzingelte, immer näher kam und ihn ersticken wollte. Schweißgebadet fuhr Jake hoch. Durch die zugezogenen dunkelroten Vorhänge in seinem Schlafzimmer blinzelte die Morgensonne. Er sah auf den Wecker neben seinem Bett. Kurz nach acht Uhr. Ein paar Minuten blieb er liegen, ehe er aufstand, um sich anzuziehen. Als er auf dem Weg hinunter ins Erdgeschoss war, erblickte er Marthas Koffer, der noch immer im Flur stand. Er schleppte ihn die Treppe hoch, stieß die Tür zum Schlafzimmer der Großmutter auf, das am Ende des Flures lag, und schob ihn hinein. Er würde sich später überlegen, ob er ihn ausräumen oder samt Inhalt über die Cliffs of Moher werfen sollte, wenn die Straßensperre wieder weg war.
Jake schloss die Tür, ging hinunter in die Küche, setzte Teewasser auf und hörte von der Straße her ein Motorengeräusch. Mit gerunzelter Stirn trat er ans Fenster. Ein orange-roter R5 älteren Baujahres rumpelte über die Zufahrt zur Schaffarm. Die letzten 200 Meter waren nicht betoniert, sondern bestanden aus einer festgefahrenen Schicht Kies und machten dem klapprigen Fahrzeug sichtlich zu schaffen. Jake versuchte den Fahrer hinter dem Steuer auszumachen, doch die Morgensonne blendete ihn. Er war sicher, es war jemand, der sich verfahren hatte und nun nach dem Weg fragen wollte. Der R5 parkte direkt am Gartenzaun, und damit etwa zu einem Drittel auf der Schotterstraße. Die füllige Frau, die ausstieg, kam Jake vage bekannt vor. Er kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Sie blieb stehen und betrachtete einen Moment das Haus, ehe sie um das Auto herumlief und aus dem Kofferraum einen Korb heraushob. Zielstrebig machte sie sich auf den Weg zur Tür. Zwei Schläge mit dem Türklopfer hallten durchs Haus. Jake ging öffnen.
Es dauerte einige Sekunden, ehe er in der Frau mit den derben Wildlederstiefeln und dem zu engen schwarzen Parka die Krankenschwester aus der Klinik erkannte. Genau genommen erkannte er sie erst, als sie die Lippen zu einem künstlichen Lächeln auseinanderzog.
»Jake, wie schön, Sie halbwegs munter zu sehen! Guten Morgen. Ich habe gehört, Sie wollten unbedingt vorzeitig nach Hause. Ich hoffe, ich störe nicht?«, plapperte sie los und streckte ihm die Hand entgegen. Zögerlich nahm er sie. Ihre Haut war kühl und trocken, der Händedruck nicht fest genug für seinen Geschmack.
»Sie erinnern sich doch an mich?«, fuhr sie fort, als er keine weitere Reaktion zeigte.
»Doch natürlich. Aus der Klinik«, erwiderte er. Ihm fiel auf, dass sie ihn beim Vornamen genannt hatte, und sie sah aus, als würde sie so rasch nicht wieder gehen.
»Lacey Stone, genau. Darf ich reinkommen?« Sie hob ihren Korb ein Stück in die Höhe. »Ich habe Ihnen ein paar Kleinigkeiten zu essen mitgebracht. Ich dachte, solange Ihre Großmutter verreist ist, kümmert sich vielleicht niemand um Sie. Oder ist sie schon zurück?«
»Nein.« Er rührte sich nicht von der Stelle. Jemand, der sich um ihn kümmerte, hatte ihm gerade noch gefehlt.
»Ich habe Cheesecakes gebacken, und Schinken und Soda-Brot gekauft. Wenn Sie möchten, koche ich Ihnen einen Tee dazu, dann können Sie sich hinsetzen und ausruhen. Oder haben Sie schon gefrühstückt?«
In der Küche begann der Teekessel zu pfeifen. Jake zwang sich zu einem Lächeln.
»Nein, aber wie Sie hören, ist das Teewasser gerade fertig. Es ist sehr nett, dass Sie sich Gedanken um mich machen, aber es ist wirklich nicht nötig. Ich komme gut zurecht.«
»Ich mache es gern. Und jetzt koche ich Ihnen den Tee. Sie sind ja gewissermaßen noch Patient«, entschied sie und stellte ihren Fuß auf die Stufe vor der Haustür.
Er hätte unhöflich sein können und sie wegschicken. Appetit auf den Schinken hatte er schon, doch nichts rechtfertigte das Eindringen einer Lacey Stone in sein Leben, und wenn es nur für einen Krankenbesuch war. Lacey schob sich an ihm vorbei.
»Die Küche ist hier vorne?«, erkundigte sie sich überflüssigerweise, denn die Tür stand offen und man sah direkt auf den Herd, auf dem der Teekessel stand. Der Wasserdampf entwich lautstark als heiße Nebelfahne. Jake stieß einen brummenden Ton aus, den man kaum als Zustimmung verstehen konnte, und beobachtete, wie die füllige Frau ihren Korb auf seinem Küchentisch abstellte.
»Es war übrigens gar nicht so einfach, hierher zu finden, obwohl ich selber in der Gegend wohne und groß geworden bin. Ich wohne in Clifden. Na ja, in Clifden kann man das eigentlich nicht mehr nennen, sondern mehr ganz am Rand. Aus der Klinik wusste ich Ihre Anschrift und dachte, ich finde schon her. Aber in dieser Ödnis hat das Navi gestreikt.«
Sie griff in ihren Korb, zog eine Tageszeitung heraus, die zwischen den Lebensmitteln steckte, und reichte sie ihm.
»Hier, Ihre Zeitung. Ich habe an der einzigen Kreuzung nach hierher einen Postboten getroffen und nach dem Weg gefragt. Er hat mich gebeten, Ihnen die Zeitung gleich mitzubringen. Mehr Post ist es heute nicht.«
Jake schmeckte Galle. Er würde sich den Mann beim nächsten Besuch vorknöpfen. Lacey zog ihre Jacke aus, legte sie über einen Stuhl und nahm den Kessel vom Herd.
»Miss Stone, Sie brauchen sich keine Mühe zu machen. Ich fühle mich gut und ich kann das alleine«, machte er einen weiteren Versuch, ihren Aktionismus zu stoppen.
»Lacey. Sagen Sie bitte Lacey zu mir. Schon gut. Eigentlich gehören Sie ins Krankenhaus und ins Bett. Außerdem habe ich heute frei, es macht mir keine Mühe. Wo sind die Teeblätter?«, fragte sie. Jake deutete stumm auf eine Anzahl bunter Metalldosen, die ordentlich aufgereiht auf der Arbeitsfläche direkt an der Wand standen.
»Teller und Tassen?«, forschte sie weiter.
Fünf Minuten später hatte Lacey den Tisch für zwei Personen gedeckt und schenkte den Tee ein. Jake gab sich geschlagen, war jedoch wild entschlossen, so ein Vorgehen kein zweites Mal zuzulassen. Je gründlicher er sie beobachtete, umso mehr hatte er den Eindruck, sie würde gerade in seiner Küche die Herrschaft an sich reißen. Nach der kurzen Stippvisite einer besorgten Klinikschwester sah ihr Verhalten jedenfalls nicht aus.
Er zwang sich, ein Stück Schinken und eine kleine Scheibe Soda-Brot zu essen und vermied es, Lacey dabei zuzusehen, wie sie selbst frühstückte. Ob es ihm recht war, hatte sie nicht gefragt. Ihm ging durch den Kopf, wie Großmutter Martha reagieren würde, wenn sie ihn in dieser Zweisamkeit hier anträfe, und plötzlich schoss helle Panik in ihm auf. Was, wenn Martha plötzlich in die Küche kam und Lacey anklagend erzählte, dass er sie getötet hatte? Das musste er unbedingt verhindern. Lacey musste fort, und zwar rasch. Er umklammerte das Messer, mit dem er den Schinken geschnitten hatte. Schweiß sammelte sich auf seinem Rücken.
›Fang bloß nicht an zu spinnen!‹, befahl er sich. ›Martha ist tot. Sie kann nicht in die Küche kommen und …‹
Der Türklopfer donnerte an die Haustür und unterbrach seine wirren Gedanken. Jake fuhr zusammen und stieß mit dem Handrücken an die Teetasse. Das noch immer heiße Getränk schwappte über und traf seine Haut.