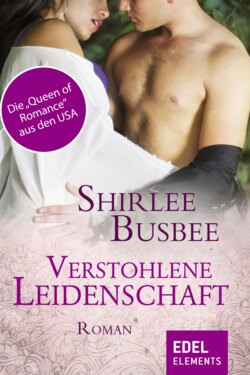Читать книгу Verstohlene Leidenschaft - Shirlee Busbee - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. KAPITEL
Shelly parkte am Inspiration Point, von wo aus man das ganze Oak Valley überblicken konnte, und stellte den Motor aus. Um sie herum herrschte plötzlich vollkommene Stille. Den größten Teil ihres Erwachsenenlebens hatte Shelly in New Orleans mit dem unablässigen Gewühl und Lärm einer Metropole verbracht. Eine solche Ruhe hatte sie seit Jahren nicht mehr erlebt. Seit siebzehn Jahren, um genau zu sein.
Sie blieb in ihrem neuen, dunkelgrauen Bronco sitzen und ließ diese Stille auf sich einwirken. Ihre von der langen Fahrt verkrampften Muskeln entspannten sich allmählich, und ihre strapazierten Nerven kamen zur Ruhe. Außerhalb des Fahrzeugs herrschten Schweigen und Dunkelheit. Nur das Glitzern der Sterne und das einladende Flimmern der Lichter unten im Tal waren zu sehen.
Shelly hatte sich entschieden, in der Nacht zurückzukehren, obwohl man sich auf der schmalen, zweispurigen Straße nach St. Galen’s, der einzigen Stadt im Oak Valley, schon tagsüber absolut konzentrieren musste. Nach Einbruch der Dunkelheit jedoch verlangten die fast dreißig Meilen Serpentinen und die engen Kurven noch viel mehr Aufmerksamkeit. Dann schienen sie den Fahrer geradezu anzuspringen. Außerdem konnten urplötzlich Rehe, Skunks, Waschbären, gelegentlich sogar ein Bär oder eine Wildkatze im Scheinwerferlicht auftauchen. Manchmal lauerten an einigen Stellen auch Felsbrocken eines kleinen oder größeren Steinschlages auf dem schwarzen Asphalt, was die Fahrt interessant machte. Um nicht zu sagen, halsbrecherisch.
Shelly lächelte und nahm den kirschroten Pullover vom Beifahrersitz. Die Straße nach St. Galen’s war vermutlich einer der Hauptgründe, warum Oak Valley in den letzten einhundertfünfzig Jahren, seit sich der erste weiße Mann in das Tal verirrt hatte, nicht wesentlich gewachsen war. Früher einmal hatte Shelly diese Straße geliebt, die sie, wie viele andere im Tal, ihre »lange Auffahrt nach Hause« nannte. Aber während ihrer jahrelangen Abwesenheit hatte Shelly vergessen, wie gewunden und schmal sie war. Den Fehler mache ich nicht noch einmal, dachte sie. Von nun an, Kindchen, wirst du schön brav bei Tageslicht hier herumkurven.
Shelly stieg aus ihrem warmen Fahrzeug aus und hielt unwillkürlich den Atem an, als die Kälte sie wie ein Schlag traf. Sie hatte vergessen, wie eisig es selbst Mitte März noch in den Bergen Nordkaliforniens sein konnte.
Sie schlang die Arme um ihre schlanke Gestalt, schlenderte zum Rand der Parkbucht und blickte in das Tal hinab. Sie war auch deshalb in der Nacht zurückgekehrt, weil sie nicht sofort von den Veränderungen überfallen werden wollte; die anderthalb Jahrzehnte sicherlich mit sich gebracht hatten. Außerdem entging sie so zunächst den neugierigen Blicken der Einwohner. Shelly seufzte und betrachtete die blinkenden Lichter der Stadt. Die nächsten Wochen dürften schwierig werden. Der tragische Tod ihres Bruders lag noch nicht lange zurück, und wenn sich ihre Ankunft erst einmal herumgesprochen hatte, würden viele wohlmeinende Menschen aufkreuzen und Shelly ihr Beileid aussprechen. Allerdings würde ihre Rückkehr nach so vielen Jahren auch einige nicht so wohlgesonnene Besucher auf ihre Schwelle locken.
In St. Galen’s und einem Umkreis von dreißig bis vierzig Meilen lebten nur knapp fünftausend Menschen, die sich über diese gewaltige Fläche aus Bergen und Wäldern verteilten. Was durchaus sein Gutes hatte. Denn hier im Tal kannte jeder jeden und die meisten waren miteinander verwandt, wenn auch nur entfernt. War jemand in Not oder steckte in Schwierigkeiten, wurden sehr rasch die Nachbarn zusammengetrommelt. Aufgrund der Abgeschiedenheit von Oak Valley bedeutete das, jeder half hier jedem. Shelly verzog spöttisch die Lippen. Von einigen wenigen, bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen. Zum Beispiel von ihrer Familie, den Grangers. Und natürlich den Ballingers. Ihren langjährigen Widersachern, oder Feinden, wenn man die Wahrheit ungeschminkt beim Namen nennen wollte. Das erinnerte Shelly an die weniger schöne Seite einer so kleinen und eng verwobenen Gemeinschaft. Jeder wusste über den anderen Bescheid, man kannte sowohl das Schlechte als auch das Gute, und im Tal wurde über jede Kleinigkeit geklatscht und spekuliert. Gab es Feindseligkeiten zwischen zwei Parteien, konnte man sicher sein, dass alsbald alle davon wussten und mit ihren Kumpeln genüsslich den jüngsten Zusammenstoß der Kampfhähne durchkauten. Natürlich wurden die Geschichten ihres Unterhaltungswertes wegen hier und da ein wenig ausgeschmückt. In einer solch kleinen Gemeinschaft führte das dazu, dass Kontroversen reichlich neue Nahrung fanden, und manchmal geschah es auch, dass Fehden sogar einige Generationen überdauerten, wie im Falle von Shellys Familie und den Ballingers. Und wenn man etwas geheim halten wollte ... Shelly stieß verächtlich die Luft durch die Nase. Man konnte nicht einmal am Nordende des Tals niesen, ohne dass augenblicklich am Südende jemand »Gesundheit« wünschte.
Es war nicht leicht, sich daran zu gewöhnen. Natürlich hatte Shelly auch in New Orleans Verwandte und Freunde gehabt, aber das war etwas anderes gewesen. New Orleans war eine riesige Metropole, durch die eine unaufhörliche Flut von Touristen und Durchreisenden strömte. Dort konnte man ohne Probleme in sein Privatleben abtauchen. In Oak Valley kannte einen praktisch jeder von Geburt an, ebenso wie Mutter, Vater und alle anderen Verwandten, und zwar schon seit der Zeit, als Jesus die Masern hatte. Dieser Umstand gestaltete das ganze Zusammen leben ein wenig intimer. Wenn man dann noch im zarten Alter von sieben Jahren mit dem späteren Feuerwehrchef, einem der Deputys und dem Besitzer des größten Lebensmittelladens in der Stadt splitterfasernackt im Teich gebadet hatte, dürfte es geradezu unmöglich sein, sich unnahbar zu geben. Shelly lächelte. Ja, es würde bestimmt schwierig werden, so zu tun, als hätte sie nicht ihre nackten Hintern gesehen. Und da Shelly den Übermut ihrer Jugendfreunde kannte, konnte sie sich nicht vorstellen, dass man sie das vergessen lassen würde. Es sei denn, sie hätten sich wirklich sehr verändert.
Shelly zuckte zusammen, als die Stille von tierischen Lauten zerrissen wurde. Markerschütterndes Bellen und Jaulen kam aus dem Vorgebirge jenseits des Tales. Sie lächelte erfreut, als sie das Geräusch erkannte. Kojoten! Es ist ihnen also nicht gelungen, die Tiere alle auszulöschen, dachte sie zufrieden. Obwohl wir ihnen jahrelang mit Gift, Fallen und Dynamit auf den Leib gerückt sind. Wäre sie Schafzüchterin gewesen oder Besitzerin eines Hühnerhofes, wäre Shelly wohl kaum entzückt gewesen, den Ruf der Tiere zu hören. Aber für jemanden, der immer noch den gedämpften Stadtlärm im Ohr hatte, war es eine Wohltat, diesen Chor in der ansonsten so friedlichen Nacht zu hören. Es amüsierte sie, dass fast jeder Hund in der Stadt dem Geheul der Kojoten antwortete. Morgen früh würde bestimmt eine Menge wütender Hundebesitzer über die Kojoten herziehen, weil sie ihren Ole Blue, oder Jesse oder Traveler, wild gemacht hatten.
Shelly hatte Bedenken gehabt, ob sie nach ihrer langen Abwesenheit von dem Tal und seiner Lebensweise wieder an ihren Geburtsort zurückkehren sollte. Sie hatte befürchtet, dass ihr alles fremd und merkwürdig vorkommen würde, langweilig und trist, nachdem sie beinahe zwei Jahrzehnte in einer der schillerndsten Großstädte der Welt gelebt hatte. Doch als sie jetzt dastand und auf die flimmernden Lichter blickte, die saubere, kalte Luft an ihren Wangen spürte, überraschte es sie, wie gut es sich anfühlte, wieder hier zu sein. Es drängte sie geradezu, das Tal wiederzusehen, ihre alten Lieblingsplätze aufzusuchen und ihre Jugendfreunde wieder zu treffen. Sie war neugierig, wie sich ihr Leben während ihrer Abwesenheit verändert hatte. Aber diese Vorfreude wurde von einem quälenden Gefühl getrübt. Denn was Shelly veranlasst hatte, New Orleans den Rücken zu kehren und nach Oak Valley zurückzukommen, war der Tod.
Sie wurde traurig, als sie an den Grund dachte, der sie nach all den Jahren wieder nach Hause geführt hatte. Während sie in der kühlen Märzluft stand und über das nächtliche Tal blickte, empfand sie dieselbe Ungläubigkeit und denselben Schmerz, der sie durchzuckt hatte, als Mike Sawyer sie vor zweieinhalb Wochen angerufen hatte. Sawyer war der Anwalt ihrer Familie, und er hatte ihr von Joshs Tod berichtet. Es war Selbstmord gewesen.
Josh und sie hatten sich so nahe gestanden, wie das bei Geschwistern möglich ist, die fünfzehn Jahre Altersunterschied trennen. Shelly war eine Nachzüglerin gewesen und hatte ihre Eltern früh verloren. Ihre Erinnerungen an sie waren recht verschwommen. Stanley Granger war erst fünfundfünfzig gewesen, als er sich bei der Suche nach verirrten Rindern mit seinem Jeep überschlagen hatte. Er war auf der Stelle tot gewesen, und Josh war an seine Stelle getreten. Shelly war damals erst sieben, und ihr Bruder wurde zum dominanten Mann in ihrem Leben. Catherine Granger, ihre Mutter, war gestorben, als Shelly in die Pubertät kam. So blieb es an Josh hängen, mit all den Stimmungsschwankungen und galoppierenden Hormonen von Mädchen in diesem Alter fertig zu werden. Shelly lächelte melancholisch. Er hatte sich wacker geschlagen, obwohl er den Launen der Kindfrau, die da vor seinen Augen heranwuchs, meistens ziemlich ratlos gegenübergestanden hatte.
Erneut überfiel Shelly der Schmerz über ihren Verlust. Ich hätte schon früher herkommen sollen, haderte sie mit sich und merkte, wie ihr die Tränen in die Augen traten. Ich hätte ihn besuchen sollen, statt mich mit Telefonaten und seinen gelegentlichen Besuchen zu begnügen. Ich hätte ... Sie atmete zitternd aus. Es würde nichts verändern, wenn sie sich mit der Vergangenheit geißelte.
Wenigstens musste sie keine Beerdigung ertragen und sich nicht den neugierigen Blicken der Bewohner aussetzen, was eine formale Bestattung mit sich gebracht hätte. Sicher wären ihr einige freundlich begegnet, aber es gab auch andere. Josh hatte jedoch schon vor Jahren alle notwendigen Schritte für seine Einäscherung festgelegt und verfügt, dass seine Asche vom Pomo Ridge über das Tal gestreut werden sollte. Es war der höchste Ausläufer des Vorgebirges, welches das Tal vom Westen her begrenzte. Josh hatte ausdrücklich auf einen öffentlichen Gottesdienst im Falle seines Dahinscheidens verzichtet. Darin ähnelte er ihrem Vater, der sich des Öfteren verächtlich über Beerdigungen und Bestattungsinstitute ausgelassen hatte. Zwar hatte etwas in Shelly gegen Joshs letzten Wunsch rebelliert, aber sie hatte seine beißenden Kommentare über Beerdigungen oft genug mitbekommen. Es wäre unfair gewesen, gegen seinen ausdrücklichen Wunsch zu handeln, jetzt, wo er ihn nicht mehr durchsetzen konnte. Seinen Instruktionen zu folgen, die er beim Rechtsanwalt der Familie hinterlegt hatte, war der letzte Dienst, den sie ihm erweisen konnte.
Shelly seufzte, und die Einsamkeit überwältigte sie plötzlich. Sie hatte das Bekannte hinter sich gelassen und musste sich jetzt nicht nur mit dem Tod ihres Bruders auseinander setzen, sondern auch das Unternehmen der Grangers übernehmen. Das war keine Kleinigkeit, denn der Besitz des Granger-Clans war recht beachtlich. Mike Sawyer hatte sie am Telefon bereits in einem Crashkurs darauf vorbereitet, was sie erwartete. Glücklicherweise bestand der größte Teil des Familienvermögens aus Land und Viehbestand, so dass sie sich nicht mit lauter unterschiedlichen Zweigen eines Konzerns auseinander setzen musste. Josh hatte zwar ein Testament hinterlassen, aber das regelte nur seinen persönlichen Besitz. Sawyer hatte Shelly bereits mitgeteilt, dass es darin vor allem um Schenkungen an Freunde und die Familie ging.
Es lebten noch andere Grangers im Tal, Cousinen und Cousins zweiten und dritten Grades, doch nach Joshs Tod war Shelly die letzte lebende Angehörige des Hauptzweiges der Familie. Dieser Gedanke machte sie traurig, und sie fühlte sich noch isolierter. Sie sehnte sich nach den warmen, tröstenden Armen ihrer Verwandten aus Louisiana zurück. Die waren zwar noch entfernter mit ihr verwandt als die Grangers hier aus dem Tal, aber wenigstens kannte Shelly sie, und es war nicht schon fast siebzehn Jahre her, seit sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Fast bedauerte sie es, Romans Vorschlag, sie mit seiner jüngeren Schwester Angelique zu begleiten, ausgeschlagen zu haben. Beide hatten es ihr unabhängig voneinander angeboten, aber Shelly hatte abgelehnt. Ihre Rückkehr nach Oak Valley würde gewiss schon genug für Klatsch sorgen, auch ohne dass sie ihren gut aussehenden Cousin und dessen glutäugige Schwester, eine echte Southern-Belle, mitbrachte. Dann gab es noch Onkel Fritzie, Tante Lulu und die anderen Geschwister von Roman und Angelique. Die Louisiana-Grangers waren eine große Familie und hatten Shelly bereitwillig an ihren Busen oder an ihre Brust gedrückt, je nachdem.
Shelly fühlte sich besser, als sie an Roman, Angelique und die anderen dachte, und kam sich nicht mehr so allein vor. Aber ihre Gedanken schweiften ab, sie sollte sich wieder auf das Tal vor ihr und das, was sie dort erwarten mochte, konzentrieren. Siebzehn Jahre, sinnierte sie. Das ist eine lange Zeit. Sie war achtzehn gewesen, als sie mit gebrochenem Herzen und verletztem Stolz aus dem Tal geflohen war und fast alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte. Die meisten ihrer Freunde hielten sie damals für verrückt, nur einige wenige kannten die Umstände und verstanden sie. Shelly hatte begriffen, wie zartfühlend ihre Freunde gewesen waren, weil sie nicht penetranter nach den Gründen für ihre plötzliche Flucht gefragt hatten. Und sie waren ihr noch mehr ans Herz gewachsen, weil sie den Namen Sloan Ballinger nie mehr nannten. Vor allem mit keinem Wort seine Verlobung mit Nancy Blackstone und die Hochzeit zehn Monate später erwähnten. Shelly schüttelte den Kopf. Was war sie doch für ein Feigling gewesen!
Das Geräusch eines näher kommenden Wagens riss Shelly aus ihren Gedanken. Sie hatte lange genug gezaudert und ging jetzt zu ihrem Bronco zurück. Sie stieg ein und wollte gerade auf die Straße zurückfahren, als das andere Fahrzeug um die Kurve bog. Seine aufgeblendeten Scheinwerfer nagelten sie förmlich auf ihrem Sitz fest und blendeten sie. Shelly kniff die Augen zusammen, als sie von dem hellen Licht getroffen wurde, und blieb regungslos sitzen. Dann verlangsamte das andere Fahrzeug seine Fahrt und blendete seine Schweinwerfer ab. Shelly gab Gas, und einen Moment später glitt der Bronco ruhig die kurvige Straße zur Talsohle hinab. Plötzlich eröffnete sich ihr ein wundervolles Panorama. Es war ein wahres Vergnügen, nach den dreißig Meilen gewundener, schmaler Straße endlich wieder Gas geben zu können und fast über das gerade, ebene Asphaltband zu fliegen, das sich vor Shelly erstreckte. Rechts und links neben der Straße lagen weite Felder.
Fünfundvierzig Minuten und zwei verschlossene Gatter später stieg die Straße wieder an. Es waren noch drei Meilen bis zu ihrem alten Heim. Schließlich hielt Shelly vor dem Haus, in dem Josh gelebt hatte. Es war nicht mehr das Haus, in dem sie aufgewachsen war. Das hatte ihr Urgroßvater noch selbst erbaut, doch es war vor zehn Jahren bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es war ein Wahrzeichen hier im Tal gewesen, ein großes viktorianisches Haus, dessen makelloses Weiß sich vier Stockwerke hoch vom Grün der Bäume ringsum abhob. Alle kannten das Granger-Haus, und die Talbewohner zeigten es voller Stolz jedem Fremden. Josh hatte Shelly am Tag nach der Tragödie angerufen. Ursache war ein Kaminbrand gewesen, der außer Kontrolle geraten war. Da das aus altem Redwood erbaute Haus tief im Vorgebirge lag, hatte die Feuerwehr nichts mehr ausrichten können, als sie endlich eintraf. Bevor das Feuer zu heftig wütete, hatten Josh, der bereits das Schlimmste befürchtet hatte, und einige Helfer, die rechtzeitig eingetroffen waren, in aller Eile die wichtigsten Dinge aus den Fenstern geworfen, hauptsächlich wertvolle Erbstücke. Alles andere war den Flammen zum Opfer gefallen. Die Hitze der lodernden Flammen war so groß gewesen, dass Josh, die Hälfte der Talbewohner, die zu Hilfe gekommen waren, und selbst die Feuerwehr hilflos aus sicherer Entfernung hatten zusehen müssen, wie fast anderthalb Jahrhunderte Familienhistorie und Geschichte des Tals in Flammen aufgingen.
Josh hatte ein neues Haus gebaut, und zwar gegen den eindringlichen Rat fast aller seiner Freunde exakt an derselben Stelle. Es war ein schönes, zweistöckiges Blockhaus mit einem Metalldach, das ringsum von einer breiten, überdachten Veranda umgeben war. Josh vergaß dennoch nicht, warum er neu bauen musste, er installierte ein Sprinklersystem und montierte überall im Haus Rauchmelder. Er hatte sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wollte aber trotzdem nicht darauf verzichten, an einem kalten Abend vor einem warmen Kaminfeuer sitzen zu können. Deshalb befanden sich in einigen Räumen elegante Kamine aus Messing und Keramik, die in eine Verkleidung aus Flusskiesel eingelassen waren. Auf den ersten Blick wirkten sie wie einfache Kamine mit einer Glasfront.
Maria, Joshs mexikanische Haushälterin und Shellys Kindermädchen, lebte in einem kleinen Haus eine Viertelmeile weiter unten an der Schotterstraße. Sie hatte für Shelly eine Lampe auf der Veranda und im Haus brennen lassen, was Shelly dankbar zur Kenntnis nahm, als sie ihren Wagen abstellte. Das Haus wirkte anheimelnd, und die Lichter luden sie zum Eintreten ein. Sie konnte sich fast vorstellen, dass Josh die Stufen heruntersprang, um sie zu begrüßen.
Shelly ignorierte den schmerzlichen Stich. Sie nahm nur ihre Handtasche sowie den kleinsten ihrer Koffer aus dem Wagen, schloss den Bronco ab und ging langsam den breiten, mit Steinen eingefassten Weg zur Vorderseite des Hauses hinauf.
Jetzt endlich gab sie der Erschöpfung nach. Sie hatte sich vollkommen ausgelaugt, seit sie von Joshs Tod erfahren hatte und ihr klar geworden war, dass sie auf unbestimmte Zeit nach Oak Valley zurückkehren würde. Es war so viel zu erledigen gewesen. Sie musste ihren Vermieter benachrichtigen, Strom abmelden, ihre Sachen packen sowie die Möbel und größeren Habseligkeiten verkaufen. Am schwersten fiel es ihr, sich von den Verwandten und Freunden zu verabschieden, die sie in New Orleans zurückließ. Nicht zuletzt wegen der Anteilnahme, die sie Shelly bei ihrer Trauer um Josh entgegengebracht hatten. Wenigstens die Kündigung bei einem Arbeitgeber blieb ihr erspart, da sie als angesehene selbstständige Künstlerin finanziell sehr gut zurechtkam. Einige ihrer engsten Freunde hatten sich allerdings gewundert, dass sie ihre Möbel verkaufte und die Wohnung aufgab. »Willst du nicht nach New Orleans zurückkehren, wenn du Joshs Angelegenheiten geregelt hast?«, fragte Roman sie, und seine smaragdgrünen Augen schimmerten besorgt. Shelly konnte darauf nur mit einem Schulterzucken antworten. Später, im Erste-Klasse-Abteil des Flugzeuges, starrte sie auf die Rollbahn, die unter ihr zurückblieb. Da erst gestand sie sich selbst ein, dass sie die Antwort auf Romans Frage gewusst hatte. Und zwar von dem Moment an, als sie von Joshs Tod erfahren hatte. Nein, sie würde nicht nach New Orleans zurückkehren. Ganz gleich, was sie in Oak Valley erwartete, und ungeachtet, wie schmerzlich diese Rückkehr sein mochte. Shelly holte tief Luft. Sie würde New Orleans für immer den Rücken kehren und nach siebzehn Jahren Abwesenheit für immer nach Oak Valley zurückkommen. Shelly hätte ihre Beweggründe nicht erklären können. Sie musste es einfach tun, selbst wenn man sie deswegen für verschroben hielt. Aber mit dem Ruf, verschroben zu sein, kann ich gut leben, dachte Shelly, als sie jetzt die Tür von Joshs Haus aufstieß und, eintrat. Im Augenblick wollte sie nur eines: ein Bett.
Sie schloss die schwere Eichentür mit den bunten Glasfenstern hinter sich und ging zu der breiten Treppe, welche die große Eingangshalle beherrschte. Josh hatte ihr die Baupläne gezeigt und ihr viel über das Haus erzählt. Obwohl Shelly bisher keinen Fuß hineingesetzt hatte, wusste sie genau, wie es geschnitten war.
Erneut durchströmten sie Schuldgefühle und Sehnsucht, als sie die Tür zu dem größten Gästezimmer im ersten Stock öffnete. Josh hatte ihr auch davon erzählt. Seine Begeisterung für das damals brandneue Haus war ihm deutlich anzumerken gewesen. Wir hätten das zusammen aufbauen können, dachte Shelly und fühlte, wie sich ihr die Kehle zuschnürte. Tränen stiegen ihr in die Augen, und sie biss sich voller Trauer auf die Lippen. Den Raum vor sich nahm sie kaum noch wahr.
Was war ich doch für ein selbstsüchtiges kleines Miststück, dachte sie. In all den Jahren bin ich nicht ein einziges Mal nach Hause gekommen. Es zählte nicht, dass sie jede Woche mit ihrem Bruder lange Telefonate geführt hatte oder dass Josh fast jeden Urlaub ihretwegen in New Orleans verbracht hatte. Wegen mir und seiner Spielleidenschaft, räumte sie ironisch ein. Josh war ein leidenschaftlicher Kartenspieler. Bei seiner Liebe für jede Form des Glücksspiels hätte er auch als Berufsspieler eine großartige Figur abgegeben.
Shelly versank in ihren Erinnerungen an Joshs Lachen, wenn er eine besonders erfolgreiche Nacht erlebt hatte. Und an seine fröhliche Unbekümmertheit, wenn er verlor. »Nächstes Mal sieht’s wieder besser aus«, murmelte er dann und seine grünen Augen funkelten. »Warte nur, du wirst schon sehen. Nächstes Mal läuft es ganz anders.«
Josh war ein Optimist gewesen und hatte sein Leben in vollen Zügen genossen. Shelly konnte einfach nicht glauben, dass er freiwillig daraus geschieden war. Trübselig dachte sie darüber nach, ob Josh wohl noch am Leben wäre, wenn sie sich ihren eigenen Dämonen gestellt hätte und früher zurückgekommen wäre. Hätte sie die Anzeichen seiner Depression wahrgenommen? Oder bemerkt, dass er zum Selbstmord neigte? Und hätte sie ihn davon abhalten können? Diese bitteren Fragen stellte sie sich seit dem Augenblick, als man ihr die Nachricht von Joshs Tod überbracht hatte. Sie hätte keinen besonderen Grund anführen können, warum sie ihn nicht früher einmal, wenn auch nur kurz, besucht hatte. Außer dem Grund, dass du feige bist, flüsterte eine spöttische Stimme in ihrem Kopf.
Shelly wischte sich rasch eine Träne von der Wange. Genug jetzt! Sie war zu Hause, und wenn auch Josh nicht mehr an ihrer Seite war, konnte sie sich trotzdem die Freude vorstellen, die sein Heim ihm bereitet hatte.
Das Gästezimmer, in dem sie stand, war einfach großartig. Es war geräumig und luftig. Eine Wand war von den offenen Deckenbalken bis hinab zum Boden verglast. Durch eine Schiebetür gelangte man auf einen kleinen, teilweise überdachten Balkon, auf dem ein schmiedeeiserner Tisch und Stühle standen.
Der weizenfarbene Teppich dämpfte ihre Schritte, als Shelly umherging und die Möbel betrachtete, die Josh ausgewählt hatte. Sie erinnerte sich an seine Aufregung, als sie geliefert wurden, und seine Freude darüber, wie geschmackvoll alles in dem Raum aufeinander abgestimmt war. »Warte nur, bis du es siehst, Kleines. Es wird dir gefallen«, hatte er ihr bei einem ihrer Endlostelefonate gesagt. »Ich habe sogar ein Himmelbett dafür gefunden.« Josh lachte. »Meine Güte, Honey, ich entwickle mich noch zum Innenarchitekten! Wenn ich anfange, zu affig zu werden, dann schlag mich!«
Seine Worte klangen Shelly noch im Ohr, als sie das Bett an der gegenüberliegenden Wand sah. Der Himmel bestand aus weicher, pfirsichfarbener Gaze, und auf den beiden zum Bett passenden Nachttischen standen Messinglampen. Josh hatte auch sie in dem Telefonat erwähnt, ebenso wie das kleine Sofa neben der Glasschiebetür. Auf dem bedruckten Bezug prangten orangefarbene Mohnblumen und blaue Lupinen.
Shelly stellte ihren Koffer an der Tür ab. Erst jetzt fielen ihr die beiden Türen am anderen Ende des Zimmers auf. Hinter der einen verbarg sich ein begehbarer Kleiderschrank mit eingebauten Regalen und Schubladen, in dem ohne weiteres eine ganze Hochzeitsgesellschaft Platz gefunden hätte. Die andere führte in ein Badezimmer, das für eine zwölfköpfige Familie gereicht hätte. Shelly lächelte.
Sie war zu müde, um sich gründlich einzurichten, trug ihren Koffer in den Schrank und packte nur die notwendigsten Dinge aus. Den Koffer ließ sie auf dem Boden stehen und ging ins Bad. Einige Minuten später hatte sie sich die Zähne geputzt, das Gesicht gewaschen, ihren kurzen, gelben Pyjama angezogen und kletterte ins Bett.
Shelly hatte erwartet, dass sie augenblicklich einschlafen würde. Aber nach der langen Fahrt und der Aufregung über ihre endgültige Heimkehr ins Tal war sie rastlos und zu aufgedreht. Du wolltest doch unbedingt allein hierher zurückkehren, dachte sie spöttisch. Und du hast dich durchgesetzt. Jetzt allerdings wünschte sie sich, sie wäre nicht ganz so halsstarrig in diesem Punkt gewesen. Es wäre nicht schlecht, jetzt mit jemandem reden zu können.
Nachdem sie sich einige Minuten lang unruhig herumgewälzt hatte, gab sie schließlich auf. Hoffentlich hatte Maria so viel Weitblick gehabt, dass sie den Kühlschrank aufgefüllt hatte! Shelly stand auf, ging barfuß die Treppe hinunter und schaltete unterwegs die Lichter an.
Shelly stieß die Schwingtür zur Küche auf. Als das Licht aufflammte, sah sie sich um. Die Küche war heimelig, groß und geräumig. Die braunen, goldgesprenkelten Fliesen auf dem Tresen kontrastierten sehr angenehm mit dem blassen Holz der Eichenschränke an der Wand. Die Bodenfliesen hatten ein buntes mexikanisches Muster, passten jedoch sehr gut zu dem Rest der Küche. Über der Kochinsel in der Mitte des Raumes hingen Messingpfannen, die noch einen weiteren Farbton hinzufügten. Shelly lächelte wehmütig, als sie den kleinen Kamin entdeckte, der in die Rückwand eingelassen war. Josh und seine geliebten Kamine! In der Küche im alten Haus war ebenfalls einer gewesen. Als Kinder hatten sie davor zur Weihnachtszeit Popcorn über den züngelnden Flammen gebacken.
Shelly kämpfte gegen die Tränen an, die ihr bei der Erinnerung daran in die Augen schossen, und trat an den großen Einbaukühlschrank, der ebenfalls mit einer Eichenfront verkleidet war. Wie erhofft, hatte Maria ihn umsichtig mit dem Nötigsten ausgestattet. Shelly nahm eine Milchtüte heraus und holte ein Glas aus einem der Hängeschränke. Einige Minuten später hatte sie sich durch die Bedienungsanleitung der schwarz glänzenden Mikrowelle gearbeitet und schlenderte mit einem Glas warmer Milch in der Hand durch das Haus.
Sie landete in Joshs Arbeitszimmer. Die Täfelung aus knotiger Kieferpaneele und der jagdgrüne Teppich gaben dem Raum einen sehr männlichen Anstrich. Schwere, gemütliche Sessel mit rostbraunem Leder standen vor einem Einbaukamin mit schwarzer Marmorverkleidung. Unter einem der Fenster kauerte eine lange, karierte, Couch, und ihr gegenüber thronte ein großer Eichensekretär mit einer Rolltür. Bücherregale und Fenster säumten die anderen Wände, und Shelly wusste bereits, dass die Glasschiebetür zu einem abgetrennten Patio führte.
Die Sessel kannte sie. Sie befanden sich im Besitz ihrer Familie, seit Shelly denken konnte. Die Legende behauptete, dass der alte Jeb Granger höchstpersönlich sie mitgebracht hatte, als er nach dem Ende des Bürgerkriegs New Orleans den Rücken kehrte. Es hatte Shelly gefreut, als Josh ihr erzählte, dass sie unter den wenigen Dingen gewesen waren, die er beim Brand des alten Hauses aus den Flammen hatte retten können.
Sie glitt mit den Händen über das weiche Leder. Offenbar waren die Sessel neu aufgepolstert worden. Shelly bückte sich und erkannte die schwachen Brandspuren an den Holzbeinen, welche die Restaurateure nicht hatten ausmerzen können. Sie ließ sich in einen der Sessel sinken und starrte ins Leere.
Irgendwie konnte Shelly immer noch nicht fassen, dass Josh tot war. Natürlich ließ ihr Verstand keinen Zweifel daran, aber ihr Herz tat sich immer noch schwer damit, zu akzeptieren, dass er wirklich für immer gegangen war. Im April wäre er fünfzig geworden, und sie hatte ihn wegen dieser runden Zahl mächtig aufgezogen. Soweit sie wusste, war er bei ausgezeichneter Gesundheit gewesen, was seinen Tod noch sinnloser machte. Warum hat er sich umgebracht? Diese Frage stellte sie sich bestimmt zum hundertsten Mal, seit Mike Sawyer ihr die entsetzliche Nachricht von Joshs Tod am Telefon übermittelt hatte. Shelly war sich absolut sicher, dass bei ihrem letzten Telefonat mit Josh nichts darauf hingedeutet hatte, dass er depressiv war oder geplant hätte, sich umzubringen. Sie zögerte. Bis auf einige merkwürdige Kommentare am Anfang ihres Gesprächs, die ihr jetzt wieder einfielen, als sie darüber nachdachte. Shelly schüttelte den Kopf. Du hast einfach eine blühende Phantasie, schalt sie sich. Sie versuchte krampfhaft, Bedeutung in seine Äußerungen hineinzulegen. Er hatte so fröhlich wie immer geklungen, und sie hatten hauptsächlich darüber geredet, wie gut sie sich beim Mardi Gras amüsiert hatten, als er sie im Februar besucht hatte. Das Telefonat endete mit seinem Versprechen, sie in der folgenden Woche anzurufen. Drei Tage später war er mit seinem Lieblingspferd zum Pomo Ridge geritten und hatte sich in der alten Jagdhütte ihrer Familie eine Kugel in den Kopf gejagt.
Shelly stockte der Atem, als ein schmerzhafter Stich sie durchzuckte. Es war einfach undenkbar, sich vorzustellen, wie ihr lachender, lebenslustiger Bruder Hand an sich legte. Aber wenn er sich nicht selbst umgebracht hatte ... Sie runzelte die Stirn. Glaubte sie denn wirklich, dass er es nicht selbst gewesen war? Aus dem Bericht des Coroners ergab sich zweifelsfrei, dass Joshs Tod nicht zufällig herbeigeführt worden war. Man schießt sich nicht aus Versehen in die Schläfe. Welche Möglichkeit blieb dann noch? Mord? Hatte jemand anders ihm die Pistole an die Schläfe gesetzt und abgedrückt? Shelly schüttelte sich. Es fiel ihr genauso schwer sich vorzustellen, jemand könnte Josh umgebracht haben, wie zu akzeptieren, dass er Selbstmord begangen hatte. Alle hatten Josh geliebt! Sie spitzte die Lippen. Außer den Ballingers natürlich.
Die warme Milch hatte den gewünschten Effekt. Gähnend ging sie wieder hinauf in ihr Bett. Sie kuschelte sich unter die Decke, ließ ihre Gedanken schweifen und zwang sich, nicht länger an Josh zu denken. Es war seltsam, hier zu liegen. Weder das Heulen der Sirenen noch das Hupen der Autos oder das Surren und Quietschen der Reifen auf dem Asphalt störte die Ruhe. Und diese Finsternis! Es war vollkommen dunkel bis auf die funkelnden Sterne am Himmel. Keine Straßenlaternen, keine grellen Neonreklamen und keine Scheinwerfer zerrissen das samtige Dunkel. Shelly hatte das fast vergessen. Diese nahezu vollkommene Finsternis war ihr ein klein wenig unheimlich, aber sie widerstand dem Impuls, eine Lampe anzuschalten. Die Stille war ebenfalls ungewohnt für sie. Anfangs beunruhigte es Shelly, nur das Knarren und Knacken des Hauses zu hören. Doch während die Minuten verstrichen, woben die Nacht und die Ruhe ihre Magie. Wie damals, als Shelly noch ein Kind gewesen war. Auch das hatte sie vergessen. Wie sie diese sanfte Ruhe und die beruhigende Dunkelheit vermisst hatte! Plötzlich kam es ihr unbegreiflich vor, wie sie dieses Getöse, das ständige Gewimmel und die grellen Lichter von New Orleans hatte ertragen können. Hier, dachte sie schläfrig, hier gehöre ich hin. Das ist mein Heim. Hierher komme ich.
Shelly konnte es nicht erklären. Sie war lange von zu Hause fort gewesen, und obwohl sie sich immer wieder einredete, dass nichts in Oak Valley sie anzog, hatte immer eine schwache, aber hartnäckige Sehnsucht an ihr genagt, dieses Tal wiederzusehen. Sie wollte wissen, ob es so entzückend war, wie sie es erinnerte. Ob der Himmel so blau war, die Bäche und Flüsse so kristallklar und die Bäume so grün. Sie hatte das Bedürfnis in sich wachsen fühlen herauszufinden, ob die Menschen so freundlich waren, wie ihre Erinnerungen es ihr einflüsterten. Und sie hatte feststellen wollen, ob andere so heimtückisch waren, wie sie glaubte. Schon vor Joshs Tod hatte sie zwei oder drei Mal erwogen, nach Oak Valley zurückzukommen. Shelly runzelte die Stirn. Wenn sie genau darüber nachdachte, schien Josh allerdings davon keineswegs begeistert gewesen zu sein. Er hatte sie zwar nicht direkt entmutigt, aber bestärkt hatte er sie in ihrem Vorhaben auch nicht gerade.
Doch warum war sie dann hier? Jetzt hatte sie eigentlich gar keinen echten Grund mehr für ihre Rückkehr. Sie hatte sich in New Orleans gut eingelebt. Sie war erfolgreich, hatte dort Freunde und eine Familie, selbst wenn es nur entfernte Verwandte waren. Ihr nächster, liebster Verwandter war ohnehin tot. Mike Sawyer würde dafür sorgen, dass der Besitz der Grangers in Oak Valley ordentlich verwaltet wurde. Logisch betrachtet gab es keinen einzigen vernünftigen Grund für ihre Rückkehr, außer vielleicht, dass sie Joshs Asche verstreuen wollte. Und dass ich zurückkehren wollte, gab sie schließlich zu. Das wollte ich schon, seit ich von hier fortgelaufen bin. Schließlich stieß Shelly auf einen noch viel beunruhigenderen Gedanken: Joshs Tod hatte ihr diese Rückkehr überhaupt erst möglich gemacht. All die Jahre in der Fremde hatte sich Shelly eingeredet, wie sehr sie New Orleans liebte, wie glücklich sie mit ihrer Karriere und ihren Freunden war, sie hatte nur Zeit geschunden und auf den Moment gewartet, an dem sie endlich zurückkehren konnte. Ein Teil von dir, gestand sie sich ein, hat unter der Oberfläche geschlummert wie eine Blume, die auf den Frühling wartet. Hatte sie auf die wohlige Wärme der Sonne gewartet, auf die Rückkehr nach Oak Valley, um dann endlich aus der gefrorenen Erde herauszubrechen und wieder zum Leben zu erblühen? Shelly verzog spöttisch den Mund. Wenn sie sich schon mit einer Blume verglich, sollte sie sich lieber fragen, ob wirklich der Frühling hinter der nächsten Biegung wartete. Oder lauerte der Winter noch in den Ecken? Sie schüttelte den Kopf. Eines war sicher: Sie würde es bald herausfinden.