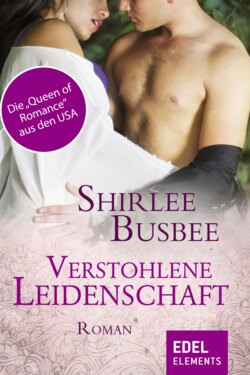Читать книгу Verstohlene Leidenschaft - Shirlee Busbee - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. KAPITEL
Eine Antwort auf diese Frage zu finden, war nicht leicht, und Marias hartnäckiges Schweigen erschwerte die Suche erheblich. Shelly war zwar entschlossen, Maria zur Rede zu stellen, glaubte jedoch nicht, dass sie mehr Glück als Nick haben würde, ihr die Wahrheit zu entlocken. Sie hoffte nur, dass sie sich nach einem Gespräch wohler fühlen würde. Sie wussten schließlich beide, dass sie keine Probe von Joshs DNA mehr zu erwarten hatten, nachdem er eingeäschert worden war.
»Wir könnten ja meine DNA untersuchen lassen«, schlug Shelly schließlich zögernd vor: »Das könnte zumindest beweisen, dass wir verwandt sind.«
»Ja, das wäre vielleicht besser als nichts.« Nick schien wenig begeistert. »Nur kann das nicht beweisen, dass Josh mein guter alter Daddy war.« Er lächelte mutlos. »Trotzdem danke für dein Angebot. Vielleicht bin ich irgendwann so verzweifelt, dass ich darauf zurückkomme. Es würde mir wohl auch weiterhelfen, aber eigentlich will ich etwas Konkreteres. Ich wünschte, wir würden irgendwo über eine Blutprobe von ihm stolpern.«
Shelly nickte. »Du hast Recht. Die brauchen wir für einen richtigen, rechtskräftigen Nachweis der Elternschaft.« Shelly seufzte. »Ansonsten können wir genauso gut den Dixie Doodle pfeifen.«
Nick hatte seine langen Beine ausgestreckt und nickte. »Aber im Moment beschäftigt mich das nicht mehr so sehr. Fürs Erste genügt es mir, dass du mich akzeptierst.« Seine Stimme klang belegt, als er weitersprach. »Es ist ein gutes Gefühl, dass ich mit dir darüber reden kann und du mir zuhörst und mir glaubst.« Sein Blick wurde härter. »Und dass du nicht auf diesen heuchlerischen Mistkerl Sawyer hereingefallen bist.«
»Dieser heuchlerische Mistkerl gehört leider genau zu den Leuten, die wir überzeugen müssen, wenn du öffentlich als Joshs Sohn anerkannt werden willst«, gab Shelly zu bedenken. »Es wird nicht reichen, wenn ich mich hinstelle und erkläre: >He, Leute, ich glaube ihm! ‹ Wo wir gerade davon reden: Wie sollen wir überhaupt damit umgehen? Sollen wir eine Anzeige im Lokalanzeiger schalten?«
Nick lachte. »Nein. Das möchte ich dir nicht zumuten. Im Moment sollten wir die Sache einfach laufen lassen.«
Shelly schaute ihn nur an, und er lachte wieder. »Ich weiß, ich weiß. Ich will Anerkennung, aber ich habe das Gefühl, dass ich gerade die größte Hürde geschafft habe. Nämlich dich. Jetzt kommen mir die anderen Sachen nicht mehr so wichtig vor. Oder zumindest nicht so dringend.« Er schüttelte den Kopf. »Mom und Raquel haben Recht. Im Moment solltest du dich wirklich nicht mit diesen alten Geschichten belasten. Jetzt musst du und müssen wir alle erst einmal mit Joshs Tod fertig werden. In den nächsten paar Monaten wirst du alle Hände voll damit zu tun haben, den Besitz neu zu organisieren: Wenn das bewerkstelligt ist, können wir uns ja wieder zusammensetzen und uns überlegen, wie wir die Wahrheit am besten bekannt geben.« Er lächelte. »Natürlich ohne allzu viel Gerede auszulösen.«
Shelly schnaubte. »Du meinst in diesem Tal?« Sie wechselten einen Blick. Verschwiegenheit war hier ein Ding der Unmöglichkeit. »Wahrscheinlich hast du Recht.« Shelly unterdrückte ein Gähnen. »Wir sollten die Sache klären, wenn es so weit ist.«
Nick verstand den Wink, hob das Tablett vom Boden auf und ging zur Tür. Dort schaute er noch einmal zurück und lächelte Shelly zu. »Gute Nacht, Tantchen.«
Shelly schnitt ihm eine Grimasse. »Schlaf schön, Neffe.«
Noch lange, nachdem Nick gegangen war, lag Shelly wach und dachte über die Ereignisse des Tages nach. In gewisser Weise war sie beinah froh darüber, dass Nick sie mit der Nachricht von Joshs Vaterschaft überrascht hatte. Dadurch kam sie gar nicht erst dazu, über Joshs plötzlichen Tod zu grübeln, sondern dachte in eine ganz andere Richtung. Es minderte zwar weder ihren Gram noch ihren Verlust, aber es lenkte sie ab. Zum ersten Mal, seit sie von Joshs Selbstmord erfahren hatte, lastete nicht mehr dieses schwere Gewicht auf ihrer Brust, sie fühlte sich nicht mehr so niedergeschlagen, und auch dieses verräterische Brennen der Tränen in ihren Augenwinkeln war verschwunden. In einem anderen Punkt hatte Nick ebenfalls Recht gehabt. Bis Joshs Nachlass geregelt war, würde sie diese Vaterschaftsfrage hintanstellen müssen. Shelly war sehr dankbar, dass Nick das genauso sah.
Als Shelly am nächsten Morgen aufwachte, regnete es. Es war nicht das Prasseln eines wütenden Sturmes, sondern eher ein Dunstschleier, der sich über das ganze Gebiet legte und von jedem Aufenthalt im Freien abschreckte. Das war ganz gut. So fiel es Shelly leichter, sich tagsüber in Joshs Büro zu setzen und zu versuchen, einen Zugang zu seinen Angelegenheiten zu finden.
Der Regen hielt mehrere Tage an, und auch die seltenen Pausen dauerten nie lange genug, dass man hätte hinausgehen können, selbst wenn man gewollt hätte. Shelly brachte es nicht über sich, in die Stadt zu fahren. Sie war noch nicht bereit, sich der Neugier, den Fragen und dem Geschrei zu stellen, die ihre Rückkehr sicher auslösen würde. Sie wusste, dass die Nachricht davon bereits Kreise zog, und hatte auch gar nicht versucht, es zu verheimlichen. Aber bis jetzt hatte keiner ihre Abgeschiedenheit gestört, bis auf ein paar Anrufe der wenigen Freunde, mit denen sie auch während ihrer Abwesenheit Kontakt gehalten hatte. Das Wetter lieferte ihr eine perfekte Entschuldigung, sich nicht allzu weit vom Haus zu entfernen. Maria besorgte alle Einkäufe, kochte und erledigte die Hausarbeit. Also gab es keinen Grund für Shelly, sich hinauszuwagen. Nick sah sie beinahe jeden Tag. Normalerweise spazierte er zur Abendbrotzeit herein und ließ sich von Shelly nur zu gern überreden, zu bleiben und mitzuessen. Stillschweigend waren sie übereingekommen, nicht über Josh zu reden. Meistens erzählten sie sich gegenseitig Geschichten aus ihrem Leben und erneuerten ohne Hast das Band aus ihrer Kindheit. Raquel war längst wieder nach Santa Rosa zurückgefahren, und Maria tat so, als habe sich nichts geändert. Sie war die Haushälterin der Familie. Basta. Shelly und Nick warfen sich hinter ihrem Rücken viel sagende Blicke zu, wenn Maria es wieder einmal förmlich ablehnte, sich zu ihnen zu setzen. Sie warf ihrem Sohn missbilligende Blicke zu, wenn Nick sich an den großen eichenen Küchentisch lümmelte, und Shellys Verhalten schien sie auch nicht glücklicher zu machen. Es widersprach Marias Auffassung von Schicklichkeit, wenn Shelly ihr Abendessen in der Küche einnahm und nicht im Esszimmer, wie Josh es immer getan hatte. Über ihre Beziehung zu Josh schwieg sie sich eisern aus. Shelly schnitt das Thema ein- oder zweimal an, wenn sie mit Maria allein war, aber Maria blieb stumm wie ein Fisch. Ihr ablehnender Blick hinderte Shelly daran, weiter in die Haushälterin zu dringen. Jedenfalls im Augenblick. Es würde gewiss noch genug Gelegenheit geben, diese Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Shelly verbrachte die meiste Zeit in Joshs Büro und telefonierte mit Mike Sawyer. Sie ging höflich und sachlich mit ihm um, und er reagierte auf dieselbe Art und Weise.
Ein paar Mal hatte Nick sie in den nebligen Regen hinausgescheucht, und sie waren über die Schotterstraßen gewandert. Der Regen war nicht so stark, dass er sie unpassierbar machte. Shelly genoss diese Spaziergänge. Der kühle, weiche Dunst auf ihrem Gesicht, die Anstrengung ihrer Muskeln und das Blut, das durch ihren Körper pumpte, wenn sie einen steilen, gewundenen Weg emporstiegen, belebten sie nach dem langen Sitzen hinter Joshs Schreibtisch ebenso nachhaltig wie der Duft der Kiefern und der Fichten, der ihr in die Nase stieg.
Mit dem April kamen auch die ersten Sonnenstrahlen. Shelly war klar, dass sie die kurze Fahrt nach St. Galen’s nicht länger hinausschieben konnte. Es wurde Zeit. Sie war jetzt schon seit über zwei Wochen zu Hause und hatte sich in Joshs Haus gut eingelebt. Sie war froh über ihre Entscheidung, in Oak Valley zu bleiben. Sie machte Fortschritte, was die Übernahme des Besitzes anging, auch wenn noch viel zu tun blieb, konnte sie sich mit reinem Gewissen eine kleine Pause von dem Papierkram gönnen. Shelly runzelte die Stirn. Sie war bei der Durchsicht der Bücher auf einige beunruhigende Ausgaben gestoßen. Sogar das Kapital war angegriffen worden, sie würde wohl noch tiefer graben und genauere Auskünfte von Sawyer einholen müssen. Doch viel schlimmer war, dass Josh offensichtlich die Granger Cattle Company sträflich vernachlässigt hatte. Sie war die einzige Einkommensquelle der Familie. Im Gegensatz zu den Ballingers verfügten die Grangers nicht über viel Kapital. Ihr Reichtum lag in den Tausenden von Morgen Land, die sie besaßen, und den fetten Rindern, die darauf grasten. So wie es aussah, war die Herde registrierter Angusrinder erschreckend dezimiert. Entweder war das Vieh verkauft worden oder zu alt, um es in der Zucht zu verwenden. Von der einstmals so großen und profitablen Herde war nur noch Ideal Beau übrig geblieben, der Zuchtbulle der Grangers. Es war deprimierend.
An diesem Tag stand Shelly nach dem Mittagessen von dem Eichentisch auf und stellte ihren leeren Teller auf den Tresen. »Ich wollte heute eigentlich mal in die Stadt fahren«, sagte sie beiläufig. »Brauchst du etwas?«
Maria hielt mit dem Putzen der blinkenden Spüle inne und schaute sie besorgt an. »Bist du sicher, dass du für all die Fragen gewappnet bist? Jeder wird wissen wollen, was es mit Joshs Selbstmord auf sich hat. Und mit deiner Rückkehr. Und was für Pläne du hast.«
Shelly zuckte mit den Schultern. »Ich weiß. Ich bin bereit. Glaube ich wenigstens.«
Shelly war damals mitten in der Nacht hier angekommen, diesmal ließ sie sich Zeit, die kurvige Straße ins Tal hinunterzufahren. Sie sah sich um und versuchte, sich mit der Umgebung wieder vertraut zu machen. Die Schotterstraße war im Laufe der Jahre verbreitert worden und einige der schlimmsten Kurven hatte man begradigt. Die Straße wurde von dichtem Gebüsch gesäumt, von Bärentrauben, buschigen Erdbeerbäumen, Judasbäumen, die bereits Kleider aus magentaroten Blüten trugen, und wildem weißem und lila Flieder. An den schmalsten Stellen streifte das Gebüsch sogar den Bronco. Als Shelly dieses undurchdringliche Dickicht aus miteinander verflochtenen Zweigen und verdrehten Stämmen sah, musste sie unwillkürlich an die Brandgefahr denken, die es darstellte. Streckenweise konnte nicht einmal das Wild das dichte Unterholz durchdringen, wenn an einer solchen Stelle ein Feuer ausbrach ... Shelly schüttelte sich unwillkürlich. Jeder, der auf dem Land lebte, fürchtete sich vor Waldbränden. Vor allem in den heißen Sommermonaten, wenn die Vegetation auf den Bergen und Hügeln blühenden Zündhölzern glich, die nur darauf warteten, entzündet zu werden.
Als Shelly das Tal erreichte, stellte sie voller Freude fest, wie wenig sich hier verändert hatte. Der Flughafen wirkte noch so winzig wie früher, auch wenn jetzt ein paar neue Hangars herumstanden. Trotzdem erinnerte er Shelly mehr an ein offenes Feld, durch das sich ein Asphaltstreifen zog, als an einen Flughafen. Heute war es hier wunderschön. Die goldgelben Mohnblumen und die blauen Lupinen blühten zu dieser Jahreszeit am schönsten. Shelly bog in die Soward Street ein. Die Grundschule schmückte sich jetzt ringsum mit einem hübschen schwarzen Metallzaun. Allerdings konnte man nicht leugnen, dass der Zaun der Schule auch einen Anflug von einer Festung verlieh. Die High School war nicht mehr in diesem fauligen Grün gestrichen, und über dem Bodybuildingstudio prangte auch nicht mehr das primitive Gemälde eines Pinto-Mustangs, an das sie sich noch aus ihrer Jugend erinnern konnte. Shelly fuhr Richtung State Highway und bemerkte, dass die meisten Häuser frisch gestrichen oder sogar renoviert worden waren. Einige Lücken waren zwar immer noch von Unkraut überwuchert, und es standen auch noch einige wenige baufällige Häuser da, die schon vor siebzehn Jahren Ruinen gewesen waren. Aber noch immer hatte die Straße nichts Vornehmes oder Geschniegeltes. Das freute Shelly. Es hätte ihr gar nicht gefallen, wenn die Straße plötzlich ausgesehen hätte, als wäre sie mit Zuckerguss überzogen worden. Keines der Häuser glich dem anderen, und da sie alle zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden waren, besaß jedes seinen eigenen Stil. Das Spektrum reichte von einigen wenigen viktorianischen Gebäuden bis zum Blockhaus. Es sah hier genau nach dem aus, was es auch war: eine Straße, in der ganz gewöhnliche, schwer arbeitende Familien lebten. Familien, in denen man auf jeden Pfennig achtete. Mochten manche Leute das als schäbig empfinden, für Shelly war das ihr Zuhause, und sie fand es wunderschön.
Als Erstes würde sie bei Heather-Mary-Marie’s einkehren. Ein Lächeln stahl sich um Shellys Mundwinkel. Heather-Mary-Marie’s war nach den drei Schwestern benannt worden, deren Vater den Laden um die Jahrhundertwende gegründet hatte. Den Telefonaten mit Josh hatte sie entnommen, dass hier nach wie vor einer der Treffpunkte der Gemeinde war.
In den ersten Jahren nach der Gründung war Heather-Mary-Marie’s ein winziger Laden gewesen, in dem die Rancher und Holzfäller, die dem Land ihren Lebensunterhalt abrangen, alles Notwendige kaufen konnten. Das Geschäft florierte und expandierte folglich auch sehr schnell. Die drei Schwestern Newell arbeiteten zusammen mit ihrem Vater Graham im Geschäft. Sie waren als alte Jungfern verschrien, bis Heather, die Älteste, mit fünfundvierzig Sam Howard, einen bärbeißigen Klotz von einem Holzfäller, geheiratet hatte. Der örtlichen Legende zufolge musste es ein tolles Ereignis gewesen sein. Dem das nächste auf dem Fuße folgte. Im fortgeschrittenen Alter von achtundvierzig Jahren verblüffte Heather die Leute erneut, als sie einer Tochter das Leben schenkte. Es überraschte niemanden, als sie ihr den Namen Heather Mary Marie gab.
Selbst heutzutage noch erinnerte Heather-Mary-Marie’s an einen typischen Textilladen, wie man ihn sich aus der Zeit des Wilden Westens vorstellte, obwohl er sich mittlerweile stolz »Geschenkartikelladen« nannte. Shelly kannte das Geschäft in- und auswendig, denn sie hatte mit fünfzehn angefangen, dort drei Sommer lang zu jobben, bis sie Oak Valley verließ. ,
Es war Joshs Idee gewesen, dass sie den Job annahm. Shelly konnte sich noch heute an seinen amüsiert nachsichtigen Blick erinnern, als er ihr seinen Vorschlag unterbreitet hatte. »Sieh mal, Kleines«, hatte er gesagt. »Ich weiß, dass du gerade erst aus dem Internat nach Hause gekommen bist. Und ich weiß auch, dass du alles Mögliche für den Sommer geplant hast. Und ganz bestimmt stand eine Arbeit bei Heather-Mary-Marie’s nicht auf deiner Liste. Aber überleg mal: Du bist beinahe das ganze Jahr weg und verlierst jeden Kontakt mit dem Tal. Wenn du bei Heather-Mary-Marie’s arbeitest, lernst du mehr Leute kennen als die drei oder vier Freunde, die du jetzt hast.« Als er ihren aufmüpfigen Blick bemerkte, fuhr er fort: »Weißt du was? Du probierst es zwei Wochen lang, und wenn du es dann immer noch hasst, dann lasse ich dich vom Haken.« Shelly lächelte, als sie sich daran erinnerte. Nachdem sie sich anfangs noch gesträubt hatte, hatte sie die Arbeit schnell lieb gewonnen! Josh hatte Recht gehabt. Sie hatte viele andere Leute kennen gelernt, und ihre Arbeit bei Heather-Mary-Marie’s hatte ihre Kontakte mit der Gemeinde erhalten und geholfen, ihre Bande mit dem Tal zu verstärken.
Es hatte Spaß gemacht, bei Heather-Mary-Marie’s zu arbeiten, sie erinnerte sich noch an ihre Freude in ihrem letzten Sommer. Cleopatra, die Besitzerin, hatte sie auf eine Handelsmesse mitgenommen und ihr erlaubt, ihr dabei zu helfen, Artikel für den Laden auszusuchen. Heather-Mary-Marie’s bot viel mehr an als nur Geschenke. Dort gab es Bücher zu kaufen, wenn auch vielleicht nicht gerade viele, Stiefel, Socken, Jeans, T-Shirts und für die kleinen Mädchen Rüschenkleider, die an frei stehenden Ständern und in Regalen an der Rückwand hingen. Es gab sogar einen Fotokopierer. Wenn man eine neue Bluse oder einen Schal brauchte oder auf den letzten Drücker ein Geschenk für eine Geburt oder eine Hochzeit besorgen musste, dann fand man es sicher bei Heather-Mary-Marie’s. Malbücher, Buntstifte, Spielzeug, Küchenhandtücher und Badelaken, Uhren, Glas, Schilder, Trauerkränze aus Plastik, Postkarten und eine kleine Auswahl an Süßigkeiten gehörten ebenfalls zum ständigen Angebot. In ihrer Kindheit war für Shelly dieses Geschäft der wunderbarste Ort der Welt gewesen und viel faszinierender als ein Besuch in Disneyland mit einem begrenzten Budget.
Solange Shelly denken konnte, erstreckte sich das Geschäft über das ganze Erdgeschoss eines großen, langen Holzgebäudes in der Stadtmitte. Wollte man die neuesten Nachrichten erfahren und legte dabei Wert auf Genauigkeit, war man bei Heather-Mary-Marie’s genau richtig. An den Türen klebten immer noch die Beerdigungsanzeigen. Die Post in Joe’s Market am Südende der Stadt und McGuire’s, der größte Lebensmittelladen im Tal, waren die beiden anderen zentralen Aushängepunkte. Kam man in die Stadt und suchte jemanden, war Heather-Mary-Marie’s auf jeden Fall ein obligatorischer Stopp. Es schien fast so, dass beinah jeder Bewohner des Tals früher oder später durch seine Glasschwingtüren hineinging oder herauskam.
Es ist genau der richtige Ort, um meine Rückkehr in die Stadt zu verkünden, dachte Shelly, während sie ihren Bronco vor dem großen Blockhaus parkte. Nachdem sie den Motor ausgestellt hatte, blieb sie eine Minute reglos sitzen und betrachtete das Gebäude. O nein, hier hatte sich nichts geändert. Es war dasselbe grüne Blechdach, die glänzenden Fenster, und an den Türen klebten nach wie vor Ankündigungen für alle möglichen Ereignisse, von Flohmärkten über Feuerwehr-Tombolas bis hin zur FFA-Muttertagsparade und dem Rodeo. Die bunten Plakate hoben sich wie helle Tupfer von dem dunklen Holz ab.
Shelly sah sich um. Sie spielte nur auf Zeit und zögerte den schrecklichen Moment hinaus. Sie seufzte, strich sich ihr dichtes, dunkelblondes Haar aus dem Gesicht und stieg widerwillig aus ihrem Bronco. Sie straffte die Schultern, marschierte zur Eingangstür und trat ein. Die altmodische Glocke über der Tür kündigte sie unüberhörbar an.
Erinnerungen spülten über sie hinweg. Es waren noch dieselben Regale, in denen sich die Waren stapelten, derselbe graue Zementboden. Links neben der Tür fielen ihr die Glasvitrinen ins Auge, in denen sich der Schmuck häufte. Silberne Gürtelschnallen, goldene Black-Hills-Ohrringe, Bow-Ties und Duftwasser. Darüber drehten sich aufgeregt Mobiles an der Decke. Einige Dinge, dachte Shelly voller Freude, ändern sich eben nie.
Die Frau hinter der niedrigen Holztheke in der Nähe des Vordereingangs blickte hoch. Sie war groß, fast eins achtzig, und drall. Ihr Haar schimmerte in einem unnatürlichen Rot, und sie hatte die Fünfundsechzig sicher schon überschritten, obwohl sie mit leuchtend rotem Lippenstift, nachgezogenen Augenbrauen und langen Silberohrringen offensichtlich einen gegenteiligen Eindruck erwecken wollte.
Die Frau musterte Shelly eine geschlagene Minute. Dann lächelte sie herzlich und liebevoll. »Da soll mich doch gleich der Schlag treffen!« Ihre Stimme klang, als hämmere man mit einem Montiereisen auf den Boden eines Whiskeyfasses. »Das ist doch die kleine Shelly Granger! Und wie groß sie geworden ist! Komm her, Mädchen, lass dich umarmen!«
Shelly kämpfte plötzlich mit den Tränen. Als sie Cleos Stimme hörte, drohte sie in einem Sumpf von Erinnerungen zu versinken. Cleopatra Hale war als Heather Mary Marie zur Welt gekommen. Doch mit achtzehn fand sie diesen Namen altmodisch und hatte ihn ganz legal in Cleopatra geändert. Ihrer Meinung nach klang Cleopatra glanzvoller und, stand ihr auch besser zu Gesicht. Fünf Ehemänner hatten ihr bescheidenes Scherflein dazu beigetragen, der letzte namens Hale, vor ungefähr fünfzehn Jahren. Josh hatte Shelly erzählt, dass Cleopatra allen Ernstes behauptete, sie habe nicht wieder geheiratet, weil Hale so gut zu Cleopatra passte.
Mit ausgestreckten Armen und einem breiten Grinsen im Gesicht schritt Cleopatra um den Tresen herum und nahm Shelly in ihre Arme. Shelly war von dieser Umarmung überwältigt. Sie erinnerte sich noch gut an den Duft von ihrem Parfüm und Kool-Zigaretten.
Sie hielten sich lange fest, bis Cleopatra Shelly von sich schob. »Das reicht wohl fürs Erste an Sentimentalität«, meinte sie fröhlich. »Was zum Teufel ist dir eingefallen, so lange fortzubleiben? Ohne einen Anruf, von einem Besuch ganz zu schweigen?«
Shellys Augen waren verdächtig feucht, aber sie lächelte. »Das ist einfach so passiert. Ich weiß auch nicht, wie. Gestern war ich noch hier, und heute sind siebzehn Jahre vergangen.«
Cleo stieß verächtlich die Luft durch die Nase. »Na klar. Sicher. Erzähl mir nichts!« Ihre Miene wurde weich und sie drückte Shelly kurz die Schulter. »Tut mir Leid wegen Josh. Es muss dich hart getroffen haben.« ,
Shelly nickte. »Danke. Das hat es ... Ich kann es noch immer nicht ganz fassen.« Sie holte tief Luft. »Außerdem bleibe ich jetzt für immer hier. Ich kehre nicht mehr nach New Orleans zurück.«
»Na dann hat Joshs Selbstmord ja wenigstens ein Gutes bewirkt.« Cleo warf ihr einen abschätzenden Blick zu. »Dir ist sicher klar, dass seit Wochen über nichts anderes geredet wird. Die Gemüter haben sich erst seit ein paar Tagen wieder etwas beruhigt. Aber es zirkulieren jede Menge Spekulationen über dich. Was du tun wirst, wenn du dich in der Stadt blicken lässt, wie lange du bleiben wirst, ob du nach all den Jahren fett und hässlich geworden bist, eben solche Sachen.«
Shelly lächelte. »Und was sagst du ihnen, nachdem du mich jetzt gesehen hast?«
»Na ja, dass du dich verändert hast ... Aber nicht sehr.« Cleo musterte sie mit ihren hellblauen Augen von Kopf bis Fuß. »Und dass es ausnahmslos positive Veränderungen sind.« Cleo lächelte. »Oh, oh, Mrs ›Ich-sitze-auf-dem-hohen-Ross‹ Reba Stanton wird grün anlaufen vor Neid, wenn sie hört, dass du so hübsch bist wie früher ... und wenn sie dann noch erfährt, dass du hier bleibst. Es wird mir ein ganz besonderes Vergnügen bereiten, ihr das brühwarm unter die Nase zu reiben, das kannst du mir glauben.«
Shelly brauchte eine Weile, bis sie den Namen unterbringen konnte. »Meinst du Reba ... Collier?«
»Genau die. Sie hat diesen netten, arglosen Stanton-Jungen, Bob, vor den Traualtar geschleppt. Vor etwa zwölf Jahren. Seitdem ist er nicht mehr so arglos.«
Die Glocke bimmelte, und beide Frauen schauten unwillkürlich zur Tür. Shelly bereitete sich auf ein Zusammentreffen mit jemand anderem aus ihrer Vergangenheit vor, jemand, der sie vielleicht nicht so herzlich begrüßen würde wie Cleo. Sie entspannte sich, als der schlanke, ältere Mann auf den Tresen zusteuerte. Er war ein Fremder. Er trug eine rote Baseballkappe, eine weiße Kochschürze über Jeans und Westernhemd und schwenkte eine kleine braune Papiertüte in der Hand. Mit einer spöttischen Verbeugung in Cleos Richtung legte er sie auf den Tresen. Shelly musterte ihn genauer. Er hatte ein freundliches, offenes Gesicht, das von einem erfüllten Leben kündete. Seine buschigen Augenbrauen ergrauten allmählich, und sein grauer Ziegenbart war sehr gepflegt. Shelly war sicher, dass sie diesem Mann noch nie begegnet war. Es sei denn, die siebzehn Jahre hätten ihn bis zur Unkenntlichkeit verändert. Shelly wollte Cleo mit ihrem Kunden allein lassen und schickte sich an, in das hintere Ende des Geschäftes zu gehen.
»Aber nicht doch, das brauchst du nicht!« Cleo hakte Shelly unter und führte sie an den Tresen, wo der Neuankömmling wartete. »Hank, ich möchte dir Shelly Granger vorstellen. Shelly, das ist Hank O’Hara. Er leitet zusammen mit seiner Schwester Megan das Blue Goose. Es hat eröffnet, nachdem du schon fortgegangen warst. Die beiden sind vor etwa sieben Jahren hierher gezogen und haben das alte Stone Inn gegenüber renoviert.« Cleos Augen funkelten schelmisch. »Man kann dort ganz passabel essen.«
Hank presste seine Hand auf die Brust, aber seine braunen Augen leuchteten vergnügt. »Ach, Darling, damit hast du mir ganz passabel den Todesstoß versetzt. Man kann dort ›ganz passabel‹ essen? Was für eine Untertreibung!« Er lächelte und reichte Shelly die Hand. »Schön, Sie kennen zu lernen. Gestatten Sie mir, Sie einzuladen. Probieren Sie eine unserer ausgezeichneten Mahlzeiten. Dann merken Sie selbst, wie diese Gift spritzende Hexe unser Blue Goose verunglimpft.«
»Lieber eine Gift spritzende Hexe als ein alter, dickköpfiger Ire!«, konterte Cleo. Sie genoss das Wortgefecht ganz offensichtlich.
Hank grinste. »Sehr gut, Darling. Wirklich ausgezeichnet. Warum komme ich eigentlich immer noch hierher und bringe dir deinen Lunch?« Er zwinkerte Shelly zu. »Glauben Sie nicht alles, was diese Frau über mich oder meine Kochkünste von sich gibt. Sie liebt mich halt und kann nicht anders.«
Amüsiert bemerkte Shelly, wie Cleo das Blut in die Wangen schoss. Aber die Augen der Inhaberin von Heather-Mary-Marie’s sprühten Funken. »Du kannst dich sofort wieder in deine Höhle verkriechen, wenn du mit diesem Quatsch anfängst«, gab sie kriegerisch zurück. Sie wühlte nachdrücklich in den Papieren auf ihrem Schreibtisch herum. »Nun geh schon. Verschwinde. Ich habe zu tun!« Leise fügte sie hinzu: »Ich und dich lieben? Grundgütiger Himmel! Jetzt mach dich endlich vom Acker!«
Hank kicherte. »Ist sie nicht hinreißend, wenn sie wütend ist?«, fragte er Shelly. Cleo schnaubte verächtlich, und er grinste. »Nachdem ich meine milde Gabe abgeliefert habe, heißt es für mich zurück in die Sklavengrube«, sagte er. Mit einem Blick auf Shelly fügte er hinzu: »Wenn Sie das Blue Goose ausprobieren wollen, geht die erste Mahlzeit auf mich, Miss Granger.« Shelly merkte genau, dass ihm in diesem Augenblick ein Licht aufging. Der Schreck verzerrte seine Gesichtszüge, so dass er beinahe albern aussah, und er stammelte: »Granger, Granger? Sie sind die Schwester aus New Orleans! Josh war Ihr Bruder, hab ich Recht?« Als Shelly nickte, fuhr er fort: »Es tut mir wirklich sehr Leid. Joshs Tod hat mich sehr getroffen. Er ist manchmal drei- oder viermal pro Woche ins Blue Goose gekommen und hat Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Wir haben uns immer sehr gefreut, ihn zu sehen. Er war wirklich ein ganz besonderer Mensch und sehr nett. Als Meggie und ich hier ankamen, hat er uns sozusagen wie ein Ein-Mann-Willkommenskomitee empfangen. Er hat uns allen möglichen Leuten vorgestellt und dafür gesorgt, dass wir uns schnell eingelebt haben. Er war großartig. Wir vermissen ihn sehr. Viele Leute werden ihn vermissen.«
»Danke«, erwiderte Shelly. Sie hatte einen Kloß im Hals. Josh war ein großartiger Mensch gewesen. Auch wenn er nicht immer das Richtige getan hat, flüsterte ihr eine leise Stimme zu.
Nachdem Hank gegangen war, betraten zwei andere Kunden das Geschäft. Während Cleo sich um sie kümmerte, ging Shelly zu der Wand, an der die T-Shirts hingen. Das Bimmeln der Türglocke kündigte noch weitere Kunden an, und Shelly beschloss, lieber ein anderes Mal wiederzukommen. Sie strich mit der Hand noch einmal über die T-Shirts und Westernblusen, als ihr ein goldfarbenes T-Shirt mit einem fauchenden Tiger darauf ins Auge fiel. Es rief ihr förmlich zu: »Kauf mich!« Sie brauchte zwar kein T-Shirt, da ihre Garderobe ohnehin zum größten Teil aus T-Shirts und Jeans bestand, aber sie nahm das Hemd trotzdem von der Stange. Sie hielt es sich vor und betrachtete sich in dem mannshohen Spiegel an der Wand vor den beiden winzigen Umkleidekabinen, die in eine Ecke des Geschäfts gezwängt waren. Es sah nicht schlecht aus. Und an den Tagen, an denen sie sich wie ein fauchender Tiger fühlte, würde das T-Shirt perfekt zu ihrer Stimmung passen. Lächelnd drehte sie sich herum. Und stand Sloan Ballinger gegenüber.
Sloan lehnte knapp zwei Meter entfernt an einem Tresen mit Jeans und Socken, aber der Blick seiner amberfarbenen Augen war unverwandt auf Shelly gerichtet. Shelly schnürte sich die Kehle zu, und ihr Herz hüpfte wie beim Bungeejumping. Um Himmels willen! Dafür war sie noch nicht bereit. Wieso sah er auch so unglaublich gut aus? So verdammt männlich? Und wie konnte es sein, dass sie das Gefühl hatte, sie würde gleich in eine Pfütze warmen Honig zerfließen, nur weil er sie ansah?
Shelly straffte ihre Schultern, als diese heimtückischen Gefühle sie durchströmten. O nein! Nicht schon wieder! Diesen Schmerz und diese Enttäuschung würde sie nicht noch einmal riskieren, ganz gleich, wie verführerisch die, Verpackung auch sein mochte. Sie hob das Kinn und lächelte, obwohl es sie beinahe umbrachte, und streckte ihre Hand aus. »Hallo, Sloan. Ist schon ziemlich lange her.« Sie war stolz auf ihre Stimme. Sie zitterte kein bisschen, und ihre Worte klangen einfach nur nett und freundlich. Geradezu höflich.
Sloan stieß sich vom Tresen ab und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Shelly fühlte sich sofort eingeschüchtert und zerbrechlich. Und sehr, sehr weiblich. »Stimmt.« Seine Stimme klang wie früher, tief und rauchig. Beinahe augenblicklich lief Shelly ein warmer Schauer des Entzückens den Rücken herunter.
»Du siehst gut aus«, bemerkte er gepresst.
Shelly fürchtete, dass sich ihre Wangenmuskeln im nächsten Moment verkrampfen würden, aber sie lächelte eisern weiter. »Dasselbe kann ich von dir sagen.«
Sloan fuhr sich mit der Hand durch sein schwarzes Haar. »Ich ... Dein Verlust tut mir Leid.«
»Aber es tut dir nicht Leid, dass Josh tot ist«, erwiderte sie tonlos.
Er schüttelte den Kopf. »Du kennst ja meine Meinung über ihn. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe ihm nie den Tod gewünscht, aber nur weil er jetzt tot ist, macht ihn das nicht zu einem Heiligen.«
»Das habe ich auch nie behauptet. Er war einfach nur ein ganz normaler Mann. Mit all seinen Schwächen und Stärken wie jeder andere auch. Du hast immer nur seine Fehler gesehen, nie seine positiven Seiten.«
Sloans Miene versteinerte. »Ich habe nicht vor, einen Streit mit dir vom Zaun zu brechen. Jedenfalls nicht über Josh.«
»Aha. Nun, dann dürften sich unsere gemeinsamen Gesprächsthemen auch schon erschöpft haben, meinst du nicht auch? Bis bald.«
Shelly wollte sich an Sloan vorbeidrücken, aber er hielt sie am Oberarm fest und drehte sie zu sich herum. Shelly landete an seinem kräftigen Körper, und sofort stiegen Erinnerungen in ihr hoch. Erinnerungen an andere Augenblicke, in denen sie so dicht beisammen gestanden hatten und die Leidenschaft und das Verlangen sie beinahe versengt hatten. Shelly wurden die Knie weich, als sie in diesen Bildern der Vergangenheit versank. Sie dachte an die leidenschaftlichen Episoden zwischen ihnen, an die Nächte, die sie in seinen Armen verbracht hatte, an nachmittägliche Rendezvous, bei denen sie sich unter der heißen Sonne geliebt hatten. Entsetzt merkte Shelly, wie ihr verräterischer, hinterhältiger Körper auf ihn reagierte. Immer noch. Und anscheinend ging es Sloan nicht anders, wenn das, was da so hart gegen ihren Bauch drückte, das war, was sie vermutete.
Sloan versuchte nicht erst, seine Reaktion auf Shelly zu verbergen. Aber als er ihr in die Augen sah, spiegelte sich Bedauern in seinem Blick. »Es sieht aus, als hätte die Zeit nicht viel geändert, was uns angeht.«
Shelly befreite sich aus seinem Griff, und wich einen Schritt zurück. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest!«, entgegnete sie frostig und bemühte sich redlich, ihr Verlangen zu ignorieren. »Außerdem gibt es nichts mehr zwischen uns. Was da einmal gewesen sein mag, hat vor siebzehn Jahren aufgehört. Oder hast du das vergessen?«
»Ich habe nicht das Geringste vergessen! Schon gar nicht, dass du die Lügen dieses Mistkerls geglaubt hast und einfach davongelaufen bist.«
»Josh war kein Mistkerl!«, stieß Shelly zwischen den Zähnen hervor. »Und gelogen hat er auch nicht. Ich habe mit eigenen Ohren gehört, was du in dieser Nacht gesagt hast. Und ich habe dich mit ihr gesehen.« Sie lächelte zuckersüß. »Übrigens, wie geht es deiner lieben Gattin? Weiß sie, dass du herumläufst und andere Frauen ansprichst?«
Sloan sah sie merkwürdig an. »Hat er dir das etwa nicht erzählt?«
»Was soll er mir erzählt haben?«
»Dass meine Frau tot ist«, antwortete er tonlos. »Nancy ist vor vier Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.«
Seine Worte trafen Shelly wie ein Schlag. »Um Himmels willen! Das tut mir Leid, Sloan!«, stieß sie hervor. In ihren grünen Augen zeichnete sich echtes Bedauern ab. »Das wusste ich nicht. Josh hat davon nie etwas verlauten lassen.«
Sloan hätte am liebsten seine Faust gegen die Wand geschlagen. Mitleid war das Letzte, was er von Shelly wollte. Vor allem, wenn es auf falschen Gründen beruhte. »Es überrascht mich, dass er dir das nicht brühwarm geschildert hat«, gab er bitter zurück. »Zumindest seine Version von dem, was passiert ist. Aber dein Bruder konnte schon immer verschwiegen sein ... wenn es ihm in den Kram passte.«
Shelly ignorierte ihren Ärger und das Bedürfnis, Josh zu verteidigen. »Einen Moment habe ich wirklich geglaubt, dass du nicht mit mir über Josh zanken willst.« Sie lächelte traurig. »Einige Dinge ändern sich wirklich nie, hab ich Recht?« Als Sloan etwas erwidern wollte, hob sie abwehrend die Hand. »Nein, vergiss es. Ich will es nicht hören. In dem Punkt haben wir uns schon immer gestritten, und ich bin nicht zurückgekommen, um da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Lass mich einfach in Ruhe, dann lasse ich dich in Ruhe. Einverstanden?«
Sloan schüttelte den Kopf. »Nein«, widersprach er ruhig. »Was zwischen uns gewesen ist, hat nicht aufgehört. Selbst wenn du deinen Kopf gern in den Sand stecken und es vorgeben willst. Wir beide haben noch etwas zu klären, und diesmal will ich es zu Ende bringen.«
»Entschuldige bitte, dass ich da anderer Meinung bin«, sagte Shelly. In seinen Worten schwang eine Drohung mit und ein Versprechen, beides löste gleichzeitig Furcht und Erwartung in ihr aus.
Sein Lächeln wurde von dem Blick seiner amberfarbenen Augen Lügen gestraft, als er Shelly scharf musterte. »Du kannst so viel anderer Meinung sein, wie du willst, Honey ... Das wird nichts ändern.«
»Das werden wir ja sehen!«, fuhr Shelly ihn an. Ihre Absicht, dieses Zusammentreffen höflich zu beenden, verpuffte. Sie holte tief Luft und versuchte, ihre Wut zu zügeln. Sie würdigte Sloan keines Blickes und redete sich sein, dass seine kräftige, breitschultrige Gestalt unmittelbar hinter ihr sie nicht im Geringsten beeindruckte, während sie das T-Shirt auf die Kleiderstange zurückhängte. Der Wortwechsel mit Sloan hatte ihr alle Freude an diesem Kleidungsstück gründlich vergällt. Schließlich drehte sie sich herum und sah ihn finster an. »Du bist immer noch der überheblichste Kerl, den kennen zu lernen ich jemals das Missvergnügen hatte«, sagte sie etwas gestelzt.
Sloan grinste. Shellys Herz schlug unwillkürlich schneller, als sie die attraktiven Fältchen in seinen Augenwinkeln sah. »Ja«, meinte er. »Man hat mir schon häufiger gesagt, dass dies einen großen Teil meines Charmes ausmacht.«
»Wenn du mich fragst, wird dein Charme maßlos überschätzt«, versetzte sie, als sie hoheitsvoll an ihm vorbeiging. »Du solltest nicht alles glauben, was man dir so weismachen will.«
Cleo hatte gerade keine Kunden zu bedienen, als Shelly an dem Tresen vorbeirauschte, aber sie winkte ihr nur kurz zu, weil sie sich keine Sekunde länger hier aufhalten wollte. »Wir sehen uns später. Wenn du magst, dann komm doch auf eine Tasse Kaffee bei uns vorbei.«
»Gern. Ich rufe dich an. Dann verabreden wir einen Termin.«
Shelly stürmte wie von Furien gehetzt durch die Glasschwingtür hinaus und war verschwunden.
Cleo schüttelte missbilligend den Kopf, als Sloan eine Sekunde später an den Tresen schlenderte. »Du lernst es wohl nie, oder?«, tadelte sie ihn. »Konntest du das Thema nicht ruhen lassen? Oder wenigstens die üblichen Phrasen dreschen?«
Sloan zuckte mit den Schultern. »Okay, ich hab es vermasselt. Ich wollte keinen Streit vom Zaun brechen ...« Er lächelte zerknirscht. »Vielleicht wollte ich es doch. Ich kann ihre Wut leichter ertragen, als wenn sie mich mit dieser eisigen Granger-Höflichkeit behandelt.«
»Ich verstehe wirklich nicht, wie Männer heutzutage Frauen den Hof machen«, beschwerte sich Cleo. »Wenn zu meiner Zeit ein Junge Interesse an einem Mädchen hatte, war er nett zu ihr, sehr höflich und versuchte, ihr zu gefallen.«
»Erstens bin ich kein Junge mehr«, antwortete Sloan amüsiert. »Und zweitens bin ich nicht an Shelly Granger interessiert.«,
»Ach nein?« Cleo wirkte wenig überzeugt. »Wie konnte ich mich so täuschen?« Sie musterte ihre langen, roten Fingernägel. »Josh Granger war kein Heiliger. Dem wird jeder zustimmen, der diesen Mann wirklich gekannt hat.« Als Sloan etwas sagen wollte, unterbrach sie ihn. »Noch eine Minute, dann bist du dran.« Sie sah ihn durchdringend an. »Ich weiß, dass du einen guten Grund hast, ihn zu hassen, und ich mache dir für deine Gefühle ihn betreffend auch keinen Vorwurf. Aber Sloan, um deinetwillen musst du die Sache endlich beerdigen. Lass es hinter dich. Wenn du das nicht tust, wird es dich auffressen und am Ende zugrunde richten. Willst du denn wirklich, dass Josh noch nach seinem Tod so viel Macht über dich hat?«
Sloan hatte das Gefühl, als wäre er wieder zehn Jahre alt. Schlimmer noch, in Cleos Worten steckte zu viel Wahrheit, als dass er sie einfach hätte ignorieren können. »Schon gut, schon gut. Ich arbeite daran. Zufrieden?«
»Vielleicht. Wenn du wirklich hart daran arbeitest.« Als er sich zum Gehen wandte, fuhr sie fort: »Eines solltest du nicht vergessen: Josh hat seine Schwester geliebt. Und was er getan und nicht getan hat, hat er nur aus diesem einen Grund getan: Weil er Shelly geliebt hat.«
»Ja«, erwiderte Sloan grimmig. »Das habe ich auch.«