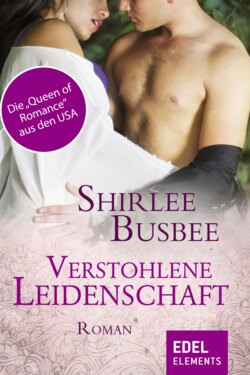Читать книгу Verstohlene Leidenschaft - Shirlee Busbee - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. KAPITEL
Shelly Grangers Bronco war längst über alle Berge, doch der Fahrer des Wagens, dessen Scheinwerfer sie geblendet hatten, saß immer noch reglos da und umklammerte das Steuerrad, als könnte es ihn vor einem Sturz ins Nichts bewahren. Der Mann sah recht gut aus, wenn er auch nicht im landläufigen Sinn attraktiv sein mochte. Seine Nase war etwas zu groß, der Mund ein wenig zu breit und das Kinn ein bisschen zu kantig. Die amberfarbenen Augen unter den geschwungenen schwarzen Brauen konnten angeblich jeden auf drei Schritt Abstand halten. Sein Gesicht strahlte nichts Offenes oder Freundliches aus, sondern wirkte hart und beherrscht. Und doch gehörte es einem Mann, der noch nie das Vertrauen enttäuscht hatte, das andere in ihn setzten. Vielleicht hatte er es gelegentlich etwas strapaziert, aber enttäuscht niemals. Im Moment allerdings wirkte dieses Gesicht alles andere als Vertrauen erweckend. Im Gegenteil. Jeder, der seine Miene gesehen hätte, hätte vermutlich schleunigst die Straßenseite gewechselt und einen großen Bogen um den Mann gemacht. Schon seine Größe und Statur hätte die meisten abgeschreckt. Er maß beinahe eins neunzig, seine breiten Schultern und die muskulösen Oberarme hätten eher zu einem Stahlarbeiter gepasst als zu dem Manager, der er war. Die Bezeichnung Kraftpaket passte sehr gut zu ihm. Der Mann war muskulös, kraftvoll und beeindruckend.
Jetzt starrte er den Rücklichtern von Shellys Wagen nach, obwohl sie längst verschwunden waren, holte tief Luft und lenkte seinen großen, schwarzsilbernen Geländewagen in die Parkbucht, aus der Shelly gerade herausgefahren war. Er stellte den Motor ab, blieb regungslos sitzen und schaute ins Leere. Langsam schüttelte er den Kopf. Shelly Granger. Ausgerechnet! Shelly war der letzte Mensch, den hier zu treffen er erwartet hatte. Oder den er hätte treffen wollen.
Sloan Ballinger stieg aus und trat zögernd an den Rand des Aussichtspunktes. Er ließ seinen Blick über das dunkle Tal gleiten. Die wenigen blinkenden Lichter, die verrieten, dass hier Menschen lebten, lagen weit auseinander. Nur am Nordende des Tales ballten sie sich zusammen. Dort lag St. Galen’s. Nur anhand der Lage der Lampen, welche die einzige Straße säumten, die durch das Tal führte, hätte Sloan die Namen der Bewohner aufzählen können. Er wusste, seit wie vielen Generationen sie hier waren, wie viel Land sie besaßen und was sie züchteten oder anbauten: Schafe, Rinder oder Pferde ... Birnen, Heu oder Alfalfa ... Er konnte auf Anhieb jeden Neuankömmling oder Besucher unter ihnen herauspicken. Das war eine der Segnungen, wenn man im Tal geboren und aufgewachsen war. Oder ein Fluch. Vor allem, wenn man Vorfahren hatte, die zu den ersten Weißen gehörten, die dieses Tal in Besitz genommen hatten.
Er presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Die Grangers waren die Ersten gewesen, ihnen waren innerhalb von etwas mehr als einem Jahr die Ballingers gefolgt. Und genauso lange gehen sich die beiden Clans auch schon an die Kehle, dachte Sloan grimmig. Er griff nach dem Päckchen Zigaretten, das er in der linken Brusttasche verwahrte, und fluchte leise, als seine Finger ins Leere tasteten. Vor ungefähr zehn Jahren hatte er aufgehört zu rauchen, und normalerweise vermisste er es auch nicht. Manchmal jedoch griffen seine Finger noch automatisch nach der Zigarette. Das passierte meistens, wenn er unter Stress stand. Sloan schüttelte den Kopf. Wer hätte gedacht, dass er Shelly Granger nach siebzehn Jahren sofort wiedererkennen würde, obwohl er nur ganz kurz ihr Gesicht gesehen hatte? Und dass ihn ihr Anblick wie ein Schlag in den Unterleib treffen würde? Himmel! Im Moment würde er für eine Zigarette sogar einen Mord begehen!
Shelly hatte sich in diesen siebzehn Jahren verändert, aber das hatten sie alle. Sloan dachte an die vereinzelten silbernen Strähnen in seiner schwarzen Mähne und an die Falten in seinen Augenwinkeln, die davon kamen, wenn man viel im Freien arbeitete und in die Sonne blinzelte. Sehr hatte Shelly sich nicht verändert. Ihr Haar umrahmte immer noch in dieser wilden, lockigen, rotblonden Mähne ihre schmalen Wangenknochen und ihr eigensinniges Kinn, ihre Haut schimmerte selbst im Licht der Scheinwerfer noch in diesem Honigton und sah so makellos aus, wie er sie erinnerte. Sloan knirschte mit den Zähnen. Vermutlich fühlte sie sich auch noch genauso seidig an wie damals mit achtzehn und roch auch so. Er hatte zwar Shellys Augen nicht erkennen können, aber er konnte sich noch sehr gut an sie erinnern. Sie konnten strahlen wie Smaragde oder aber glitzern wie gefrorenes grünes Glas. Sehr frostiges grünes Glas. Oh ja, er erinnerte sich. Es gab kaum etwas an Shelly, das er vergessen hätte. Und genauso gut erinnerte er sich an diesen Mistkerl Josh. Sloans Meinung nach war die Welt ohne Josh viel besser dran. Sehr viel besser.
Er stieß verächtlich die Luft durch die Nase. Man sollte denken, dass die Ballingers und die Grangers nach hundertfünfzig Jahren engster Nachbarschaft allmählich einen Weg gefunden hätten, miteinander auszukommen. Er lachte rau. Vielleicht passierte das auch irgendwann, aber er würde nicht viel Geld darauf setzen.
Die beiden Familien befehdeten sich, seit York Ballinger und sein jüngerer Bruder Sebastian nach Ende des Bürgerkrieges 1867 in Oak Valley aufgetaucht waren. Sie hatten aus dem Stand begonnen, ein Imperium aufzubauen. Das führte zwangsläufig dazu, dass sie mit Jeb Granger aneinander gerieten. Der alte Granger hatte sich mit den überlebenden Angehörigen seiner Familie im Jahr zuvor im Tal niedergelassen. York Ballinger hatte als Major in der Armee der Union gedient, und Jeb Granger hatte denselben Rang in der Armee der Konföderierten bekleidet. Die Narben des Krieges und die Verbitterung, die sich tief in die beiden Männer hineingefressen hatte, waren zu frisch und zu tief, als dass sie hätten darüber hinwegsehen können. Folglich musste es zu Spannungen kommen. Sie stritten vom ersten Moment an über Wegerechte und Wasserrechte, in den folgenden Jahren und Jahrzehnten fochten die Familien über Holzrechte, befehdeten sich wegen Rinder-oder Schafzucht. Was man sich auch vorstellen konnte, ihnen gelang es, sich darum zu streiten. Es dauerte nicht lange, und die Weichen waren unwiederbringlich gestellt. Jeder in Oak Valley und im Umkreis von fünfzig Meilen wusste, wenn ein Granger für etwas war, würde ein Ballinger dagegen stimmen. Und umgekehrt. Sloans düstere Miene verfinsterte sich noch mehr, als er an Shelly und das heftige Ende ihrer Beziehung dachte. Natürlich kämpften die Familien gelegentlich auch um Frauen.
Er atmete tief durch. Vergiss es einfach! Du bist ein paar Mal mit ihr ins Bett gestiegen, als du noch jung warst und deine Hormone dich getrieben haben. Mehr war es nicht, eine lüsterne Paarung zweier gesunder Jungtiere. Weißt du noch? Bedauerlicherweise erinnerte sich Sloan noch sehr gut daran, viel zu gut für seinen Geschmack. Und außerdem hätte er jetzt wirklich gern eine Zigarette!
Sloan trauerte der Vergangenheit nicht hinterher. Er ärgerte sich darüber, wie er auf Shelly Grangers Anblick reagierte. Kurz entschlossen drehte er sich auf dem Absatz herum, ging zu seinem Geländewagen zurück und stieg wieder ein.
Als der kleine warme Körper auf seinem Schoß landete, hellte sich seine finstere Miene auf. Zwei Pfoten legten sich gegen seine Brust, und eine feuchte Zunge schlabberte über seine Wange. Sloans Laune besserte sich schlagartig, und er blickte lächelnd in das Gesicht des winzigen, silberschwarzen Zwergschnauzers, das ein gewaltiger Schnurrbart zierte. Zwei ausdrucksvolle schwarze Augen starrten ihn unter zwei tief hängenden silberfarbenen Brauen an.
»Schon gut, schon gut. Ich weiß, dass du es eilig hast, nach Hause zu kommen«, murmelte er, streichelte die Hinterbeine des Hundes und fragte sich nicht zum ersten Mal, wie er eigentlich zu diesem schnurrbärtigen Hund gekommen war, der kaum größer war als eine Katze. Und auch genauso wählerisch, fordernd und empfindlich wie eine Katze. Sloan grinste. Pandora entsprach überhaupt nicht der Art Hund, die er sich zugelegt hätte, oder um der Wahrheit die Ehre zu geben, von der er sich hätte herumkommandieren lassen.
Wenn Sloan nicht in den Vorstandsbüros der Zentrale von Ballinger Development in Santa Rosa arbeitete, hielt er sich im Freien auf, am liebsten auf einem Pferd. Sloans Herz gehörte Oak Valley und der großen Ranch, die sein Ururgroßvater York Ballinger der Wildnis abgetrotzt hatte. Zu Yorks Zeit und noch viele Generationen danach hatten die Ballingers Vieh gezüchtet und Wälder abgeholzt. Aber in den letzten etwa fünfzehn Jahren unter Sloans Ägide hatten sie begonnen, Pferde zu züchten. Sehr, sehr kostspielige Pferde. Amerikanische Schecken, Westernpferde mit einem makellosen Stammbaum und einer atemberaubenden Leistungsfähigkeit, was jeder bestätigen konnte, der gesehen hatte, wie sie Rinder trieben. Sloan war ein großer, athletischer Mann, der harter, körperlicher Arbeit nicht aus dem Weg ging, wenn sie erforderlich war, und dessen wie gemeißelte Gesichtszüge auch danach aussahen. Er hätte ohne zu zögern zugegeben, dass sein Geschmack, was Hunde anging, zu den größeren und robusteren Rassen tendierte. Und es hätte niemanden gewundert, wenn ein Rottweiler oder Pitbull in seinem Wagen gekläfft hätte, am wenigsten Sloan selbst.
Das ist nur Samanthas Schuld, dachte er, als er der kleinen rosa Zunge auswich. Vor ein paar Jahren hatte er seine jüngste Schwester besucht. Sie wohnte am Stadtrand von Novato, und er hatte ihr nur eine gute Reise nach Mexiko wünschen wollen. Sie wollte am nächsten Tag fliegen und dem mexikanischen Zweig ihrer Familie einen ausgedehnten Besuch abstatten. Ihre Ehe war vor zwei Monaten geschieden worden, und Sloan fand die Idee ausgezeichnet, für eine Weile einen Tapetenwechsel vorzunehmen. Natürlich hatte er ihr nicht nur eine gute Reise wünschen, sondern sich vor allem vergewissern wollen, dass sie wirklich in das Flugzeug stieg und nicht wieder in diese trübselige Stimmung verfiel, in der sie sich seit ihrer Scheidung befand. Aber sie wirkte fröhlicher, als er sie seit Monaten erlebt hatte. Er wollte sich gerade selbst auf die Schulter klopfen, wie geschickt er es angestellt hatte, sie zu einer Abwechslung zu überreden, als er plötzlich ein winziges Fellknäuel in der Hand hielt.
Sams Hobby war die Zucht von Zwergschnauzern, und sie hatte sich auf die ungewöhnliche Farbkombination schwarzsilber spezialisiert. Sloan wusste, dass dieser Welpe aus einem Wurf von Sams Lieblingshündin Gemini stammte. Gemini war ein mehrfach ausgezeichneter Champion, und Sloan hatte den Wurf bei seinen vorherigen Besuchen ausgiebig bewundert. Ein perfekter Vorwand, um unauffällig Sams Befindlichkeit kontrollieren zu können. Sloan war nicht dumm, und seine Alarmglocken hatten Sturm geläutet, als sich das kleine Geschöpf zutraulich an seine Brust schmiegte und er die erwartungsvolle Miene seiner Schwester sah.
»Sam ... Gibt es zufällig einen Grund dafür, dass ich hier stehe und dieses Fellknäuel im Arm halte? Ich dachte, du hättest den ganzen Wurf verkauft?«
»Nun ja, nicht den ganzen«, erwiderte Sam ausweichend. »Eine Lady aus der Nähe von L. A. hätte diese hier sehr gern. Sie hat sich aber noch nicht endgültig entschieden.«
Sloan hob eine seiner ausdrucksvollen Augenbrauen. »Und was habe ich damit zu schaffen?«
»Ich ... Ich dachte, dass du vielleicht für mich auf sie aufpassen könntest, bis entweder die alte Dame sie abholt oder ich zurückkomme.«
»Verbessere mich, falls ich mich irre, aber wolltest du nicht mindestens sechs Wochen lang in Mexiko bleiben?«
»Ach, ich bin sicher, dass du nicht so lange auf sie aufpassen musst«, meinte Sam unbekümmert. »Midge wird sich spätestens in einer oder zwei Wochen entschieden haben.«
Sloan lächelte wölfisch und hielt Sam den Welpen hin. »Dann schlage ich vor, du teilst Midge mit, in welche Tierpension du das Tier gebracht hast. Wenn sie es kaufen will, kann sie es sich von ihnen liefern lassen.«
Sam wich ihm jedoch geschickt aus und hielt ihre Hände fest hinter ihrem Rücken verschränkt. »Sloan, sie ist erst drei Monate alt! Sie ist noch viel zu jung! Ich kann sie nicht sechs Wochen lang in eine Tierpension stecken!«
»Aha! Wusste ich’s doch, dass es keine Midge gibt. Tut mir Leid, Kindchen, aber das funktioniert nicht. Dieses Fellknäuel gehört dir.«
Sam sah ihn schuldbewusst an. »Ich weiß, ich hätte nicht versuchen sollen, dich hereinzulegen. Aber was soll ich mit ihr anfangen? Ich habe schon versucht, Ross und Roxanne zu überreden, sie zu versorgen, aber die beiden haben das strikt abgelehnt! Und Ilka ist nicht in der Stadt. Sie macht mit Mom und Dad eine Griechenland-Reise. Die Kleine ist einfach noch zu jung, um so lange in einem Zwinger zu leben.« Sie seufzte. »Aber wenn du sie nicht nehmen willst, werde ich selbstverständlich meinen Flug absagen.« Plötzlich schimmerten Tränen in ihren Augen. »Es ist schon so lange her, dass ich irgendwo hingereist bin, und ich habe mich so darauf gefreut, Tio Ward und Tia Madalena und all die anderen wiederzusehen ...« Sams Stimme bebte, und sie wandte sich ab. Ein Vorhang aus dunklen Haaren verdeckte ihr Gesicht. »Es war meine Entscheidung, mit Gemini zu züchten«, sagte sie tapfer, »natürlich bin ich für ihren Nachwuchs verantwortlich. Wenn du nicht auf sie aufpassen kannst, sage ich meine Reise eben ab.«
Sloan wusste sehr genau, dass er an der Nase herumgeführt wurde. Auch wenn ihm in seiner Firma der Ruf eines eiskalten, harten Verhandlungspartners vorauseilte, erlebte seine Familie ihn ganz anders. Er schaute auf das Hundebaby herab, das zufrieden an seinen Fingern kaute, und warf dann einen Blick auf seine Schwester. Die, wie er vermutete, heimlich schamlos grinste. Er seufzte. »Also gut. Ich passe auf sie auf. Aber ich warne dich, Sam. Ich will, dass du sie binnen vierundzwanzig Stunden nach deiner Rückkehr abholst! Und verdammt, ich meine es ernst!«
Sams Tränen waren wie von Zauberei verschwunden. Sie kicherte, fiel ihm um den Hals und drückte ihm einen schallenden Kuss auf die Wange. »Natürlich, das versteht sich doch von selbst.«
Sloan lächelte, als er sich jetzt daran erinnerte. Pandora fuhr ihm noch einmal mit ihrer winzigen Zunge über das Kinn und sprang dann wieder in ihren Korb auf dem Beifahrersitz. Nach Sams Rückkehr aus Mexiko war nicht mehr die Rede davon gewesen, dass er ihr Pandora zurückgab. Darauf hatte seine gerissene Schwester natürlich spekuliert.
Sloans schlechte Laune war wie weggeblasen. Er steckte den Schlüssel ins Zündschloss, ließ den Motor an und rollte auf die Straße. Als er Asphalt unter den Rädern spürte, fuhr er zügig weiter. Er lebte in seinem eigenen Blockhaus in den Bergen am Nordende des Tals, und bis dorthin war es noch ein ganzes Stück Wegs. Es war später geworden, als ihm lieb war, denn das Arbeitsessen in Ross’ Stadthaus hatte erheblich länger gedauert, als er oder sein jüngerer Bruder vorhergesehen hatten. Bis kurz vor Mitternacht hatten sie daran gesessen, alle Einzelheiten zu klären, damit Ross als neuer Vorstandsvorsitzender die Leitung des Familienbetriebes Ballinger Development von Sloan übernehmen konnte. Jetzt endlich durfte Sloan seine ausgedehnten Ferien antreten. Ross war mit seinen beinahe zweiunddreißig Jahren qualifiziert genug, die verschiedenen Geschäfte der Firma zu führen. Schließlich war er mit dem Geschäft aufgewachsen, und zudem hatte Sloan ihn in den letzten drei Jahren als seinen Stellvertreter aufgebaut. Sloan grinste. Wenn alles lief wie erwartet, bekamen sie beide, was sie wollten. Ross durfte endlich Ballinger Development leiten, und Sloan konnte sich vollkommen seiner Leidenschaft widmen: der Pferdezucht. Er gähnte und freute sich darauf, bald sein Ziel zu erreichen. Aber erst musste er noch die letzten zehn, elf Meilen der kurvigen Straße hinter sich bringen, und die letzten sechs davon waren unbefestigte Schotterwege.
Als Shelly am nächsten Morgen aufwachte, wusste sie zunächst nicht, wo sie war. Sie schaute schlaftrunken auf den Stoffhimmel ihres Bettes und orientierte sich mühsam. Schlagartig fiel es ihr wieder ein. Sie war zu Hause. In Oak Valley. Josh war tot.
Shelly vergrub ihren Kopf in den Kissen. Wie lange würde es wohl dauern, bis sie nicht mehr nach jedem Aufwachen mit diesem schmerzhaften Wissen konfrontiert würde. Seit diesem Anruf von Mike Sawyer schien ein schwarzer Schatten über ihrem Leben zu liegen. Vielleicht wird es besser, wenn ich Joshs Asche verstreut habe, dachte sie. Heute war der Tag, an dem sie Josh diesen letzten Dienst erweisen wollte. Mike Sawyer würde heute mit der Urne mit Joshs Asche aus Ukiah herüberkommen. Zusammen wollten sie Josh seinen letzten Wunsch erfüllen. Shelly seufzte. Sie freute sich nicht gerade auf diese Aufgabe, aber dennoch, sobald sie das erledigt hatte ... Sie seufzte noch einmal. Sobald sie das hinter sich gebracht hatte, konnten ihre Wunden heilen. Wenigstens hoffte sie das.
Sie warf einen Blick auf die Uhr auf dem Nachttisch und stöhnte. Es war schon zehn Uhr, aber sie fühlte sich, als hätte sie gar nicht geschlafen. Es war schon schlimm genug, dass sie erst um halb vier Uhr morgens zu Bett gegangen war, der Jetlag tat ein Übriges. Nach der Landung hatte sie ihren neuen Bronco vom Händler abgeholt. Da war es schon später Abend gewesen. Sie hätte auf den Rat ihrer reiseerfahrenen Freunde hören und in San Francisco Zwischenstation machen sollen. Sie hatte noch nie gut Ratschläge annehmen können, mittlerweile sollte sie eigentlich klüger geworden sein. Sie stieg aus dem Bett und schleppte sich ins Badezimmer.
Eine halbe Stunde später hatte Shelly geduscht und ihre Haare hingen ihr noch feucht auf die Schultern herunter. Sie trug eine ausgeblichene Jeans und schlenderte die Treppe hinunter. Als sie ihren nackten Fuß auf die unterste Stufe setzte, drang ihr der Duft von frischem Kaffee in die Nase. War Maria da?
Shelly lag ein Kloß im Magen, und sie spürte ein Ziehen zwischen den Schulterblättern, als sie vorsichtig die Küchentür öffnete. Die untersetzte, dunkelhaarige Frau stand am Tresen und schenkte sich gerade eine Tasse Kaffee ein. Ihr grau meliertes Haar trug sie am Hinterkopf zu einem ordentlichen Knoten gebunden. Als Shelly eintrat, blickte sie hoch.
Sie lächelte unsicher. »Guten Morgen, Miss Shelly.« Ihr mexikanischer Akzent war kaum noch zu hören. » Ich hoffe, Sie haben nach Ihrer langen Fahrt gut geschlafen. Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen?«
Maria Rios hatte sich in den siebzehn Jahren kaum verändert. Sie war zwar nicht mehr dieselbe dunkeläugige, immer lächelnde, schüchterne junge Frau, die Shelly in ihrer Jugend so vertraut gewesen war, aber sie erkannte sie sofort wieder. Wie denn auch nicht? Maria war mit zwanzig in die Dienste von Shellys Familie getreten. Damals war Shelly erst zwei Jahre alt gewesen. Marias melodische Stimme und ihr warmer, tröstender Körper gehörten zu Shellys frühesten Kindheitserinnerungen. Jetzt schimmerten in ihrem glänzenden schwarzen Haar deutlich mehr graue Strähnen als damals mit sechsunddreißig, als Shelly sie zum letzten Mal gesehen hatte. Auch die Falten in ihrem ansonsten glatten, olivfarbenen Gesicht waren schärfer geworden, aber sie war immer noch Maria.
Ihre Freundlichkeit und das Mitgefühl, das sie ausstrahlte, der Schmerz, der sich in ihrem Blick widerspiegelte, löste Shellys Anspannung sofort. »Ach, Maria!«, rief sie. Die siebzehn Jahre Trennung schien es nie gegeben zu haben. Die beiden Frauen umarmten sich mitten in der Küche. »Es tut so gut, dich zu sehen, selbst unter diesen Umständen.«
Sie drückten sich, weinten, stammelten irgendwelche Worte und lächelten zaghaft. Aber Shelly war vor allem froh über das herzliche Willkommen und Marias Anteilnahme.
»Na, na«, knurrte eine Stimme, die ihr irgendwie bekannt vorkam. »Was man alles nicht sieht, wenn man keine Waffe hat.«
Shelly wirbelte herum und bemerkte jetzt erst den alten Cowboy, der an dem Eichentisch in dem Wintergarten saß, der an die Küche anschloss. Sie starrte mehrere Sekunden in das wettergegerbte Gesicht und versuchte, diese dunklen, runzligen Züge unterzubringen, das schlohweiße Haar und den wirklich beeindruckenden Schnauzbart, der fast die ganze untere Hälfte seines Gesichts verdeckte. Es war der Bart, der ihn schließlich verriet.
»Acey!«, platzte Shelly fröhlich heraus. »Ich habe dich hier nicht erwartet.«
Der Mann stand auf. Er hatte eine kleine, drahtige Gestalt, und die abgetragene Jeans saß so eng auf seinen Hüften, dass ihn jüngere Männer darum beneidet hätten. »Dafür gibt’s auch keinen Grund, Mädchen«, erwiderte er und zog sie in seine Arme. »Es ist sehr schön, dich wiederzusehen. Selbst unter diesen traurigen Umständen.«
Acey Babbitt musste über siebzig sein, aber nur das gefurchte Gesicht und die Hände, auf denen die Adern hervortraten, verrieten sein Alter. Seine kräftige Umarmung ließ jedenfalls nicht darauf schließen. Als Shelly wieder zu Atem kam, lächelte sie ihn an. »Wie geht es dir? Bringst du immer noch dickköpfigen kleinen Besserwissern, wie ich eine war, das Reiten bei?«
Er nickte und seine dunklen Augen funkelten. »Allerdings. Und ich jage auch immer noch den Frauen hinterher.« Er wackelte mit seinen Augenbrauen. »Diesmal habe ich eine nette Witwe im Auge.« Er schnalzte mit der Zunge. »Ich sage dir, die ist wirklich nicht ohne. Und ganz schön anspruchsvoll dazu. Na ja, sie wird wahrscheinlich noch >Liebe mich< auf meinen Grabstein ritzen.« Sein Schnurrbart zuckte. »Du kennst ja den alten Spruch, Mädchen: Es mag Eis auf den Gipfeln liegen, aber im Ofen brennt fröhlich das Feuer.«
»Und zwar bei dir ein ziemlich loderndes Feuer«, versetzte Maria gereizt. Sie drohte ihm mit dem Finger. »Ich habe von dir und dieser Frau da oben in Shawnee Dick gehört. Du solltest dich lieber vorsehen, alter Mann. Jim Madden ist in den letzten sechs Monaten um sie herumscharwenzelt. Und du weißt, dass Jim sein rotes Haar nicht umsonst trägt. Reize ihn nur genug, dann wird er einem alten Hahn wie dir ordentlich die Federn rupfen. Dafür braucht er höchstens zehn Sekunden!«
Acey tat das mit einer abfälligen Handbewegung ab. »Mach du dir deswegen keine Sorgen. Es ist mir ja nicht wirklich ernst mit der Witwe.«
Maria verdrehte verächtlich die Augen. »Acey wird im Juni dreiundsiebzig«, sagte sie zu Shelly. »Eigentlich sollte man annehmen, dass er in seinem Alter allmählich ein bisschen zur Vernunft gekommen wäre.«
»Ich bin jedenfalls vernünftig genug, um dieses Mädchen nicht schon am frühen Morgen mit dem neuesten Klatsch zu überfallen«, versetzte er, nahm den Hut vom Tisch und pflanzte ihn sich mit einer ausholenden Geste auf den Kopf. »Ich muss mich um das Vieh kümmern. Hab keine Zeit, herumzusitzen und zu keifen.« Er warf Shelly einen viel sagenden Blick zu. »Hübsch bist du geworden, Honey. Schön, dich zu sehen.« Damit ging er hinaus und rollte dabei in den Hüften wie ein Mann, der die meiste Zeit seines Lebens im Sattel verbracht hatte.
Maria schien schockiert, aber Shelly lachte nur und legte der älteren Frau den Arm um die Schultern. »Nichts könnte mir ein heimischeres Gefühl geben, als euch beide streiten zu hören. Und immer über dasselbe Thema! Du solltest dich nicht von Acey auf den Arm nehmen lassen! Du weißt doch, dass er das absichtlich macht.« So lange Shelly sich erinnern konnte, hatte Maria Acey wegen seiner Frauengeschichten gescholten. Schon damals hatte sie ihn im Verdacht gehabt, dass er den größten Teil seiner amourösen Abenteuer nur erfand, um Maria auf die Palme zu bringen. Anscheinend funktionierte das immer noch.
Maria lächelte. »Ich weiß, aber ich mache mir einfach Sorgen um den alten Teufel. Er benimmt sich, als wäre er höchstens vierzig. Er reitet nach wie vor Pferde zu und arbeitet mit Rindern, und das meistens ganz allein, obwohl die meisten Rancher versuchen, ihn im Auge zu behalten. Er schafft zwar immer noch mehr als die meisten anderen Männer, aber ich mache mir Sorgen, wenn er ganz allein in die Berge reitet. Er kapiert einfach nicht, dass er kein junger Mann mehr ist. Ein Unfall ist so schnell passiert, und in seinem Alter ist das viel gefährlicher. Erst letzten Herbst hat Nick sich angeboten, mit Acey Rinder zusammenzutreiben. Der Junge ist völlig ausgepumpt nach Hause gekommen. Er meinte, Acey würde zwar etwas langsamer arbeiten als früher, aber er wäre ständig in Bewegung. Nick hat eine Woche gebraucht, um sich von dem Tempo zu erholen, das Acey vorgegeben hat. Und dabei ist Nick gerade dreißig!«
Sie sprachen danach über allgemeinere Themen, doch erst als die beiden Frauen einige Minuten später an dem Tisch saßen, von dem Acey aufgestanden war, überwand sich Shelly endlich und stellte die Frage, die ihr auf der Seele brannte.
»Warum, Maria? Warum hat Josh es getan?«
Marias dunkle Augen waren voller Trauer, als sie den Kopf schüttelte. »Ich weiß es nicht, Chica. Ich habe mir ein Dutzend Mal dieselbe Frage gestellt, ohne eine plausible Antwort zu finden.«
»War Josh irgendwie anders? Hat er an dem Tag irgendetwas gesagt, was merkwürdig klang? Etwas, das aus dem Rahmen fiel und vielleicht einen Hinweis darauf geben könnte, was er vorhatte?«
»Nein. An dem Nachmittag, an dem es passiert ist ...« Marias Stimme stockte, aber sie riss sich zusammen. »Er hat mir in die Wange gekniffen, bevor er in die Scheune gegangen ist, um sein Pferd zu satteln. Du weißt ja, so wie er es immer gemacht hat.« Shelly hatte Maria das formelle »Miss« schlichtweg verboten. »Er sagte, er wäre eine Weile unterwegs und wollte bei seiner Rückkehr einen richtigen Herzinfarkt zum Abendessen. Steak, Pommes frites und Apfelkuchen mit Eis zum Nachtisch.« Ihre Augen schwammen von Tränen. »Ich kann immer noch nicht glauben, dass er wirklich tot ist.«
Sie schwiegen eine Weile, während sie ihren Kaffee tranken und über Joshs Selbstmord grübelten. Schließlich plauderten sie auch über andere Dinge. Maria erkundigte sich nach Shellys Leben in New Orleans, und Shelly ließ sich von Maria über einige bedeutsamere Ereignisse auf den neuesten Stand bringen, die sich in ihrer langen Abwesenheit im Tal zugetragen hatten. Allerdings waren es nicht viele, denn Veränderungen gingen in Oak Valley nur langsam vonstatten, was den Charme des Tales ausmachte. Maria berichtete von Geburten und Todesfällen unter den Einheimischen und zählte die wenigen neuen Geschäfte auf, die in der Stadt eröffnet hatten. Bald drehte sich das Gespräch um Marias Kinder.
An die beiden konnte Shelly sich noch erinnern. Der Junge, Nick, war ein abenteuerlustiger Rabauke, und das jüngere Mädchen, Raquel, war eine großäugige kleine Schönheit und folgte ihrer Mutter bei ihrer Arbeit im Haus der Grangers wie ein Schatten.
»Ich kann kaum glauben, dass sie erwachsen sind!«, rief Shelly. »Mein Gott, die beiden waren noch Kinder, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Und jetzt sagst du, dass Raquel in Santa Rosa als Zahnarzthelferin arbeitet und Nick seine eigene Rinderzucht angefangen hat! Wow! Ich kann wirklich kaum glauben, dass so viel Zeit verstrichen ist!«
Maria lächelte, stand auf und nahm die beiden Becher vom Tisch. »Ich schon, vor allem morgens, wenn meine Gelenke knacken und protestieren, wenn ich aus dem Bett steige.«
Das Geräusch eines nahenden Wagens schnitt Shellys Antwort ab. »Meine Güte! Das ist Mike Sawyer, und ich bin noch nicht fertig.« Sie sprang auf. »Lässt du ihn herein und bietest ihm eine Tasse Kaffee an? Ich ziehe mich rasch um!« Sie warf einen kurzen Blick auf ihre verblichene Bluejeans. »Josh würde es sicher nicht kümmern, was ich trage, aber ich fühle mich wohler, wenn ich angemessener angezogen bin.«
Ein Schatten huschte über Marias Gesicht. »Willst du heute seine Asche verstreuen?«
Shelly nickte. Als sie an den eigentlichen Grund dachte, aus dem sie hier war, legte sich ein Gewicht wie ein Mühlstein auf sie. »Ja. Mike hat mir geraten, es so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Er meinte, ich sollte nicht zu lange darüber nachdenken. Er hat sogar angeboten mitzukommen, weil er der Ansicht ist, dass jemand bei mir sein sollte.« Sie spitzte spöttisch die Lippen. »Wahrscheinlich will er sich in seiner Funktion als Familienanwalt nur davon überzeugen, dass ich die Asche auch wirklich verstreue und die Urne nicht heimlich auf dem hintersten Regal in meinem Kleiderschrank verstecke.«
»Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich mitkomme, wenn du das tust ... Dein Bruder war so gut zu meinen Kindern und mir. Er stand mir sehr nahe ... Nick und Raquel ebenfalls.«
»Natürlich macht es mir nichts aus!«, rief Shelly beschämt. »Wäre ich nicht so in meine eigenen Gefühle versunken gewesen, hätte ich es selbst vorgeschlagen.« Während ihrer Zeit in New Orleans hatten Josh und sie eine sehr ausschließliche Beziehung geführt. Es gab nur sie beide, und Shelly hatte vollkommen vergessen, dass für Josh noch ein Leben außerhalb ihrer Zweisamkeit existierte, in dem es andere Leute gab, die sich um ihn kümmerten und ihn ebenfalls liebten. Er hatte zwar verfügt, dass seine Asche im engsten Kreise der Familie verstreut werden sollte, aber er hätte sicher nichts dagegen gehabt, wenn Maria dabei war. Und was Nick und Raquel anging ... Marias Ehemann Juan war fast immer unterwegs gewesen, sofern sich Shelly richtig erinnerte. Und Josh hatte die Verantwortung für das Wohlergehen der beiden übernommen. Genauso wie er sich um Shelly gekümmert hatte. Sie lächelte. Josh hatte sich wirklich manchmal wie ein Patriarch aufgeführt. Eigentlich hätte er ein halbes Dutzend eigener Kinder zeugen sollen, die er dann hätte herumkommandieren können. So war nur Shelly Opfer seiner Fürsorge gewesen. Und manchmal auch Nick und Raquel. Die beiden hatten ihn ebenfalls geliebt.
»Glaubst du, dass Nick und Raquel auch gern dabei wären?«, fragte Shelly Maria impulsiv. »Ich habe noch keine genaue Uhrzeit festgesetzt. Willst du sie anrufen und sie fragen?«
Das tat Maria, und so fand sich also an diesem Nachmittag eine feierliche Gruppe von fünf Menschen auf dem Pomo Ridge ein. Eintausendzweihundert Meter unter ihnen breitete sich das Tal vor ihnen aus. Es hatte sich immer noch nicht vollständig aus dem Griff des Winters befreit, wie der Fleckenteppich der Farben bewies. Die ausgesäten Felder strahlten in einem weichen Grün, aber auf den brachliegenden Äckern schimmerten gelb und bräunlich das abgestorbene Gras und die Büsche des letzten Jahres. Das frische Gras hatte sie noch nicht überwuchern können. An vielen Bäumen leuchteten bereits grüne Blätter, aber die Eichen, die überall im Tal wuchsen, hatten noch keine neuen Blätter gebildet. Das einzige Lebenszeichen an ihren fast kahlen Zweigen waren die schwachrosa Knospen, die den Frühling ankündigten. Shelly ließ ihren Blick zum Mount Sebastian schweifen, der hoch über dem Vorgebirge im Osten aufragte. Es überraschte sie nicht, Schnee auf seinen Gipfeln zu entdecken. Die hohen Fichten und Kiefern hoben sich dunkel von dem Weiß ab.
Von hier oben konnte Shelly die meisten Wahrzeichen des Tales erkennen. Sie sah den State Highway, der durch das Tal führte, und einige wenige Geschäfte, die ihn fünf oder sechs Blocks weit säumten. Unmittelbar unter ihnen lag der winzige Flughafen von Oak Valley, und eine halbe Meile schräg dahinter befanden sich die Gebäude der High School und die Grundschule. Ihr fiel auf, dass die High School noch immer keine Flutlichtanlage besaß. Das war ein Ärgernis für all diejenigen, die schon einmal an einem glühendheißen Septembernachmittag auf den nicht überdachten Metallbänken gesessen hatten, um ein Footballspiel zu verfolgen. Sie selbst hatte einige Spiele ertragen, obwohl sie die High -School gar nicht besucht hatte. In diesem Punkt war Josh ebenfalls sehr starrköpfig gewesen. Kam ein Granger ins High-School-Alter, wurde er oder sie auf eine Privatschule geschickt. Ob Shelly das nun passte oder nicht, sie musste diese sehr teure Privatschule in San Francisco besuchen, die er für sie ausgewählt hatte. Shelly runzelte die Stirn. Sie hatte ganz vergessen, wie stur Josh sein konnte, wenn er seinen Willen durchsetzen wollte. Und ein kleiner Snob war er obendrein gewesen.
Shelly kam dieser Gedanke beinahe ketzerisch vor, und sie schaute unbehaglich auf die schwere bronzene Urne in ihren Händen. Wie merkwürdig, dass dieses Gefäß alle körperlichen Überreste von Josh Granger enthalten sollte. Plötzlich wurde ihr die Endgültigkeit dessen bewusst, was sie gleich tun würde. Sie senkte gequält den Kopf, und Tränen brannten ihr in den Augen. Ach Josh! Wie konntest du dir das antun? Und uns anderen?
Shelly warf einen Blick auf die anderen, die sich in einem Halbkreis hinter ihr aufgestellt hatten. Es war eine seltsame kleine Gruppe. Die Haushälterin, ihre beiden erwachsenen Kinder und der Anwalt der Familie. Mike Sawyer entsprach dem Bild, das man sich von einem Anwalt machte. Er trug einen dunkelblauen Anzug, die Hose hatte eine scharfe Bügelfalte und das weiße Hemd und die Krawatte waren makellos. Nur seine eleganten, schwarzen Cowboystiefel wichen etwas vom Anwaltsimage ab. Das gefiel Shelly. Dadurch wirkte Sawyer zugänglicher, weniger steif und professionell. Maria war ebenso schlicht gekleidet wie Shelly. Sie trug eine gebügelte schwarze Hose und ein Hemd, und trotz der blassen Sonne eine leichte Kostümjacke zum Schutz vor dem kühlen Wind. Nick und Raquel standen neben ihrer Mutter. Nick überragte die beiden Frauen um mehr als einen Kopf. Er hatte die Augen halb geschlossen und die Lippen fest zusammengepresst. Raquel erinnerte Shelly an Maria. Sie war klein, zierlich und hatte ein hübsches Gesicht, von dem man allerdings hinter den Papiertaschentüchern, mit denen sie sich ständig die Augen abtupfte, kaum etwas sah.
Shelly schaute rasch weg, als sie fühlte, wie ihre eigenen Tränen hochstiegen. Ihr schnürte sich der Hals zu. Sie räusperte sich. »Möchte jemand ein paar Worte sprechen?«, fragte sie.
Maria zögerte, nickte und trat vor. Sie legte ihre Hand auf die Urne und sagte mit zitternder Stimme: »Du warst ein guter Mann, Josh Granger. Ich werde dich vermissen. Ruhe in Frieden.«
Ihre Kinder schüttelten auf Shellys auffordernden Blick ablehnend den Kopf. Nick starrte angestrengt auf einen Punkt zwischen seinen Stiefeln, und Raquel versteckte ihr Gesicht hinter noch mehr Taschentüchern. Mike ergriff das Wort. »Ich habe eine kleine Bibel mitgebracht. Ich könnte den zweiunddreißigsten Psalm vorlesen, wenn Sie wollen. Ich glaube, der wird bei Beerdigungen häufig verwendet.«
Shelly schüttelte den Kopf. »Das ist nicht nötig. Josh hat nur dann einen Fuß in eine Kirche gesetzt, wenn er es unbedingt musste. Ich glaube, ihn kümmert das nicht.«
Sie drehte sich um und schaute über das Tal. Dann holte sie tief Luft, nahm den Deckel von der Urne und schüttelte langsam die Asche hinaus. Ein leichter Wind trug die graue Asche mit sich davon. Das war alles, was von Josh Granger übrig geblieben war. Leb wohl, Bruderherz, dachte Shelly, und Tränen brannten ihr in den Augenwinkeln. Finde deinen Frieden. Eine tiefe Trauer hüllte sie ein.
Eine verlegene und schweigsame Gruppe fuhr die drei Meilen in Shellys Bronco zu Joshs Haus zurück. Erst als sie in der Küche saßen und den Kaffee tranken, den Maria aufgesetzt hatte, bevor sie losgefahren waren, kam ein Gespräch auf.
Zunächst tasteten sie sich zögernd und unsicher ab. Shelly hatte von Mike Sawyer gehört und in letzter Zeit ja auch häufiger mit ihm telefoniert, ihn jedoch noch nicht persönlich kennen gelernt. Bis auf verschwommene Erinnerungen waren Nick und Raquel ihr ebenfalls fremd. Maria hatte Shelly vor siebzehn Jahren das letzte Mal gesehen. Da Joshs Tod das Gespräch überschattete, war es natürlich alles andere als gemütlich, doch je länger die Stimmen Shelly einhüllten, desto entspannter wurde sie.
»Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, extra hier heraus zu fahren«, erklärte sie und schaute Mike Sawyer an. Sie lächelte schwach. »Schließlich gehört es ja wohl kaum zu den Aufgaben eines Anwalts, den trauernden Hinterbliebenen die Asche ihrer Verstorbenen ins Haus zu bringen.«
Sawyer war etwa Mitte bis Ende dreißig. Jetzt saß er zurückgelehnt auf dem Küchenstuhl. Seinen Mantel hatte er ausgezogen und die Krawatte gelöst. Er ähnelte so noch weniger einem Familienanwalt und wirkte attraktiver, als Shelly zuerst gedacht hatte. Er war über eins achtzig groß, schlank und hatte hellbraunes Haar und blaue Augen. Shelly fing an, sich für ihn zu erwärmen. Ihr gefielen sein intelligenter Blick und der sinnliche Schwung seiner Lippen.
Sawyer machte eine abwehrende Handbewegung. »Das habe ich gern getan. Ihr Bruder war mehr als nur ein Klient für mich, er war auch ein Freund. Ich hoffe, dass Sie mich ebenfalls als solchen betrachten.«
Shelly nickte, sah die anderen am Tisch der Reihe nach aufmunternd an und hob ihren Kaffeebecher. »Auf die Freundschaft!«
Maria strahlte, Raquel nickte, und Sawyer grinste. Nick saß ihr gegenüber, hatte die Beine ausgestreckt und maß Shelly einen Moment mit seinem Blick. Schließlich zuckte er mit den Schultern und ergriff auch seinen Becher. »Warum nicht?«
Das war zwar nicht gerade eine begeisterte Reaktion, aber Shelly gab sich damit zufrieden. Sie toasteten sich zu. Das Gespräch plätscherte eine Weile belanglos dahin, bis Raquel unvermittelt fragte: »Wie lange willst du bleiben?«
Shelly hielt den Blick fest auf ihren braunen Steingutbecher gerichtet. »Ich ... habe noch keinen festen Zeitplan gemacht.« Sie schluckte und fuhr dann zuversichtlicher fort: »Vielleicht kehre ich auch gar nicht nach New Orleans zurück.« Sie blickte hoch. »Ich spiele mit dem Gedanken, für immer hier zu bleiben.«
»Oh, Chica! Ich bin so froh, dass du das sagst!«, rief Maria. »Josh hat sich so gewünscht, dass es eines Tages dazu kommen würde.« Ihre Miene verdüsterte sich einen Moment. »Ich habe nicht das Recht, Kritik zu üben, und es klingt vielleicht jetzt anders, als ich es meine, aber es ist schade, dass du diese Entscheidung erst jetzt getroffen hast. Und nicht, als Josh noch lebte. Er hat so oft davon gesprochen, wie viel ihm daran läge, dass du nach Oak Valley zurückkehren würdest. Er hat sich nach deiner Rückkehr gesehnt und hat immer gesagt, wie sehr er dich vermisst. Er war sehr einsam ohne deine Gesellschaft.«
Shelly runzelte die Stirn. Das erinnerte sie anders. Die wenigen Male, die sie eine mögliche Rückkehr angeschnitten hatte, hatte Josh das Thema einfach beiseite gefegt und rasch von etwas anderem gesprochen. Eigentlich hätte sie eher vermutet, dass er gar nicht unbedingt wollte, dass sie nach Oak Valley zurückkam. Er schien sehr zufrieden damit zu sein, dass sie in New Orleans blieb, und jetzt erzählte Maria ihr das glatte Gegenteil. Wenn er gewollt hatte, dass Shelly nach Hause kam, warum hatte er dann nie etwas gesagt?
Sie zuckte verwirrt mit den Schultern. »Na ja, jetzt bin ich hier, wenn auch ein bisschen spät.«
Sawyer vertrieb die ungemütliche Stimmung, die sich über die kleine Gruppe zu legen drohte. »Wo wir gerade von Zeit sprechen«, warf er beiläufig ein. »Ich sollte jetzt wohl gehen. Ich habe noch eine anderthalbstündige Fahrt vor mir. Vorher könnten wir vielleicht die Verlesung von Joshs Testament hinter uns bringen. Ich habe es nur für den Fall mitgebracht, dass sich eine Gelegenheit ergibt. Irgendwie fand ich es unnötig, dass Sie alle für diese Förmlichkeit in mein Büro kommen mussten. Wenn Sie mich kurz entschuldigen, dann hole ich es aus meinem Wagen.«
»Natürlich.« Sawyers Umsicht nahm Shelly noch mehr für den Anwalt ein.
Nachdem er gegangen war, machte sich ein verlegenes Schweigen unter den Anwesenden breit. Shelly fiel wieder auf, wie fremd ihr alle waren. Wenn doch Roman und Angelique mitgekommen wären! Sie hielt ihren Blick auf den Becher vor sich gerichtet und wartete auf Sawyers Rückkehr. Mit jeder Sekunde wuchs die Anspannung in ihrem Bauch.
Schließlich sah sie mit einem gezwungenen Lächeln Maria und ihre Kinder an. »Es war sehr nett von euch, dass ihr mich begleitet habt, als ich seine Asche verstreut habe.«
»Das hat nichts mit Nettigkeit zu tun«, knurrte Nick. Seine Miene war abweisend und gleichzeitig entschlossen.
»Oh, Nick, nicht! Nicht jetzt!«, rief Raquel und packte seinen Arm. »Bitte! Wir haben gerade von Josh Abschied genommen. Ich weiß, wie du ihm gegenüber empfindest, aber fang jetzt nicht damit an.«
»Deine Schwester hat Recht«, stimmte Maria ihrer Tochter zu. »Jetzt ist die Zeit zu trauern. Für ... für die anderen Dinge bleibt später noch Zeit genug.«
Shelly musterte verwirrt die verschlossenen Gesichter am Tisch. »Würde mir vielleicht jemand sagen, worum es hier eigentlich geht?«
Nick schaute sie an und verzog den Mund zu einem bitteren Lächeln. »Du hast wirklich keine Ahnung, was?« Er schüttelte den Kopf. »Das dachte ich mir. Der gute alte Josh hat nicht geduldet, dass irgendetwas seine unschuldige kleine Prinzessin aufschreckte oder ihn etwa von dem Podest stürzen könnte, auf das du ihn ja wohl gestellt hast.« Er lachte, aber es klang nicht fröhlich. »Erlaube mir, dem goldenen Selbstbildnis, das er dir präsentiert hat, den ersten Kratzer zu versetzen.« Er verbeugte sich spöttisch. »Darf ich vorstellen: Ich bin dein Neffe, Tante. Natürlich bin ich kein legitimer Verwandter. O nein. Josh durfte mit der Haushaltshilfe schlafen und sie schwängern, aber Gott verhüte, dass ein großer und mächtiger Granger jemals seine mexikanische Haushälterin heiraten oder etwa öffentlich sein eigenes Fleisch und Blut aus dieser Verbindung anerkennen würde.« Als er Shellys Bestürzung bemerkte, fuhr er fort. »Ja, ganz richtig kombiniert, Tante. Ich bin der uneheliche Sohn deines Bruders. Jetzt kennst auch du das Familiengeheimnis. Meinen Glückwunsch!«