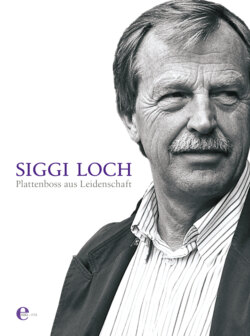Читать книгу Plattenboss aus Leidenschaft - Siggi Loch - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
01 SUMMERTIME, BUT LIVING AIN’T EASY ~ DIE ERSTEN JAHRE 1940–1959
ОглавлениеIm Sommer 1940 veröffentlichte das Billboard Magazine in den USA erstmals seine inzwischen legendären Charts, an deren Spitze wochenlang Tommy Dorsey mit I’ll Never Smile Again stand. Benny Goodman war als »King of Swing« auf dem Höhepunkt seiner Karriere, und Louis Armstrong trat mit Sidney Bechet auf, der im Jahr zuvor die erste Jazz-Version von Gershwins Summertime für ein neugegründetes Label namens BLUE NOTE aufgenommen hatte.
Im Sommer 1940 hatte Nazideutschland seine Serie von »Blitzkriegen« abgeschlossen: Polen, Frankreich, Dänemark, Norwegen und die Benelux-Länder waren besiegt. Die Bombardierung Englands begann, der Überfall auf die Sowjetunion war in Vorbereitung. Allüberall zitterten die morschen Knochen, wenn die Hitler-Jugend sang: »Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.«
Im Sommer 1940, am 6. August, wurde ich in Stolp/Pommern geboren, dem heute polnischen Słupsk, eine Stadt, an die ich keine Erinnerungen hatte und 2010 erstmals besucht habe. Der Ort nahe der Ostseeküste hat eine Reihe bedeutender Töchter und Söhne hervorgebracht, unter anderem den Bildhauer und Maler Otto Freundlich (1878 –1943), dessen Werk ich sehr schätze. Für die Nazis war sein Werk »entartet«, sie ermordeten den jüdischen Künstler im KZ Lublin-Majdanek.
Meine Vorfahren mütterlicherseits waren Bauern mit eigenem Hof nahe der damaligen Grenze zu Polen. Sie hatten fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter, und wie es üblich war, erbte der älteste Sohn den Hof. Die Töchter wurden verheiratet, so auch meine Mutter. Der zehn Jahre ältere verwitwete Gemüsehändler Emil Loch (geb. 1900), der für seine fünf Kinder eine neue Frau suchte, konnte meine Großmutter überreden, ihm die hübsche Berta zu überlassen. Diese hat sich gefügt. Eine Liebesheirat war es nicht. Aus dieser Beziehung stammen außer mir, dem Ältesten, meine Schwester Christl, geboren 1944, und mein Bruder Hans-Jürgen, geboren 1947.
Der Vater war als Feldkoch im Krieg an der Ostfront. Meine Mutter und mich verschlug es in das von Deutschland besetzte polnische Kalisch, dort kam Christl zur Welt. Auf der Flucht vor der heranrückenden Roten Armee landeten wir zu Kriegsende im völlig zerstörten Halle/Saale. Aus dieser Zeit stammen meine frühesten Erinnerungen: die Flüchtlingstransporte unter Bombenangriffen, die ständigen Bunkeraufenthalte und danach die endlosen Kolonnen deutscher Kriegsgefangener, die von den Russen durch die Straßen getrieben wurden. Im Mai 1945 war der Krieg in Europa zu Ende, in Japan noch nicht: Am 6. August, meinem fünften Geburtstag, warfen die Amerikaner die Atombombe über Hiroshima ab.
Das erste Musikerlebnis, an das ich mich noch genau erinnern kann, hatte ich, als ein russischer General im offenen Sarg durch Halle getragen wurde. Die Trauermusik der Militärkapelle fand ich so großartig und schön, dass ich den Zug zum Entsetzen meiner Mutter bis zum Friedhof begleitete.
Schon bald nach Kriegsende stand mein Vater unerwartet vor unserer Tür. Ich staune bis heute darüber, wie es dem Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes trotz des allgemeinen Chaos damals gelang, Familien wieder zusammenzuführen.
Mein Vater war von Beruf Landverwalter ohne eigenen Hof und damit den sowjetischen Besatzern nicht verdächtig. Im Zuge der sozialistischen Bodenreform erhielt er die Aufgabe, den Großgrundbesitz Dippische Saatgüter in Bösewig bei Wittenberg zu zergliedern. Die Familie lebte jetzt erstmals zusammen. Wir wohnten in dem ehemaligen Herrenhaus und waren durchaus privilegiert. Wie das Leben damals aussah, davon gibt der Fernsehmehrteiler »Liebesau« von 2002, dem das verschlafene Bösewig als Kulisse diente, eine gute Vorstellung.
Zum Erntedankfest 1946 gab es ein Fest, dem ich meinen ersten Auftritt als »Musiker« verdanke. Ich hatte mich hinter der Kapelle in einem Schrank versteckt, um auf einer großen Vase den zweiten Schlagzeuger zu geben. Mein Stiefbruder Emil, der damals bei uns lebte, war ein guter Akkordeonspieler und musste meinem Vater allabendlich die alten Vorkriegsschlager vorspielen. Als Emil die Familie wieder verließ (ich sollte ihm erst 30 Jahre später wieder durch Zufall begegnen), bekam ich mein eigenes Akkordeon und Unterricht, auch wenn ich das Instrument nie wirklich gut spielen lernte. Nun war es meine Aufgabe, den Vater mit den Caprifischern und dergleichen Liedgut zu erfreuen, er spielte dazu auf einer Mini-Mundharmonika.
Siggi mit Akkordeon, 1950
Wenige Jahre nach der Neuaufteilung der ehemaligen Großländereien wurde deutlich, dass sich die Kleinbauern von den Erträgen ihrer 20 Morgen Land nicht ernähren konnten, geschweige denn, dass sie ihr Abgabesoll hätten erfüllen können. Viele suchten ihr Glück im Westen. Nach Gründung der DDR 1949 begann die Zeit der LPGs, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Als Kreiswirtschaftsberater – ein höheres politisches Amt – war mein Vater bei der erneuten Umwandlung beteiligt, die Kleinbauernbetriebe wurden kollektiviert. Wir zogen von Bösewig nach Merseburg.
Im Herbst 1950 erhielt mein Vater vom DRK die Nachricht, dass sich Lothar, sein verschollener jüngster Sohn aus erster Ehe, in Delmenhorst bei Bremen im Kinderheim befand. Vater bekam als Parteifunktionär einen Interzonenausweis und fuhr nach Westdeutschland, um dort zu beschließen, nicht wieder zurückzukehren. Für die DDR-Machthaber war das eine besonders niederträchtige Republikflucht, und fortan hatten wir die Staatssicherheit am Hals. Meine Mutter erhielt striktes Reiseverbot, man drohte mit Arbeitslager und damit, ihr die Kinder wegzunehmen. 1951 gelang es ihr dennoch, Merseburg bei Nacht zu verlassen, und zum zweiten Mal flohen wir gen Westen. Nur mit dem, was wir tragen konnten und am Leib trugen, überschritten wir bei Helmstedt die noch grüne Grenze. Der Vater wurde derweil im Westen nicht als »politischer Flüchtling« anerkannt und erhielt keine Aufenthaltsgenehmigung – wer nicht anerkannt wurde, durfte zwar bleiben, hatte aber kein Anrecht auf Unterstützung. So lebte er ohne Arbeit in einer Gartenlaube bei Hannover. Wir landeten im Notaufnahmelager Uelzen. Nach Monaten wurde auch uns die Aufenthaltsgenehmigung verweigert, und wir fanden zunächst Unterschlupf bei einer Tante in Hannover. Als in Westdeutschland der Wiederaufbau seine ersten Früchte zeitigte, standen wir erneut vor dem absoluten Nichts.
Ein Bruder meiner Mutter war vor dem Krieg Diakon in den Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel bei Bielefeld gewesen, und über diese Verbindung bekamen wir drei Kinder einen Platz in einem Heim. 1952 suchte Dr. Editha von Rundstedt über eine Anzeige eine Pflegerin für ihre Schwiegereltern, den Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt und seine Frau. Rundstedt war einer der führenden deutschen Heeresoffiziere im Zweiten Weltkrieg gewesen und wegen Differenzen mit Hitler mehrfach entlassen und wieder berufen worden, zuletzt als Oberbefehlshaber West. Berühmt war er mit seiner Kritik an der obersten Führung vom Juli 1944 geworden (»Ihr müsst den Krieg beenden, ihr Idioten!«). Bei den Nürnberger Prozessen hatte man Rundstedt nicht verurteilt, sondern als Kriegsgefangenen nach England geschafft. 1949 war er aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands entlassen worden.
Meine Mutter nun pflegte den alten Feldmarschall und seine Frau. Meine beiden Geschwister kamen zu Verwandten der Rundstedts in die Schweiz bzw. in Schweden, und ich zog zu den Eltern in das Gartenhaus nach Hannover-Kleefeld. Auf rund 25 Quadratmetern wurde gelebt, gekocht und geschlafen, im Garten stand ein Klohäuschen. Mein Vater arbeitete inzwischen als Hilfsarbeiter in einem Eisenwerk. Meine Mutter pflegte Rundstedt bis zu seinem Tod im Februar 1953. Ein Jahr später stellte man bei ihr selbst die Diagnose Krebs, und nach schwerer Operation lag sie fast ein Jahr lang im Krankenhaus. Editha von Rundstedt erwies sich für uns immer wieder als Retterin in der Not, und sie nannte sich meine »Vize-Mutter«.
In dieser Zeit machte ich meine erste Erfahrung mit einer cleveren Marketing-Idee. Ich hörte von dem Deutschen Seifenkisten-Derby, das die Amerikaner seit 1949 in ihrem Sektor ausrichteten und das inzwischen alljährlich in über 100 deutschen Städten ausgetragen wurde. Veranstalter waren General Motors und die Opel AG. Die Jungs zwischen zwölf und 15 Jahren mussten ihre Seifenkisten (von den genormten Rädern abgesehen) selbst bauen, auch wenn man vielen Fahrzeugen die helfende Vaterhand ansah. 1953 nahmen bundesweit 17.500 Jungs teil. Von einer Rampe rollte man eine zwei Kilometer lange abschüssige Strecke herunter. Die örtlichen Sieger wurden zur Deutschen Meisterschaft eingeladen, der deutsche Meister flog zu den Soap-Box-Weltmeisterschaften nach Dayton, Ohio. Außerdem gab es eine gut dotierte Ausbildungsbeihilfe.
In der Seifenkiste, 1955
In Hannover fand das Rennen auf dem Lindener Berg statt. Ich baute meine erste Seifenkiste, obwohl ich noch nie ein echtes Rennen gesehen hatte. Das Geld für das Baumaterial verdiente ich mir durch Lieferdienste, das Blech erbettelte ich von den Vereinigten Leichtmetallwerken. Meine erste Fahrt im Juni 1954 endete allerdings nicht im Ziel, sondern in einem Strohballen.
Inzwischen hatte Frau von Rundstedt meinem Vater eine Anstellung als Hausmeister mit Dienstwohnung bei einer Behörde in Hannover-Linden vermittelt. Mutter kam aus dem Krankenhaus und auch die Geschwister kehrten wieder zurück zur Familie. Ich machte meinen Volksschulabschluss und war glücklich, eine Lehrstelle als Großhandelskaufmann bei Blaupunkt bekommen zu haben.
Am 19. Juni 1955 ging ich erneut mit meiner Seifenkiste an den Start. Ich belegte den zweiten Platz und fuhr zur deutschen Meisterschaft nach Duisburg. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich etwas erreicht, auf das ich richtig stolz war. Mein Name stand gedruckt im Programmheft und in der Zeitung. In Duisburg gewann ich drei Zwischenläufe, aber nach der letzten Zieldurchfahrt vor dem Endlauf versagten die Bremsen und ich landete mit einem eleganten Überschlag im Stroh. Aus der Traum wegen »Motorschaden«. Aber ich machte Schlagzeilen mit dem Foto von meinem Überschlag auf der Titelseite der »Hannoverschen Presse«. Ich hatte gekämpft, Respekt und Freunde gewonnen, und zum ersten Mal fühlte ich mich nicht mehr abgelehnt und ausgestoßen.
Mein musikalischer Horizont war damals beschränkt auf die Schlager, die ich meinem Vater vorspielte, sowie die gängigen Schnulzen im Radio und aus den Musikboxen, die emotionalen Begleiter des Wiederaufbaus. Bill Haleys Rock Around the Clock mischte 1954 die Welt der populären Musik auf, doch an mir ging das vorbei. Aber dann hörte ich im Radio die Ankündigung eines Jazzkonzerts mit Sidney Bechet in der Niedersachsenhalle, und das machte mich neugierig. Mangels Geld stieg ich durch das Kellerfenster in den Heizungskeller ein, um gerade rechtzeitig in die Halle zu gelangen. Die Musik des kleinen weißhaarigen Mannes mit dem Sopransaxophon verzauberte mich auf der Stelle.
Nach dem Konzert wartete ich am Künstlerausgang auf den Meister, um mir auf einem Zettel ein Autogramm geben zu lassen, das ich später mit einem Porträt verzierte. Am nächsten Tag kaufte ich zum stolzen Preis von 7 Mark 50 meine erste Schallplatte, natürlich von Sidney Bechet – eine EP von BLUE NOTE, ein Mittelding zwischen Single und Langspielplatte mit drei Stücken darauf. Nur hatte ich keinen Plattenspieler. Also stellte ich monatelang abends in einer Kegelbahn die Kegel auf, bis ich genügend Geld verdient hatte, um mir ein tragbares Philips-Gerät mit eingebautem Verstärker und Lautsprecher kaufen zu können. Das weitere Geld investierte ich in neue Schallplatten.
Zeichnung Sidney Bechet
Im Dezember 1956 mussten wir unsere Eltern zu einer Weihnachtsfeier der Pommerschen Landsmannschaft nach Miesburg begleiten. Inzwischen fand ich als stolzer Jazzfan jede andere Musik und insbesondere die der Kapelle jenes Weihnachtsabends grauenhaft. Der Abend bot mir nichts für die Ohren, aber umso mehr für die Augen: Sie sahen sich an einem Mädel im Saal fest. Irgendwann nahm ich all meinen Mut zusammen und forderte sie zum Tanz auf. Sie hieß Liselotte Reinhard, ihre Familie stammte ebenfalls aus Stolp. Wir verabredeten uns für den nächsten Sonntag.
Sie wurde die Liebe meines Lebens und ist es bis heute. Nur den Namen Liselotte fand ich altbacken. 1956 kamen die jungen amerikanischen Rebellen in die deutschen Kinos: Der Wilde mit Marlon Brando, Die Saat der Gewalt mit Glenn Ford und Sidney Poitier und vor allem James Dean und Natalie Wood mit Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die deutsche Antwort darauf waren Die Halbstarken mit Horst Buchholz und Karin Baal. Mit meiner neuen Liebe ging ich in diesen Film, in dem Karin Baal eine Sissy spielte und die Titelmusik der Sissy Blues war. Nach dem Kinobesuch wurde aus Liselotte meine Sissy.
Sidney Bechet mit seiner Vitalität und Spontaneität hatte mich für den Jazz begeistert. Ich wollte mehr erfahren über diese Musik und kaufte mir ein Buch, das zwei Jahre zuvor erschienen war: Das Jazzbuch des jungen Rundfunkredakteurs Joachim Ernst Berendt. Damals hatte es schon eine Auflage von 100.000 Exemplaren. Das mehrfach überarbeitete und bis heute erfolgreichste Jazzbuch aller Zeiten bleibt die Bibel aller Fans und ein sehr guter Einstieg in die Materie.
Berendt hat darin, dem Musikwissenschaftler Marshall W. Stearns folgend, eine »Definition des Jazz« versucht: »Jazz ist eine improvisierte amerikanische Musik, die europäische Instrumente gebraucht und Elemente europäischer Harmonik, europäisch-afrikanischer Melodik und afrikanischer Rhythmik miteinander verbindet.« Damit war ich in Sachen Theorie fürs Erste ins Bild gesetzt, wenn auch nicht viel schlauer. Weit wichtiger waren für mich die vielen neuen Namen und Zusammenhänge und Berendts Einblicke in die Geschichte des Jazz und damit auch in die Sozialgeschichte Amerikas.
Damals galt meine ungeteilte Zuneigung dem traditionellen Jazz mit seinen Wurzeln in New Orleans. Diese Musik, auch Dixieland genannt, war relativ leicht zu erlernen und gelangte in Europa zu großer Popularität. Monty Sunshine (der seine Karriere mit einer Einspielung von Sidney Bechets Petite Fleur begann) und Chris Barber kamen groß mit ihr heraus und spielen sie bis in die jüngste Zeit. Auch bei uns schossen Dixieland-Bands wie Pilze aus dem Boden, und ich begann von einer eigenen Jazzband zu träumen. Jazz, das war für mich die Verwirklichung von individueller Freiheit in einer Gruppe von Gleichgesinnten, und da wollte ich dabei sein, nicht nur als Fan und ganz sicher nicht mit meinem Akkordeon. Ein Schlagzeug sollte es sein.