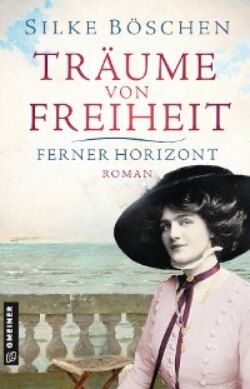Читать книгу Träume von Freiheit - Ferner Horizont - Silke Böschen - Страница 11
6. Schlüsselgewalt
ОглавлениеDresden, 04. Oktober 1881, am frühen Abend
Das Speisezimmer lag nach Osten hin. Nur am Morgen schien die Sonne herein. In der übrigen Zeit blieb es ein dunkler Raum – verstärkt noch durch die Eichenholzvertäfelung, die ringsum die Wände zur Hälfte einnahm. Darauf war ein umlaufendes Holzbord angebracht. Hier hatte Florence kleine Zinngefäße aufgestellt. Krüge, Teller und andere Gefäße. So wie sie es bei ihrer Freundin Minna von Funcke gesehen hatte. In deutschen Häusern war Zinn beliebt. Es sah alt aus, historisch. Das hatte ihr Minna erklärt. Sie musste es wissen, schließlich war sie mit einem deutschen Adeligen verheiratet. Minna, die als Mary Emerson in Amerika zur Welt gekommen war, hatte in Sachsen ihr Glück gefunden: Bernhard Oskar von Funcke, Stadtkommandant von Dresden.
Während Florence auf die Parade der Zinnbecher und den passenden Krug dazu starrte, gelangte Adele unbemerkt in den Raum und stellte eine Kristallkaraffe mit Wasser auf den Tisch. Florence’ Gedankenreise zu den Funckes endete abrupt. Sie seufzte. Heute Abend würde sie sich nicht streiten. Nein, sie würde Henri ganz ruhig erzählen, was vorgefallen war, weiter nichts. Sie würde ihm keine Szene machen. Warum auch? Schließlich war es seine Mutter, die so bösartig zu ihr gewesen war, nicht er. Eine hinterhältige Schlange. Florence trank einen Schluck von dem kühlen Wasser. Henry und Minnie hatten bereits mit der Kinderfrau zu Abend gegessen und lagen im Bett. Beim Gute-Nacht-Kuss und dem gemeinsamen Abendgebet war die Auseinandersetzung mit Granny kein Thema mehr gewesen. Vermutlich hatten die beiden gar nicht so viel mitbekommen, hoffte Florence. Die Hagebutten mit ihrem juckenden Innenleben waren interessanter gewesen.
»Guten Abend.« Henri stand im Türrahmen und warf ihr einen flüchtigen Blick zu.
»Henri, wie schön, dich zu sehen!« Sie wollte ruhig bleiben und freundlich. Unbedingt.
Er setzte sich. »Nanu, so gut gelaunt? Nach so einem Tag?«
Florence zwang sich, über diese Bemerkung hinwegzugehen. »Warum nicht? Ich habe meistens gute Laune. Das weißt du.«
»Ja, natürlich. Das hätte ich beinahe vergessen. Meine Frau ist für ihre gute Laune bekannt. Es gibt kein Fest, kein Dinner, an dem sie nicht alle anderen mit ihrer Fröhlichkeit ansteckt …« Sein Ton war bissig.
»Ich weiß nicht, was diese Bemerkung soll. Hättest du lieber jemanden an deiner Seite, der melancholisch ist?«
»Nein, sicher nicht. Aber weißt du, Florence, es kommt darauf an, die Haltung zu bewahren. Auch wenn man bester Dinge ist«, dozierte er und schenkte sich selbst ein Glas weißen Burgunder ein. »Ich vermute, du möchtest heute keinen Wein, oder? Dr. Zumpe hat mir mitgeteilt, dass du etwas unpässlich bist.«
Florence sah ihn überrascht an. Henri nahm einen tiefen Schluck und atmete aus. »Da staunst du, was ich alles weiß! Ich sehe es an deinem hübschen Gesicht. Das kleine Frauchen begreift gar nicht, was um sie herum passiert.« Er schüttelte mit gespielter Verzweiflung den Kopf.
»Henri, bitte! Ja, es stimmt, Dr. Zumpe war hier. Ich dachte zuerst, er wollte zu dir, aber nein, angeblich hättest du ihn geschickt. Dabei habe ich doch gar nichts. Gut, ab und zu die Kopfschmerzen. Aber wahrscheinlich hast du recht, und ich sollte tatsächlich weniger Zigaretten rauchen.« Sie war fest entschlossen, diesen Abend überlegt und gemessen zu gestalten. Sie musste in Ruhe mit Henri sprechen – über die ungeheuerlichen Vorwürfe und Ideen seiner Mutter.
»Ich verrate es dir, Florence. Dr. Zumpe hat mir eine Nachricht zukommen lassen. Er macht sich Sorgen. Und ich auch.«
Florence berührte vorsichtig seine Hand, die neben dem Weinglas lag. Henri zuckte zusammen. »Beinahe hätte ich das Glas umgeworfen!«
»Aber ich bin doch deine Ehefrau, Henri!«
Er nickte fahrig. Dann läutete er nach dem Personal. Das Abendessen wurde aufgetragen.
Florence rang sich durch, wenigstens ein paar Bissen zu essen. Henri beäugte das Stochern auf dem Teller argwöhnisch.
»Da liegt der Doktor schon richtig, wenn du nicht einmal mehr essen magst.«
Florence tupfte sich den Mund ab. »Womit liegt er richtig?«
»Mit seiner Diagnose. Deine Launenhaftigkeit, deine Abgeschlagenheit, die dauernden Kopfschmerzen. Und zwischendurch rührst du nicht einmal das Essen an. Dr. Zumpe meint, dass du an einer Mischung aus Hysterie und Melancholie leidest.«
»Henri, ich bin gesund. Es ist etwas anderes. Ich traf vorhin deine Mutter. Unten auf der Mosczinskystraße, an der Ecke Christianstraße. Ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, aber wir gerieten in einen Streit. Und …« Florence schluckte. »Deine Mutter behauptete auch, dass ich krank sei. So …« Sie tippte sich an ihren Kopf. »Also, ihrer Meinung nach gehöre ich in eine Irrenanstalt. Stell dir das einmal vor! Und es ging noch weiter. Du wärst angeblich auch dafür.«
Jetzt war es heraus. Sie sah ihren Mann an. Henri leerte sein Weinglas und drehte es am Stiel. Er schwieg.
»Hörst du, Henri, in eine Anstalt! Das hat sie gesagt. Und angeblich findest du auch, dass ich dorthin gehöre.«
Auf einmal klang ihre Stimme ängstlich. Fast wie die eines Kindes. Henri spürte ihre Furcht. Sah plötzlich wieder die ganz junge Florence vor sich. Damals beim Maskenball im Hotel de Saxe. Als sie zurückkehrten aus dem dunklen Korridor und sich wieder unter die anderen Gäste mischten. Ein Hauch von Scham stieg in ihm auf. Schnell verscheuchte er die Erinnerung. Es war ihre eigene Schuld, ganz allein. Immer reizte sie ihn, reizte seine Mutter, ja, sie reizte alle möglichen Menschen, das hatte er schon häufiger gehört. Und dann kam dieses zitternde Stimmchen. Selbst schuld. Sollte sie doch aufhören. Sollte sie doch einmal Vernunft annehmen. Er war im Recht. Florence war hübsch anzuschauen, hübsch anzuhören, und man konnte mit ihr lachen, doch das alltägliche Leben war mit dieser Frau unmöglich. Eine schlechte Mutter, die die Kinder verweichlichte. Eine überforderte Hausfrau, die nie verstanden hatte, dass man sich mit Dienstboten nicht gemeinmachte, und als Ehefrau eine Zumutung. Wie sie andere Männer ansah, gurrte, kicherte, den Kopf schräg hielt. Die Wut war wieder da. Wie schwarze Tinte floss sie durch seine Adern, sein Herz.
»Florence, ich stimme meiner Mutter zu!«, sagte er laut und sah sie endlich an. Sah die braunen Augen, in denen Tränen schimmerten. Sah den Kirschenmund, der offen stand. Sah, wie ihre Hand anfing zu zittern. Sie war ein Nervenbündel. Dr. Zumpe hatte es gesagt, so oder so ähnlich. Wie es eben ein Arzt sagt. Henri war kein Mediziner. Er war Bergbau-Ingenieur. In einem Stollen braucht man Ruhe und Besonnenheit. Sonst ist es lebensgefährlich, dachte er. Florence würde alle verrückt machen unter Tage. Sie war ja selbst verrückt. Er musste aufstoßen. Dieser neue weiße Burgunder war nichts für seinen empfindlichen Magen.
Er hörte, wie sie die Luft durch die Nase ausstieß. »Henri, ich kann es nicht glauben! Hat dich deine Mutter so sehr gegen mich aufgehetzt? Hat sie es endlich geschafft, dass du mich wegstößt?« Sie schüttelte den Kopf und presste die Lippen zusammen. Das Schluchzen sollte nicht hinaus.
»Meine Mutter hat dir so oft angeboten, dir zu helfen. Wie man einen Haushalt führt, wie man Kinder erzieht. Sie wollte dich unterstützen als eine de Meli. Aber nichts davon hast du angenommen!«
»Wer geht denn jeden Sonntag nach der Kirche zu ihr? Jeden Sonntag sitzen wir bei deiner Mutter, und ich muss mir ihre Kritik anhören, was ich alles falsch mache.«
Das Essen wurde abgeräumt. Henri stand auf und ging zum Büfett. In einem der verspiegelten Schrankfächer befand sich seine ansehnliche Sammlung von verschiedenen Sorten Magenbitter und anderen hochprozentigen Flüssigkeiten. Er goss sich einen Karlsbader Becherbitter ein.
»Ich verstehe gar nicht, warum du dich so aufregst. Sieh es doch einmal so, du kommst in ein schönes Maison de Santé und kannst dich einmal wirklich erholen. Musst dich um nichts kümmern. Ohne Kinder. Ohne mich. Ich habe schon mit Dr. Zumpe gesprochen. Er riet mir zu einer Kur für Neurastheniker. Da gibt es wohl allerhand wirkungsvolle Maßnahmen. Und ganz in der Nähe. Wir kommen dich besuchen.«
Florence hörte ihren eigenen Herzschlag. Es war eine abgemachte Sache. Sie hatten es hinter ihrem Rücken geplant. Dr. Zumpe war mit im Bunde. Ihr wurde schlecht.
»Was ist mit dir? Du bist ja ganz weiß im Gesicht. Magst du auch einen Magenbitter?«
Florence schüttelte den Kopf. Ihre Stimme bebte. »Ich kann nicht glauben, was du da sagst. In ein Maison de Santé? Was heißt das denn? Das ist doch nur ein schöner Name für eine Irrenanstalt!«
»Florence, mäßige dich, bitte! Es ist doch nur zu deinem Besten.« Er tat so, als müsste er nachdenken.
»Vergiss bitte nicht, wie du dich aufgeführt hast. Vergiss nicht die Episode mit dem Maler. Ich habe sie nicht vergessen!« Jetzt klang er drohend.
Florence schüttelte den Kopf. »Immer kommst du mir mit dieser alten Kamelle! Du weißt so gut wie ich, dass alles ganz harmlos war. Ein junger Kunstmaler. Gerade erst von der Akademie. Na und? Er hat ein schönes Bild von mir gemalt, das musst du doch wohl zugeben. Ja, und wir haben uns gut verstanden, viel gelacht. Ich habe dir nichts verschwiegen. Wenn man stundenlang stillsitzen muss, ist es eine Erleichterung, sich zu rühren, und ja – auch einmal ausgelassen zu sein.«
Henri stöhnte. »Und die Sache mit dem Konfetti? Wie konntest du es zulassen, dass dir so ein Malerbursche einfach Papier ins Haar streut? Auf dem Gemälde sehe ich kein Konfetti in deiner Frisur. Wer weiß, was noch alles passiert wäre, wenn nicht zufällig das Dienstmädchen hereingeplatzt wäre …«
»Ja, und dir alles brühwarm berichtet hätte!« Florence verachtete ihn für seine Eifersucht. Und sie verachtete ihn dafür, dass er die Dienstboten bestach, damit sie ihn über alle Vorgänge in seinem Haus unterrichteten. »Du bist doch selbst krank. Krank vor Eifersucht! Und soll ich dir sagen, woran das liegt? Dafür braucht man keinen Dr. Zumpe, das sagt einem der gesunde Menschenverstand«, sie holte Luft. »Es liegt daran, dass du immer noch in den Fängen deiner Mutter bist. Schau dich doch an! Wie ein Schoßhündchen hängst du an ihr. Nichts kannst du allein entscheiden, immer hat sie das letzte Wort. Nur einmal, ein einziges Mal, hast du nicht das gemacht, was sie dir gesagt. Da hast du mich geheiratet. Und dafür muss ich bis heute büßen.« Sie stieß ihren Stuhl zurück.
»Du bist unmöglich, Florence. Und nur weil Dr. Zumpe mir schon gesagt hat, dass deine Nerven völlig überreizt sind, höre mir diesen hysterischen Unfug an. Meine Mutter hat recht, jemand wie du kann keine gute Hausfrau sein. So unbeherrscht und seinen Launen so ausgeliefert.« Er hielt inne. »Deshalb habe ich vorsorglich die Schlüssel an mich genommen. Die Schlüssel für die Wirtschaftsräume, die Küche und die Speisekammer. In deinem Zustand kannst du den Haushalt nicht führen.«
»Was hast du getan? Die Schlüssel an dich genommen? Hinter meinem Rücken! Oh, Henri, bist du wirklich so ein schäbiger Charakter, oder hat dir das deine Mutter ins Ohr geflüstert?« Florence war außer sich vor Wut. Es war die Aufgabe einer Ehefrau, sich um das Heim, die Kinder und die Führung des Haushaltes zu kümmern. Es war die ureigenste Aufgabe der Frau.
»Reg dich nur nicht so auf. Das ist schlecht für deine Nerven«, sagte Henri in einem beschwichtigenden Tonfall.
»Was soll das heißen? Natürlich rege ich mich auf!« Florence war es gleichgültig, ob die Dienstboten den Streit mitbekamen. Es war nicht das erste Mal. Sollten sie sich doch in der Küche das Maul zerreißen. Sie legte die Serviette beiseite und blickte auf das hochrote Gesicht ihres Ehemannes, der sie gerade entmachtet hatte. Henri lächelte. Tatsächlich, er lächelte. »Ich setze mich ins Raucherzimmer. Später erwarte ich noch Besuch.«
»Wer kommt denn da noch vorbei? Sonst gehst du doch immer in den Club. Etwa deine Mutter?«
»Florence, bitte! Nun benimm dich wenigstens einmal wie eine erwachsene Frau. Das kann ich als dein Ehemann doch wohl erwarten!«
»Und ich kann erwarten, dass du mich auch wie eine erwachsene Frau behandelst. Und mir nicht einfach die Schlüssel stiehlst. Das mache ich nicht mit. Du gibst sie mir sofort zurück!« Florence stand vor Henri und zitterte vor Wut.
»Sieh nur!«, sagte er spöttisch. »Du zitterst. Siehst du es nun ein, dass du ein kaputtes Nervenkostüm hast?«
Florence schwieg feindselig. Henri musste aufstoßen. Sein Magen. Der böhmische Rachenputzer half nicht. Gleich würde er es mit Bullrichs Magensalz versuchen. Oder besser noch: Dr. Zumpe um Rat fragen. Der Arzt wollte schließlich in einer halben Stunde hier sein.
»Erinnerst du dich noch an Frau von Weber? Wie es der armen Frau ergangen ist?« Henris Lächeln hatte etwas Boshaftes.
Natürlich erinnerte sie sich. Das Schicksal von Mathilde von Weber war wochenlang das Gesprächsthema in der feinen Gesellschaft von Dresden gewesen. Auch unter den amerikanischen Bewohnern. Florence dachte mit Schaudern an die arme Frau, die sie vor Jahren einmal während einer Soiree bei den Funckes kennengelernt hatte. Eine brünette Schönheit, sprach perfektes Englisch und war ihrem Mann, dem Enkel des berühmten Komponisten, haushoch überlegen gewesen. Dazu lebenslustig und eigensinnig. Hielt sich gern in Musikerkreisen auf. Hielt sich gern bei Musikern auf. Und hatte wohl bei einer dieser Gelegenheiten ihrem Ehemann Hörner aufgesetzt. So wurde es erzählt. Und dann war sie eines Tages verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Beinahe ein ganzes Jahr. Max von Weber erzählte, dass seine arme Frau krank sei und in einem Sanatorium zur Ruhe finden müsse. Niemand glaubte ihm. Mathilde von Weber war weggesperrt worden. Eine lästige Ehefrau hinter den vergitterten Fenstern einer geschlossenen Nervenheilanstalt. So etwas kam vor. Fast ein Jahr später kehrte Mathilde von Weber zu ihrer Familie zurück. Die vollen braunen Haare hatten graue Strähnen bekommen. Aus der temperamentvollen Frau war eine ruhige, beinahe apathische Erscheinung geworden. Florence erstarrte bei dem Gedanken.
An Schlaf war an diesem Abend nicht zu denken. Florence saß in ihrem Zimmer am Sekretär und schrieb Briefe an ihre beiden Brüder in Amerika. Sie schilderte, was sie in den vergangenen Wochen erlebt hatte und wie groß ihre Angst war, dass sie gegen ihren Willen in eine Irrenanstalt abgeschoben werden sollte. »Bitte lasst mich nicht im Stich«, schrieb sie. »Bitte lasst euch von Henri nichts erzählen. Wenn ich fort sein sollte, unternehmt alles, um mich herauszuholen. Tut es für eure Schwester! Und für ihre Kinder.« Sie läutete nach Adele.
»Adele, diese Briefe müssen Sie gleich morgen früh fortbringen, hören Sie?«
Das Dienstmädchen nickte. »Selbstverständlich, gnädige Frau.«
»Es geht um Leben und Tod.«
Adele riss die Augen auf.
»Mein Mann will mich wegsperren lassen. Er sagt, ich sei krank. Und ich kann nichts dagegen unternehmen! Heute hat er mir sogar die Schlüssel abgenommen. Ich habe nichts und bin ihm ganz und gar ausgeliefert.« Sie begann zu schluchzen. Peinlich berührt sah Adele zur Seite. So hatte sie ihre Herrschaft noch nie erlebt. Dabei verging fast kein Tag, an dem sich das Paar nicht stritt.
»Adele, Sie wissen, meine Eltern sind tot, meine Brüder in Amerika. Ich habe hier keine eigene Familie mehr. Kann ich mich auf Sie verlassen?«
Das Dienstmädchen nickte. »Selbstverständlich! Frau de Meli, ich bin so froh, dass ich bei Ihnen arbeiten darf. Natürlich bin ich behilflich.«
Florence ergriff die Hand der jungen Frau und drückte sie kurz. »Heute Abend wird Dr. Zumpe ein weiteres Mal ins Haus kommen. Er besucht meinen Mann. Bitte tun Sie mir den Gefallen und halten Sie die Ohren offen. Ich muss befürchten, dass sie ein Komplott gegen mich schmieden.«
»Ein Komplott?«
Florence nickte. »Ich habe eine Ahnung, dass mein Mann und Dr. Zumpe vorhaben, mich in eine Irrenanstalt einweisen zu lassen. Sie nennen es Maison de Santé, aber es ist nur eine schöne Umschreibung für ein Haus mit lauter Verrückten drin …« Ihre Stimme klang resigniert. »Ich kann nirgends hin. Henri könnte mich von überall zurückholen lassen. Ich bin nur eine Ehefrau.«
In Adeles Kopf ratterte es. Was sie gerade gehört hatte war schlimmer als das, was sie in den Zeitschriften las.
»Gnädige Frau, was soll ich tun?«
»Adele, es kann sehr gut sein, dass ich fliehen muss. Deshalb werde ich meinen Schmuck zusammensuchen, dazu ein bisschen Bargeld. Viel habe ich nicht. Einen Teil dieser Wertsachen werde ich in meine Kleider einnähen und einen Teil werde ich Ihnen anvertrauen. Sie dürfen mich nicht enttäuschen, hören Sie? Sie sind der einzige Mensch, der mir weiterhelfen kann in dieser Lage!« Florence’ Stimme brach.
Adele nickte. »Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann!«
Und so überlegten die beiden Frauen, an welcher Stelle in der Wohnung die wertvollen Habseligkeiten am besten versteckt werden konnten. Adele erzählte von einem losen Dielenbrett im Dienstboteneingang, das sie beim Putzen unter dem Kokosläufer entdeckt hatte. In ihrem Mädchenzimmer konnte sie die Sachen unmöglich aufbewahren. Sollte jemand die Dinge bei ihr entdecken, wäre sie ihre Anstellung und ihren tadellosen Ruf los. Dann gab Florence Adele noch zwei weitere Briefe in die Hand. Ein Schreiben war an ihre Freundin Clara Jenkins gerichtet. Ein weiteres ging an Minna von Funcke.
Florence seufzte. »Ich werde nun noch einen letzten Brief schreiben. Und ein paar Schmuckstücke in meine Kleider einnähen. Bitte, Adele, bringen Sie mir die Nähsachen!«
Das Dienstmädchen schloss die Tür und blieb noch einen Moment im Flur stehen. In ihrem Kopf sausten die Wörter durcheinander. Irrenanstalt, Komplott, Maison irgendwas. Wertsachen verstecken, Schmuck einnähen. Flucht. Adele stieß die Luft aus und tastete nach dem kleinen silbernen Kreuz an ihrer Halskette. Dann holte sie das Nähkörbchen.