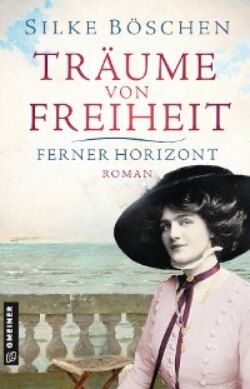Читать книгу Träume von Freiheit - Ferner Horizont - Silke Böschen - Страница 17
11. Zurückgelassen in Dresden
ОглавлениеDresden, 06. Oktober 1881
Die Turmuhr schlug achtmal. Antoinette de Meli wartete den letzten Schlag ab, dann drückte sie die Klingel. »De Meli« stand in verschnörkelten Lettern auf dem Messingschild. Sie atmete schwer. Sie wollte rechtzeitig am Frühstückstisch sitzen, wenn sich die mutterlose Familie versammelte. Das war sie ihren Enkelkindern schuldig. Und ihrem Sohn. Sie drückte ein weiteres Mal auf den Klingelknopf. Alles blieb still. Verärgert trat sie zurück auf den Gehsteig und blickte die Hausfassade hinauf. Im Esszimmer zur Straße hinaus brannte Licht. Die Familie war auf, natürlich, in einer Stunde fing der Unterricht für Henry an. Sein Vater achtete penibel darauf, dass die Schulstunden, die er seinem Sohn erteilte, pünktlich begannen. Antoinette de Meli suchte nach den Schlüsseln für die Räcknitzstraße. Sie hatte sie schon vor Monaten heimlich nachmachen lassen. Schließlich wusste sie, dass die Ehe ihres Sohnes auf einen Abgrund zusteuerte. Jetzt half sie der verwaisten Familie. Die Kinder hatten eine verrückte Mutter nicht verdient. Hoffentlich war dieses Unstete, diese Launenhaftigkeit nicht vererbbar! Antoinette seufzte und schloss die Haustür auf.
Das Dienstmädchen, wie hieß es noch gleich? Manchmal ließ ihr Gedächtnis sie im Stich. Adele! Ja, Adele. Sie sah sie so eigenartig an. Oder bildete sie sich das ein? Kritisch beobachtete Antoinette die junge Frau, die ihr den Mantel abnahm und ihren Besuch anmeldete. Antoinette sah sich um. Eines musste man Florence lassen. Sie hatte Geschmack. Die Wohnung war gut eingerichtet. Die Seidentapete mit dem dunkelgrünen Weinlaub gefiel ihr jedes Mal aufs Neue. Doch dann bildete sich eine kleine Zornesfalte auf ihrer Stirn: Denn bezahlt hatte alles sie selbst. Im Grunde finanzierte sie den gesamten Haushalt dieser Familie. Henris berufliche Ambitionen waren so … so glücklos. Genau wie seine Ehe.
»Mutter, wie schön, dass du schon da bist. Guten Morgen!« Henri stand vor ihr. Er sah übernächtigt aus.
»Henri, mein Junge, wie geht es dir?« Sie blickte ihn durchdringend an, er fühlte sich unwohl. Er brauchte abends ein paar Gläser Wein oder Bier, um überhaupt zur Ruhe zu kommen. Das musste sie doch verstehen. Wenn die eigene Frau in die Irrenanstalt eingewiesen wurde und man als Ehemann hilflos danebenstand und nichts tun konnte. Henri gab seiner Mutter einen angedeuteten Handkuss. Antoinette bemerkte den starken Menthol-Duft, der sich wie eine Wolke um ihn gelegt hatte.
»Wo sind denn meine Enkelkinder? Was hast du ihnen gesagt? Wo ist ihre Mutter?«
»Das, was wir abgesprochen hatten. Dass sie ganz plötzlich zu einer kranken Tante nach Paris musste und keine Zeit hatte, sich von ihnen zu verabschieden.«
Antoinette nickte erleichtert. Diese Version gefiel ihr. Das Wort »Anstalt« wollte sie in Gegenwart der unschuldigen Kinder nicht hören.
Sie öffnete die Tür zum Esszimmer. Minnie blickte von ihrem Teller auf. »Mommy?« Sie erkannte ihre Großmutter und rutschte vom Stuhl. »Oh, Granny, du kommst zum Frühstück, wie schön! Mommy ist verreist und hat sich gar nicht verabschiedet.« Ihr kleiner Mund verzog sich.
Antoinette drückte das Mädchen an sich. »Eure Mutter war sehr in Eile. Bestimmt schreibt sie euch bald. Und bestimmt bringt sie etwas Schönes mit aus Paris!« Sie strich Minnie über das lockige Haar, das von einem breiten Samtband aus dem Gesicht gehalten wurde. »Oh, guten Morgen, Henry. Dir scheint es zu schmecken …« Antoinette sah die vielen Brotkrümel um seinen Teller herum.
Der Junge wurde rot. Adele brachte ein weiteres Gedeck. Henri strich seine Serviette glatt und zupfte an seinem Revers.
»Sag einmal, lässt du deine Sachen eigentlich bei einem deutschen Schneider anfertigen? Oder bist du immer noch bei diesem Engländer? Wie hieß er noch gleich?« Was war nur los? Heute Morgen entfielen ihr alle Wörter. Wurde sie alt? Sie war doch erst 64. Antoinette schüttelte den Kopf, sodass ihre Granatohrringe sanft hin und her schwangen.
Minnie betrachtete die Bewegung andächtig. »Granny, Mommy hat auch so schöne Ohrringe wie du. So rote.«
Antoinette legte eine Hand auf die des Mädchens. »Ja, mein Engel, und wenn du groß bist, wirst du auch so schöne Ohrringe tragen.« Wie sehr sie die Kleine liebte!
»Ich lasse eigentlich alles bei Schneidermeister Richter anfertigen. Er ist Hoflieferant. Die deutschen Schneider denken mit. Schneidern alles so, dass man es gleich auslassen kann. Falls es ein wenig zwickt. Das kommt bei mir hin und wieder vor.« Henri lachte verlegen. Sein Bart hob und senkte sich auf dem Brustkorb.
Antoinette lächelte dünn. Alle Männer trugen Bart. Aber das, was sich ihr Sohn stehen ließ, war doch des Guten zu viel. Manchmal hatte sie den Eindruck, dass er von seiner zunehmenden Kahlheit mit diesem struppigen Monstrum ablenken wollte. Kein Wunder, dass die Kinder manchmal Angst vor ihrem eigenen Vater bekamen. Ihren Augen entging nichts. »So ein Bart kann auch unpraktisch sein.« Ihre linke Augenbraue zog sich in die Höhe und bildete ein beeindruckendes Halbrund auf der Stirn. Sie merkte gar nicht, wie oft dieser Bogen aufzog – als Zeichen der Missbilligung, Herablassung, ja Verachtung. Henri sah den Ausdruck in ihrem Gesicht und strich sich ein paarmal über den Bart. Der Augenbrauenbogen beruhigte sich. Die Stirn seiner Mutter wurde wieder glatt. »Heute Nachmittag werde ich mit euch in den Zoo gehen«, sagte sie zu ihren Enkeln und nippte an ihrem Kaffee. Minnie jubelte. Auch ihr Bruder freute sich, doch es lag etwas Verhaltenes in seinem Blick.
Nur ein paar Straßenecken weiter, in der Walpurgisstraße 1, saß Clara Jenkins mit müden Augen vor ihrem Mann. Sie hatte kaum schlafen können in der vergangenen Nacht. Dieser Brief hatte sie aufgewühlt. Dieser Brief von Florence. Die Arme! Clara Jenkins las die Verzweiflung in den flüchtigen Zeilen, die Angst und die Ohnmacht einer Frau, die mit dem Schlimmsten rechnete. »Newell, du musst herausfinden, was bei den de Melis los ist! Ob Florence noch zu Hause ist oder ob es stimmt, was sie mir geschrieben hat. Dass Henri sie in eine Irrenanstalt abschieben will.« Das Wort »Irrenanstalt« sprach sie mit einem Kiekser aus, so als wollte es gar nicht aus ihrem Mund. Sie stieß es förmlich heraus. Newell Jenkins ließ die Ausgabe der Dresdner Nachrichten sinken. Selten hatte er seine Ehefrau in einer solchen Verfassung erlebt. Clara hatte eigentlich ein ruhiges Wesen, war ein besonnener Mensch.
»Nun beruhige dich doch, Clara. Bestimmt hat sich Florence irgendeine dumme Bemerkung zu sehr zu Herzen genommen. Du weißt doch selbst, dass die Ehe der beiden nicht besonders glücklich ist. Und ja, Henri ist ein schwieriger Mensch.« Er bemerkte die dunklen Ringe unter ihren Augen. So mitfühlend. So ein großes Herz! Seine Clara. Er räusperte sich: »Ich werde auf dem Weg in die Praxis kurz bei Henri vorbeischauen. Ich könnte etwas von Angelegenheiten aus dem Club erwähnen. Und dann erkundige ich mich nach Florence.«
Clara überlegte: »Aber was ist, wenn er nicht die Wahrheit sagt? Wie willst du es überprüfen?«
»Clara, ich bitte dich! Henri mag zwar viel trinken und auch sein Temperament nicht immer im Griff haben. Aber als Lügner ist er mir bislang noch nicht aufgefallen.«
Clara Jenkins schüttelte den Kopf. »Ich rechne mit dem Schlimmsten. Und wenn es wirklich wahr ist, dann müssen wir etwas unternehmen. Florry ist nicht geisteskrank.«
Newell Jenkins seufzte. Was sollte er darauf erwidern? Florence de Meli war ab und zu ein Opfer ihrer eigenen Launen, aber eine Irre war sie mit Sicherheit nicht. Doch was ging ihn das vermurkste Eheleben anderer Leute an? Im Zweifel waren sie alle seine Patienten. Er wollte gar nicht von jedem wissen, wie es um sein häusliches Leben stand. Hauptsache, sie kamen zu ihm – mit ihren pochenden Wangen, den abgebrochenen Backenzähnen und den mühsam verborgenen Lücken in ihren Zahnreihen. Davon lebte er seit 15 Jahren in Dresden. Und zwar sehr gut. Sollten sie ihn doch mit ihren Privatangelegenheiten in Ruhe lassen. Leicht verstimmt faltete er die Zeitung zusammen und erhob sich. »Clara, ich habe heute Mittag einen Termin bei Hof. Die Königin klagt über Schmerzen. Das heißt, ich komme nicht zum Mittagessen nach Hause.«
»Ja, ich verstehe. Dann also bis heute Abend!« Sie lächelte. Ihre Lider flatterten. Sie war nicht bei der Sache. Denn Clara Jenkins plante schon ihren Tag – das gemeinsame Mittagessen hätte nur gestört. Gleich würde sie sich auf den Weg zu den Funckes machen. Bestimmt wusste Minna mehr als sie. Clara küsste ihren Mann auf die Wange und steckte den Brief von Florence zurück in den Umschlag.
Newell Jenkins hielt sein Versprechen – in der Räcknitzstraße läutete er bei den de Melis. Doch niemand öffnete. Nach einer Weile kam Adele zur Tür und sagte, dass die Herrschaften nicht da seien. Wie seltsam, dachte Jenkins. Henri war doch meistens zu Haus, ebenso Florence. Er hinterließ seine Karte und beeilte sich, in die Praxis zu kommen. Sein Tag war vollgestopft mit Terminen, dazu die Visite im Schloss. Und so lösten sich seine Gedanken an das Schicksal von Florence de Meli zwischen Keramikkronen und Goldfüllungen auf wie ein Hauch von Lachgas. Zurück blieb eine leichte Beklommenheit. Dabei war Newell Jenkins durchaus ein mitfühlender Mann, aber eben auch einer der besten Zahnärzte im Deutschen Kaiserreich. Für diesen Ruf arbeitete er hart, da blieb nicht viel Zeit für Sentimentalitäten.
Nur zwei Stunden später nahm Clara Jenkins Platz im Damensalon des Stadtkommandanten von Dresden. Oscar von Funcke war erst vor Kurzem zum wichtigsten Militär in der Residenzstadt befördert worden. Er wurde jetzt mit »Excellenz« angesprochen. Seine amerikanische Frau Minna gehörte damit endgültig zur gesellschaftlichen Spitze im Königreich. Zum Glück machte sich Minna nicht ganz so viel aus Titeln wie ihr Ehemann, der es dank seiner militärischen Karriere vom einfachen »Funke« in den Adelsstand geschafft hatte.
Mit ihren drei Kindern lebten sie in der Großen Klostergasse 11, in der Neustadt auf der anderen Seite der Elbe und ein ganzes Stück entfernt von der Seevorstadt, wo sich das Gros der Amerikanischen Kolonie niedergelassen hatte. Clara Jenkins war deshalb nicht ganz so oft bei Minna, obwohl sie sie sehr mochte. Doch das Schicksal ihrer gemeinsamen Freundin Florence verlangte heute ihren Einsatz. Viel Zeit blieb ihr nicht. Die drei Kinder, der Haushalt, am Nachmittag ein Teekränzchen – zum Glück konnte sie sich auf die Gouvernante und ihre Dienstboten verlassen.
Clara hatte Glück, Minna war tatsächlich zu Hause und begrüßte sie herzlich. »Das ist ja eine Überraschung, meine liebe Clara! So ein seltener Besuch.« Minna war das Gegenteil ihres Mannes und selten förmlich. Sie drückte Clara Jenkins so überschwänglich an sich, dass Clara Angst um ihren Hut bekam.
»Oh, Minna, ich konnte nicht länger warten. Es ist dringend.«
Minna von Funcke hielt inne. »Es ist wegen Florence, richtig?«
Clara nickte.
Minnas Gesicht wurde ernst. »Ich habe heute Morgen einen Brief von ihr erhalten. Er kam mit der Post.«
»Ich habe die Nachricht schon gestern erfahren. Wahrscheinlich hat das Dienstmädchen von Florry den Umschlag direkt bei uns abgegeben. Wir wohnen ja fast um die Ecke. Aber sag, Minna, ist das nicht entsetzlich, was sie schreibt?«
Minna biss sich auf die Unterlippe. »Glaubst du denn, dass sie recht hat?«
»Du etwa nicht?« Clara Jenkins riss erstaunt die Augen auf.
»Doch, im Grunde schon. Nur du weißt, wie oft sie Ärger mit Henri hat … Und Florry hat viel Fantasie.«
»Minna, hier, lies die Zeilen, schau dir die Schrift an! Das ist kein Fantasiegebilde. Das ist echt.« Clara schluckte. »Wahrscheinlich liegt sie gerade gefesselt zwischen lauter Verrückten. Vielleicht ist es dunkel, und wer weiß, was die anderen alles auf dem Kerbholz haben, wenn sie geisteskrank sind.« Tränen schimmerten in ihren Augen. »Oh, unsere arme Florry. So fröhlich, so lustig. Und jetzt am Ende. Was schreibt sie dir?«
»Beruhige dich, Clara, sie schreibt nur, dass sie glaubt, von Henri und seiner Mutter abgeschoben zu werden. In so eine Anstalt. In dem Brief steht, dass sie fliehen will.«
Clara Jenkins war bleich geworden. Minna von Funcke läutete nach einem Dienstmädchen und bestellte zwei Gläser Sherry. »Zur Beruhigung. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, sonst können wir ihr nicht helfen. Wo auch immer sie steckt. Warst du bei ihr?«
Clara Jenkins trank das Glas in einem Zug leer und schüttelte sich kurz. »Nein, Newell wollte gehen. Aber ich werde auf der Rückfahrt einen kurzen Halt einlegen. Vielleicht hast du recht, und es ist gar nichts passiert. Aber ich habe so ein ungutes Gefühl.«
Beide Frauen tauschten die Briefe aus und lasen sie. »Vielleicht ist sie tatsächlich getürmt. Oh, das wäre gefährlich. Aber auch aufregend!« Clara schloss die Augen. Was für ein Abenteuer! Doch Florence war Mutter. Eine Mutter ließ ihre Kinder nicht im Stich. Selbst wenn sie mit einem solchen Tyrannen wie Henri de Meli zusammenlebte.
Minna von Funcke stand auf und sah aus dem Fenster auf die Straße. »Deine Droschke steht noch da. Fahr gleich zu Florence. Und ich werde es so einrichten, dass ich heute Abend oder spätestens morgen früh bei dir bin, sodass wir weitere Schritte besprechen können.«
Clara nickte.
»Außerdem werde ich Oskar vorsichtig fragen, ohne dass er gleich Wind von der Sache bekommt, welche Möglichkeiten es gibt, um jemanden aus einer solchen Anstalt zu befreien.«
Clara war erleichtert. Dies waren handfeste Vorschläge. Langsam beruhigten sich ihre Nerven wieder. Der Sherry wirkte. Ebenso wie die Besonnenheit ihrer Freundin Minna.