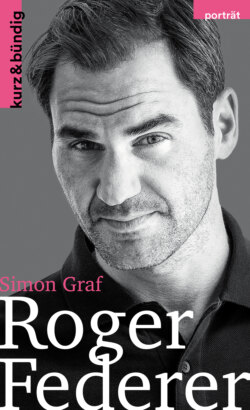Читать книгу Roger Federer - Simon Graf - Страница 4
Оглавление1. Der König aus dem Volk
Es ist ein wunderschöner Tag im Paradies. Die Sonne strahlt, ein leichtes Lüftchen weht durch die Berglandschaft von Gstaad und macht die Sommerhitze erträglich. Es ist der 25. Juli 2013, und im Nobelort freut man sich auf den Auftritt von Roger Federer. Neun Jahre ist der Weltstar nicht mehr hier gewesen. Doch auf seiner verzweifelten Suche nach Spielpraxis macht er wieder einmal Station im Berner Oberland. Die Freude ist so groß, dass man ihm wieder eine Kuh geschenkt hat – wie 2003 nach seinem ersten Wimbledon-Sieg. Doch als ich zufällig sehe, wie sich Federer ein paar Stunden vor seinem Einsatz auf den Sandplätzen des Grand Hotel Palace einspielt, schwant mir Böses. Nichts ist zu sehen von der legendären
Federer’schen Eleganz und Leichtigkeit, er wirkt steif wie ein Roboter. Sein Rücken macht ihm also immer noch zu schaffen. Ob es eine gute Idee ist, zum Spiel gegen den Deutschen Daniel Brands anzutreten? Nein, ist es nicht, wie sich einige Stunden später herausstellt. Federer spielt wie eine schlechte Kopie seiner selbst, wirkt gehemmt und bald resigniert. Nach 65 Minuten und einem 3:6, 4:6 verlässt er gesenkten Hauptes den Court.
Es sind quälende Monate für Federer. In Wimbledon ist er als Titelverteidiger in Runde 2 am ukrainischen Nobody Sergej Stachowski gescheitert, immer wieder haben sich im Laufe des Jahres 2013 seine chronischen Rückenbeschwerden gemeldet. Nach seinem blamablen Auftritt vor dem erwartungsfrohen Heimpublikum in Gstaad hat er bestimmt keine Lust, seine Innenwelt nach außen zu tragen. Doch natürlich erscheint er zur obligaten Medienkonferenz und stellt sich den quälenden Fragen – und davon gibt es einige. Niemand würde ihm übelnehmen, wenn er sich kurz fassen würde, doch er gibt eine halbe Stunde lang Auskunft. Obschon er selbst nicht genau weiß, wie es um ihn und seinen Rücken steht. Und dann nimmt er sich auch noch Zeit für einen Schwatz mit dem Sohn des früheren Schweizer Profis Claudio Mezzadri und anderen, die ihn erstmals treffen wollen. Seine Frustration, dass sein Körper nicht mehr mitspielt, schluckt er hinunter – er versetzt sich in jene hinein, die sich so sehr auf ihn gefreut haben. Auf dem Court hat er sie enttäuscht, daneben nimmt er sich umso mehr Zeit. Dabei hätte er sich wohl am liebsten davongemacht und um sich selber gekümmert anstatt um die anderen. Es ist eine kleine Geschichte am Rande, die viel über ihn aussagt.
Ich hätte auch mit der Beschreibung großartiger Siege Federers in dieses Porträt einsteigen können. Doch es ist einfach, im Erfolg zu glänzen. Der wahre Charakter offenbart sich erst in den schwierigen Momenten. Wie an jenem Tag im Berner Oberland, an einem Tiefpunkt seiner Karriere. Oft hat Federer die zwei Zeilen aus dem Gedicht «If» des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling gelesen, die über dem Eingang zum Centre Court Wimbledons prangen. Er hat sie verinnerlicht:
«Wenn du mit Triumph und Niederlage umgehen
Und diese beiden Blender gleich behandeln kannst»
Das Gedicht schließt mit den Worten:
«Dann ist die Erde dein, und alles, was auf ihr ist
Und, was noch wichtiger ist: Du wirst ein Mann sein,
mein Sohn!»
Kipling richtete das 1910 veröffentlichte Gedicht an seinen Sohn John, der einige Jahre später in den Ersten Weltkrieg ziehen (und da sterben) sollte. Es zählt noch heute zu den populärsten in Großbritannien. Federer verkörpert die Geisteshaltung, die in den Zeilen Kiplings beschworen wird. Zumindest in den beiden oben zitierten. Von all seinen Siegen und Titeln und seinem Leben als Rockstar, dem überall und jederzeit zugejubelt wird, hat er sich den Kopf nicht verdrehen lassen. Und er lässt sich auch nicht entmutigen von Niederlagen und Rückschlägen.
Federer hat viel von zu Hause mitbekommen, nicht nur sportlich. Doch der Baselbieter ist auch gewachsen an den Herausforderungen seines Lebens im Scheinwerferlicht, an seiner Rolle als Schlüsselfigur im globalen Profizirkus. Er realisiert schon früh, dass er als bewunderter Sportler nicht mehr nur sich selber gehört, sondern auch eine Verantwortung anderen gegenüber hat. Und er nimmt sie wahr, ohne sich untreu zu werden. Ob er möchte oder nicht, Federer prägt das Leben vieler anderer Menschen mit. Die Verehrung für ihn nimmt zuweilen fast religiöse Züge an. Seine treuesten Fans investieren all ihre Urlaubstage und fliegen um den Globus, um ihn zu sehen, sie basteln in stundenlanger Arbeit Federer-Devotionalien, schöpfen aus seinen Auftritten Inspiration für ihr eigenes Leben. Legendär ist die Tradition des roten Kuverts, die
zurückreicht bis 2003, als er erstmals Wimbledon gewann. Der harte Kern von Federer-Anhängern überreicht ihm seitdem vor jedem Grand Slam und vor vielen weiteren Turnieren einen Umschlag mit Zettelchen, auf denen die Fans ihre Glückwünsche formuliert haben. Unter seinen Anhängern ist es ein Privileg, zum Kurier ausgewählt zu werden und ihn vor dem Turnier beim Training abzupassen, um ihm die hundert oder mehr Botschaften zu überreichen.
Wer den Puls der Tenniswelt spüren möchte, sollte sich einmal während der «All England Championships» im Juli mit dem Zelt in den Wimbledon Park begeben, um da zu übernachten und sich Tickets zu sichern. Und dann mit den Zeltnachbarn über Federer plaudern, um die Wartezeit zu überbrücken. Schnell merkt man: Nicht jeder, der eine Schweizer Flagge am Zelt befestigt hat, ein T-Shirt mit Schweizerkreuz oder eine
Baseballkappe mit dem «RF»-Logo trägt, ist Schweizer. Die Federer-Aficionados kommen aus Kalkutta, Shanghai, Melbourne, Dubai, Tennessee, natürlich auch aus Basel und London, aus allen Ecken dieser Welt. Jeder kann erzählen, wann es bei ihm «Klick» gemacht hat. Es gibt wohl keinen Sportler, der bei seinen Anhängern ein solch ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis entfacht wie er. Über den so viele Bücher geschrieben wurden, in denen die Autoren darüber sinnieren, was der Tennisvirtuose bei ihnen ausgelöst hat.
Und gilt Sport in der Kulturszene sonst eher als uncool, zieht Federer auch da viele in seinen Bann. Die deutsche Stargeigerin Anne-Sophie Mutter etwa sagte 2017 im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»: «Ich kann gar nicht verstehen, wie man Fan von einem anderen lebenden Tennisspieler sein kann, wenn man Federer gesehen hat. Man muss doch dieser Ästhetik, dieser Eleganz, dieser ganz wunderbaren poetischen Spielweise einfach verfallen.» Sie erzählte, sie habe 2014 ihre Konzerte in Australien so gelegt, damit sie Federer im Endspiel der Australian Open in Melbourne hätte zuschauen können. Dummerweise scheiterte er im Halbfinale an Nadal.
So global der Appeal des fünffachen Weltsportlers ist, er trägt ausgeprägte Schweizer Züge. Bei Studien über Swissness stoße man immer wieder auf Attribute, die Federer charakterisieren würden, sagt Torsten Tomczak, Marketingprofessor an der renommierten Universität St. Gallen. Federer steht für Werte der modernen, aber auch der traditionellen Schweiz: Er ist weltoffen, aber geerdet, fleißig, kreativ, zielstrebig, familienorientiert, freundlich, aber hart in der Sache, zuverlässig und angemessen bescheiden geblieben. Er kultiviert nicht gerade das Understatement wie sein Rivale Rafael Nadal, überschreitet aber auch nie die Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Überheblichkeit. Und wie die Schweiz ist er neutral. Federer ist der perfekte Diplomat, exponiert sich in der Öffentlichkeit nie in heiklen Fragen. Das ist in einer Zeit, in der die Journalisten mehr denn je auf der Suche nach der reißerischen Schlagzeile sind und diese über die sozialen Medien tausendfach verbreitet wird, eine kluge Strategie.
Wahrscheinlich gibt es keinen Sportler, der so oft interviewt worden ist wie Federer. Allein nach seinen Matches hatte er schon über 1500 Pressekonferenzen zu absolvieren. Wer so oft im Fokus steht, kann sich nicht verstellen. Zumindest nicht dauerhaft. Dass er als Person kohärent ist, unterstrich eine Umfrage des amerikanischen «Reputation Institute» aus dem Jahr 2011. Dabei wurden 54 weltweit bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport von über 50 000 Befragten danach bewertet, wie beliebt, respektiert und glaubwürdig sie seien. Der Schweizer landete auf Rang 2, nur hinter dem inzwischen verstorbenen Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, aber vor Persönlichkeiten wie dem Dalai Lama, Barack Obama oder Bill Gates. Seit November 2017 darf sich Federer auch Ehrendoktor nennen, die Medizinische Fakultät der Universität Basel verlieh ihm diesen Titel. Dafür, dass er weltweit den guten Ruf von Basel und der Schweiz fördere, mit seinem Auftreten als Sportler ein Vorbild sei und sich mit seiner Stiftung für Kinder im südlichen Afrika einsetze.
Zum Verblüffendsten zählt, dass ihn seine Konkurrenten so schätzen, obschon er sie fast immer schlägt. Von 2004 bis 2017 erhielt er dreizehn Mal den Stefan-Edberg-Award als fairster und integerster Spieler – gewählt von den Berufskollegen. Nur 2010 konnte ihm Nadal diese Auszeichnung abjagen. Der alljährliche Award ist auch als Dank der anderen Tenniscracks an Federer zu verstehen – dafür, dass er das Klima auf der Profitour nachhaltig verändert hat. Pflegten sich frühere Nummern 1 wie Pete Sampras oder Andre Agassi rar zu machen und die Konkurrenzsituation anzustacheln, mischt sich Federer stets unter die anderen – egal, wie alt oder jung, wie gut oder schlecht sie sind. Was auch auf seine Schweizer Prägung zurückzuführen sein dürfte. Obschon er immer wieder als (Tennis-)König bezeichnet wird, ist er einer aus dem Volk – in der Garderobe oder in der Player’s Lounge bleibt er einer der Jungs, ohne Berührungsängste und immer zu haben für einen Spaß. Mit seiner unkomplizierten Art hat er die Atmosphäre auf der Männertour entkrampft. «Ich fand immer, es sei das Beste, nett zu sein zu den neuen Generationen von Spielern, statt ihnen das Gefühl zu geben, hier sei es für sie die Hölle», sagte Federer einmal. «Ich denke, das färbte auf Nadal und die anderen Spieler ab. Natürlich ist Tennis ein harter Sport, aber es ist immer noch ein Sport. Es gibt viele Dinge, die wichtiger sind im Leben.»
Sein netter, menschlicher Umgang heißt aber nicht, dass er es allen recht machen will. Stets hat er konsequent seinen Weg verfolgt und harte Entscheidungen getroffen, wenn er sie für nötig hielt. Wie die Trennung von mehreren Coaches, den Verzicht auf Davis-Cup-Einsätze oder die komplette Sandsaison. Und auf dem Platz kennt er ohnehin kein Mitgefühl. Einer, der sportlich am meisten unter ihm gelitten hat, ist Andy Roddick. Achtmal trafen sie bei Grand Slams aufeinander, achtmal siegte Federer – viermal davon im Finale. Nach dem Wimbledon-Endspiel 2005 brachte es Roddick auf den Punkt, als er in Richtung Federer sagte: «Ich würde dich liebend gerne hassen. Aber du bist einfach zu nett.»