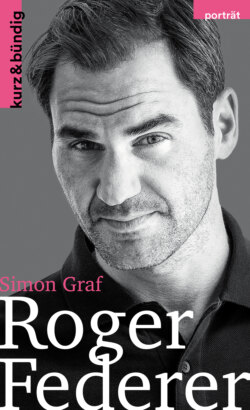Читать книгу Roger Federer - Simon Graf - Страница 6
Оглавление3. Die Geburt eines Champions
Dunkle Wolken hängen an diesem Montag, dem 30. Juni 2003, über dem «All England Lawn Tennis and Croquet Club». Sie stehen symbolhaft für das Ungemach, das Roger Federer im Achtelfinale von Wimbledon gegen Feliciano López droht. Der Baselbieter, der im Südwesten Londons endlich das Versprechen einlösen will, das er mit seinem immensen Talent und seinem Coup gegen Pete Sampras von 2001 abgegeben hat, schießt beim Einspielen ein stechender Schmerz in den Rücken. Wer schon einmal einen Tennisschläger geschwungen hat, weiß, es gibt in diesem Sport, in dem man sich ständig dreht und streckt, nichts Unangenehmeres als einen blockierten Rücken. Wenn es doch wieder zu regnen begänne, denkt sich Federer. Dann könnte er zurück in die Garderobe, sich pflegen lassen, eine Schmerztablette einwerfen und warten, bis sie wirkt. Doch nicht einmal aufs britische Wetter ist Verlass an diesem grauen Tag. Es bleibt trocken.
Das sportliche Drama spielt sich auf Court 2 ab, auch bekannt als «Friedhof der Champions». Schon manch großer Spieler hat die kleine, intime Arena mit feuchten Augen verlassen. Im Jahr zuvor endete hier die Wimbledon-Karriere von Sampras. Gegen George Bastl, den Collegespieler aus dem Schweizer Kurort Villars-sur-Ollon, der in der Qualifikation gescheitert, aber dank einer Absage ins Turnierfeld gerutscht war – um dort den siebenfachen Champion zu schlagen. Diesen Abgang an der Stätte seiner größten Erfolge hätte Sampras niemand gewünscht. In den Spielpausen las er auf seinem Stuhl immer wieder in einem Brief seiner Frau Bridgette, die aufbauende Worte an ihn gerichtet hatte. Es nützte nichts. Und nun scheint der «Friedhof» also sein nächstes prominentes Opfer zu fordern.
So viele würden dem jungen Schweizer mit dem eleganten Spiel und dem Pferdeschwanz den Durchbruch auf der großen Tennisbühne gönnen. Der Sport dürstet nach dem Ende der Ära von Pete Sampras und Andre Agassi nach neuen Stars. Nicht umsonst hat die Männertour eine Kampagne lanciert mit dem Titel: «New Balls Please!» Federer schaut vom Plakat mit finster entschlossener Miene auf einen herab – neben anderen aufstrebenden Spielern wie Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Marat Safin oder Juan Carlos Ferrero. Doch bei den Grand Slams scheint es der Tennisvirtuose einfach nicht auf die Reihe zu kriegen. Bei drei seiner letzten fünf Starts ist er in Runde 1 gescheitert. Ein paar Wochen zuvor in Paris am Peruaner Luis Horna, der Nummer 88 der Weltrangliste. Wie gelähmt wirkte Federer da. Die französische Sportzeitung «L ’Equipe» schrieb: «Man wäre am liebsten auf den Platz hinuntergegangen und hätte den Mann aus seiner Traumwelt geschüttelt.»
Ob er in diesen bangen Momenten auf Court 2 in Wimbledon an jene Enttäuschung denkt? Als er gegen López nach zwei Games den Physiotherapeuten herbeirufen und sich auf dem Rasen behandeln lässt, geht ein Raunen durch die Ränge. Spielt er weiter oder nicht? Während der fünfminütigen Pause denkt der 21-Jährige ans Aufgeben. Doch dann besinnt er sich eines Besseren. Ihm hilft, dass sein Gegner, der mit seiner kräftigen Statur und den langen Haaren aussieht wie ein römischer Gladiator, mit deutlich weniger Spielintelligenz gesegnet ist als er. Der spanische Linkshänder kann von Federers Einschränkung nicht ausreichend profitieren, spielt zu überhastet, statt seinen angeschlagenen Widersacher in längere Ballwechsel zu verwickeln. Und obschon Federer beim Aufschlag sein Tempo um rund zehn Stundenkilometer drosseln muss, um den Rücken zu schonen, gerät er bei seinem Service kaum in Bedrängnis. Er gewinnt zwar nur drei Punkte mehr, kommt aber in drei knappen Sätzen weiter. Sein schwedischer Coach Peter Lundgren atmet tief durch. Erst sechs Tage später, als strahlender Wimbledon-Sieger, erzählt Federer, wie er sich wirklich fühlte gegen López: «Ich hatte große Schmerzen, konnte kaum mehr aufschlagen oder retournieren. Es tat so weh, dass ich auch nicht mehr absitzen konnte. Als ich den Physio herbeirief, gab er mir Schmerzmittel und rieb mir eine wärmende Salbe ein. Ich sagte mir: Wenn es noch ein paar Games so weitergeht und er [López] mir den Hintern versohlt, hat es keinen Sinn mehr zu spielen. Doch irgendwie blieb ich im Match, und es wurde ein bisschen besser.»
Sein Sieg ist an diesem turbulenten Achtelfinaltag an der Church Road nicht viel mehr als eine Randnotiz. Doch für ihn ist er ein großer Schritt. Das britische Wetter meldet sich am Mittwoch zurück und erzwingt die Verlegung seines Viertelfinales auf Donnerstag, was nicht nur Federers Rücken, sondern auch seinen Gegner freut. Denn Sjeng Schalken musste sich einen Bluterguss am linken Fuß operativ entfernen lassen und kann kaum gehen. Auch zwei Tage Pause und eine schmerzstillende Spritze reichen dem Holländer nicht: Er ist gegen Federer immer noch eingeschränkt und chancenlos. So trennen diesen plötzlich nur noch zwei Siege von seinem ersten Triumph bei einem Grand Slam. Jahre später gesteht Federer, dass ihn bei den vier großen Turnierstationen in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York lange die Aussicht gehemmt habe, für diese prestigeträchtigen Titel sieben Matches auf drei Gewinnsätze für sich entscheiden zu müssen. Er habe immer diesen Mount Everest vor sich gesehen, den er erklimmen müsse, dabei sei ihm schwindlig geworden.
Doch nun ist der Gipfel plötzlich nah. Federers Rückenschmerzen sind wie weggeblasen, ebenso seine Zweifel. Vor dem Halbfinale gegen Andy Roddick macht er sich keine Sorgen über den Aufschlag des Amerikaners, der die Bälle regelmäßig mit über 200 Stundenkilometern ins Feld donnert. «Er wird schon nicht 200 Asse schlagen», sagt er. Im Duell der Jungstars erwischt er einen Sahnetag. Roddick staunt über seinen Gegner, dem einfach alles gelingt, hadert mit seinem Schicksal, beginnt an sich zu zweifeln – und flüchtet sich zuletzt in Galgenhumor. Federer setzt seine Volleys zentimetergenau ins Eck, ist gedanklich immer einen Zug voraus und erahnt bei Roddicks Aufschlägen meist die richtige Ecke. Die
vernichtendste Statistik für den ein Jahr jüngeren Herausforderer aus Omaha, Nebraska: Federer schlägt in drei Sätzen siebzehn Asse, er gerade mal vier. Auch Ballwechsel, in denen er richtig gut gespielt habe, habe er verloren, sagt Roddick kopfschüttelnd.
Coach Peter Lundgren, der Federers Auftritte im «All England Club» bisher eher kritisch beurteilt hat, spricht nun in den höchsten Tönen über seinen Schützling. So gut habe er ihn noch nie spielen gesehen, sagt der Schwede. Boris Becker schwärmt als Kommentator auf BBC: «Alle Kinder, die Tennis lernen wollen, müssen Federer zuschauen. Er schreibt das Lehrbuch neu. Wir haben die Geburtsstunde einer neuen Ära erlebt.» Noch nicht ganz, schließlich steht noch ein Spiel an: das Finale gegen Mark Philippoussis. Der 26-jährige Australier hat nach drei Knieoperationen – zweieinhalb Monate war er sogar auf einen Rollstuhl angewiesen – ein eindrückliches Comeback geschafft. In Wimbledon hat der 1,93-Meter-Hüne mit seiner Wucht (Spitzname «Scud», wie die Raketen) unter anderen die Nummer 1 Andre Agassi geschlagen. Doch Federer tritt nach seinem glänzenden Auftritt gegen Roddick als
Favorit zum großen Spiel an.
Der 6. Juli 2003 wird ein Tag für die Schweizer Sportgeschichte. Der «Harry Potter des Tennis» («Times») schwingt seinen Zauberstab, der ganze Spuk dauert weniger als zwei Stunden. Als es geschafft ist, das 7:6, 6:2, 7:6 feststeht, sinkt Federer auf die Knie und schaut hoch in seine Box zu Freundin Mirka Vavrinec und Coach Lundgren. Hat er während des Spiels Nerven und Gegner stets im Griff gehabt, überwältigen ihn nun die Emotionen. Als er auf seinem Stuhl auf die Pokalübergabe wartet und langsam realisiert, was er geschafft hat, weint er ein erstes Mal. Die goldene Trophäe in den Händen, die er behutsam hält wie ein Neugeborenes, kämpft er sich tapfer durchs Siegerinterview. Seine Worte und Gedanken schweifen wild umher, er schwankt zwischen Übermut und Rührung. Als er im Überschwang sagt, er schaue sich selber auch gerne zu, muss er über sich schmunzeln. Schließlich bricht er wieder in Tränen aus, und mit ihm viele im Stadion und vor den Fernsehbildschirmen.
Der große Durchbruch: Roger Federer küsst nach dem Wimbledon-Sieg 2003 behutsam den glitzernden Pokal.
«It’s Roger Blubberer», titelt die Londoner Boulevardzeitung «Daily Mirror» tags darauf unbarmherzig – Roger, der Flenner. Der «Daily Record» aus Glasgow spöttelt: «Die Platzhelfer waren sich im Moment des Tränenmeeres unschlüssig, ob sie die Regenplane über den heiligen Rasen ziehen sollten.» Die seriöseren Zeitungen setzen nach dem Triumph des Schweizers zu kunstvollen Elogen an. So schreibt der erfahrene Tennisjournalist John Parsons im «Daily Telegraph»: «Nimm das eiskalte Wimbledon-Temperament von Björn Borg, addiere das elegante Flugballspiel von Stefan Edberg, mische es mit der Autorität des Aufschlags von Pete Sampras und den Returnqualitäten von Andre Agassi, und du hast eine Ahnung vom neuen Wimbledon-Champion Roger Federer. Er könnte ein Gigant unter Champions werden.» Die Pariser Sportzeitung «L ’Equipe», die sich Wochen zuvor noch über ihn ausgelassen hatte, schwärmt: «Mit einem außergewöhnlichen Talent gesegnet sowie einer Persönlichkeit von einer Einfachheit, die erfrischt, ist er der ideale Botschafter des schönen Spiels. In diesen turbulenten Zeiten ist der Erfolg dieses Artisten und vorbildlichen Jungen die schönste Neuigkeit für das Männertennis. Sampras kann in Ruhe zurücktreten, sein Erbe ist in
guten Händen.» Es sind prophetische Zeilen.
Nach dem Champion’s Dinner im noblen Fünfsternehotel Savoy und einer kurzen Nacht empfängt Federer die Journalisten Montagfrüh im Garten seines Mietshauses zum Interview. An der Lake Road 10, drei Autominuten entfernt vom «All England Club». Er posiert, die Zeitungen mit den Schlagzeilen über ihn auf einem Tisch ausgelegt, und wirkt erstaunlich frisch.
Unmittelbar nach dem Finale habe er sich aber alles andere als frisch gefühlt, sagt er. «Nach der Siegerzeremonie kam ich in die Garderobe und war völlig ausgelaugt. Die Muskeln waren vom Druck so angespannt.» Dann redet er so abgeklärt wie einer, der viel älter ist als seine 21 Jahre: «Die Gewinner bleiben, die Verlierer gehen. Gewinner und Verlierer sind so nahe beieinander und doch so weit voneinander entfernt. Wahre Champions macht aus, dass sie gewinnen. Das mag jetzt ein bisschen arrogant klingen, da ich gerade Wimbledon gewonnen habe. Aber es ist einfach so. Ich ließ mir die Chance nicht nehmen.»
Und er erklärt, wieso seine Reifung zum Champion etwas länger dauerte: «Für mich war entscheidend, dass ich mich selber finden konnte. Dass ich mich innerlich wohl fühlte. Ich bin der Typ, der Spieler, der Mensch, der da durchmusste. Ein Hewitt oder ein Safin waren schon früher mental stärker. Bei mir hat es seine Zeit gebraucht.» Dass für ihn als Wimbledon-Sieger nun ein neues Leben als Berühmtheit beginne, sei ihm bewusst. Aber das sei okay für ihn. «Mein Sternzeichen ist Löwe, wie bei Pete Sampras. Wir stehen gerne im Mittelpunkt. Ich bin so entspannt, damit umgehen zu können. Und zum Glück sind die Paparazzi in der Schweiz nicht so schlimm wie in England.»
Noch am gleichen Tag geht es für ihn mit dem Privatjet ins Berner Oberland, nach Gstaad. Ein Sandturnier auf 1050 Metern Höhe ist wohl so ziemlich das Letzte, was sein erschöpfter Körper gebrauchen kann. Doch Federer will Jacques «Köbi» Hermenjat nicht enttäuschen – schließlich hat ihm der Turnierdirektor 1998 als 16-Jährigem mit einer Wildcard den ersten Auftritt bei einem Profiturnier ermöglicht. Hermenjat überrascht den frischgebackenen Champion am Dienstag mit einem üppigen Geschenk: einer 800 Kilo schweren Simmentaler Milchkuh namens Juliette. Das Bild des ungleichen Duos geht um die Welt.
Die Kuh als Belohnung für Federer passt zur Lobeshymne, welche die Londoner «Times» nach seinem Triumph auf ihn und die Schweiz verfasst hat. Eine augenzwinkernde Tour d’Horizon, die sich aller Klischees bedient, auch Bezug nimmt auf Ballonfahrer Bertrand Piccard und den Coup der Schweizer Segelyacht Alinghi beim America’s Cup: «Blast die Alphörner und lasst alle Kuckucksuhren singen. Jodelt die gute Nachricht von Gipfel zu Gipfel und brecht die Toblerone. Roger Federers Sieg in Wimbledon hat bewiesen, dass die Schweiz ein Land von sportlichen Helden ist, ein Land, wo Giganten von den Bergwiesen ausziehen, um die Meere segeln, den Globus im Ballon umrunden und sich gebückt zu gräsernem Tennisruhm siegen. Die Jungen und Mädchen, die bob- und slalomfahrend Siege in winterlichen Sportarten eroberten, sind inzwischen weit entfernt von den verschneiten Horizonten ihres eingeschlossenen Landes.»