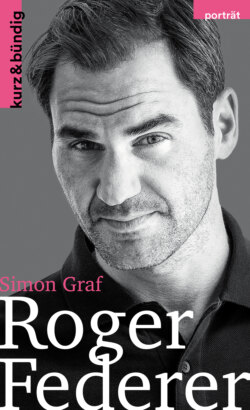Читать книгу Roger Federer - Simon Graf - Страница 8
Оглавление5. «So ist die Welt richtig. Nicht nur die Tenniswelt!»
Eine Sportlerkarriere war Hans Ulrich Gumbrecht, genannt «Sepp», nicht vergönnt. Dafür trieb der Universalintellektuelle seine akademische Laufbahn mit sportlichem Ehrgeiz voran. 1948 in Würzburg geboren, wurde er bereits mit 26 Jahren Professor in Bochum. Von 1989 bis 2018 lehrte er Vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University. Er befasst sich aber nicht nur mit Literatur, sondern schaltet sich häufig in gesellschaftliche Debatten ein. Und, was bei Intellektuellen eher verpönt ist: Er ist begeisterter Sportfan. 2006 publizierte er das Buch «Lob des Sports» (Original: «In Praise of Athletic Beauty»), eine Hommage, die in zwölf Sprachen übersetzt wurde. In seinem jüngsten Buch «Crowds – Das Stadion als Ritual von Intensität» besingt er das orgiastische Gefühl beim Stadionbesuch. Gumbrecht ist involviert beim College-Footballteam von Stanford, Fan von Borussia Dortmund, besitzt seit 1991 eine Saisonkarte im Eishockey bei den San Jose Sharks und ist entzückt von der Anmut Roger Federers. Seit 2000 US-Bürger, lebt er in Palo Alto im Silicon Valley, ist in zweiter Ehe «sehr glücklich» verheiratet und hat vier Kinder und zwei Enkel. Alle viel bessere Sportler als er selbst, wie er sagt. Obschon er, das darf nicht verschwiegen werden, jeden Morgen 19 Minuten den Unterarmstütz hält, bis alles schmerzt. Im Interview spricht er über seine Bewunderung für Roger Federer, dessen globale Ausstrahlung und Stellung in der Sportwelt.
Sie verfassten mit Ihrem Werk «Lob des Sports» eine Hymne auf die Schönheit und Faszination des Sports. Schon 2006 erwähnten Sie da Roger Federer, hoben Sie seine Eleganz und Mühelosigkeit hervor. Wodurch fasziniert er Sie?
Eine der durchaus vielfältigen Faszinationen des Sports für seine Zuschauer liegt darin, dass manche Athleten dem Tod ins Auge blicken. Im übertragenen Sinne natürlich. Diese besondere Faszination ist in konfrontativen Sportarten wie dem Boxen, aber auch im Tennis am deutlichsten ausgeprägt. Wenn man beispielsweise die Nahaufnahme eines Aufschlags sieht, wie der Schläger da nach unten saust, dann sieht es oft so aus, als wollte der Aufschläger jemanden umbringen. In diesem Sinne finde ich auch, dass der Handshake übers Netz am Ende fast immer etwas Erzwungenes hat. Tennis ist also ganz klar ein konfrontativer Sport, mit anderen physischen Konsequenzen als das Boxen, aber psychisch dem Boxen sehr ähnlich. Man will den anderen schlecht aussehen lassen, lässt nie von ihm ab. Natürlich beherrscht Roger Federer die Konfrontation, sonst wäre er nicht so erfolgreich geworden. Aber bei ihm – und vielleicht nur bei ihm – ist eine andere Komponente und mögliche Faszination des Sports, die ich Schönheit und Anmut nenne, ebenso ausgeprägt. Diese andere Komponente nimmt dann sozusagen der konfrontativen Grundlage des Tennis den Wind aus den Segeln. Man hat bei ihm fast den Eindruck, sie spiele gar keine Rolle. Diese spezielle, ja einzigartige Kombination macht ihn so faszinierend.
Was löst er bei Ihnen aus?
Wenn ich Federer zuschaue, habe ich das Gefühl: So muss es sein! So ist es richtig! Und ich verwende «richtig» hier als ein starkes philosophisches Wort. Man könnte dann auch weitergehen und sagen: Die Art, wie Federer spielt, ist ein Indiz dafür, dass die Welt eine gute Einrichtung ist. Dass etwas stimmt auf und an dieser Welt, obschon dauernd so vieles schiefläuft. Sie können das dann religiös auslegen oder nicht. Ich tue es nicht. Federer zuzuschauen, löst bei mir solche sehr elementaren Gefühle aus, die sich nur schwer in genaue Begriffe fassen lassen. Ich spüre jedenfalls: So ist die Welt richtig, nicht nur die Tenniswelt! Momentan bin ich sehr fasziniert von Vogelschwärmen. Wenn man einen Vogelschwarm beobachtet, wie da alles perfekt harmoniert, obschon es keinen führenden Vogel gibt und sie sich immer wieder ablösen. Wunderbar – und auch: richtig! Kürzlich fegte ein wahnsinniger Sturm hier bei uns über den Pazifik. Wie sich die Vögel da gegen den Sturm stemmten und in der Luft hingen, so muss es sein! Ein Gefühl dieser Art löst Federers Tennis bei mir aus.
Dabei ist die Schönheit des Spiels im Tennis ja nicht der Zweck, sondern nur eine angenehme Begleiterscheinung.
Immanuel Kant definiert Schönheit als Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Das trifft es bei Federer. Denn alles, was man im Sport tut, hat ja zunächst eine Funktion im Wettkampf. Aber zugleich ist diese auch immer aufgehoben dadurch, dass es sich um ein Spiel handelt. Das gilt auch und besonders für die Profis, die nicht so gut wären, wie sie sind, wenn sie bei jeder Bewegung daran dächten, wie viel Geld auf dem Spiel steht. Und jene spielerische Komponente ist eben bei Federer besonders ausgeprägt. Er denkt wohl kaum daran, dass er schön spielen will, wenn er auf dem Platz steht. Er spielt, um den Passierball der Linie entlang zu spielen, den Volley ins Eck zu platzieren oder um mit dem Aufschlag zu punkten. Nicht, damit es schön aussieht. Aber selbst wenn sein Ball knapp ins Aus geht, sagt man bei ihm: schade, der war doch so schön! Man könnte als Gegensatz Boris Becker nehmen. Bei ihm stand stets die Konfrontation im Vordergrund. Er hat großartig gespielt, die Volleys, wie er durch die Luft geflogen ist, das war toll! Aber bei ihm spielte diese Schönheits- und Anmutskomponente keine große Rolle. Die Federer-Momente, die David Foster Wallace in seinem Essay so schön und präzise beschreibt, sind ja durchaus Schläge, die fantastisch, funktional und also tödlich sind. Aber es ist eben nicht die Tödlichkeit, die bei Federer hervorsticht, sondern die Schönheit.
Noch bevor David Foster Wallace den Begriff der Federer-Momente prägte, schrieben Sie von «Momenten des vollkommenen Glücks», die man als Sportzuschauer erfahren könne. Haben Sie beim Verfolgen eines Federer-Matches wie Foster Wallace auch einmal Laute ausgestoßen, dass Ihre Frau aus dem Nebenzimmer kam, um zu sehen, ob Sie okay seien?
(lacht) Ich würde gerne Ja sagen. Wenn man Sport mag und auf Ästhetik setzt wie ich, erlebt man bei Federer immer wieder Wow-Momente. Aber ich könnte nicht behaupten, dass ich einmal so geschrien hätte, wie das Foster Wallace beschreibt. Ich denke, für diese Intensität der Identifikation muss man wohl selber gut gespielt haben. Foster Wallace konnte ja bestimmt mit dem Schläger umgehen, er war ein ausgezeichneter College-Tennisspieler gewesen. Ich schaffte es nur zum Auswechselspieler im Jugend-Wasserball.
Federer ist fast auf der ganzen Welt gleichermaßen beliebt. Weil er für globale Werte steht? Oder schlicht wegen seines Spiels?
Was sind eigentlich globale Werte? Das werden immer ganz selbstverständliche Durchschnittswerte sein. Dass man niemanden umbringen soll, zum Beispiel. Oder dass man etwas spenden soll, wenn man so reich ist wie Federer. Das ist eher banal, oder? Klar, Federer macht auch das alles sehr gut. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, nur einmal glaubte ich, im gleichen Raum zu sein wie er, als ich an der Sporthochschule in Magglingen einen Vortrag hielt, in dem er vorkam. Aufgrund meiner Eindrücke bin ich jedenfalls überzeugt, das ist ein sehr netter Junge, der ungefähr alles richtig gemacht hat. Und dass er beispielsweise ganz normal ins Freibad geht, finde ich großartig. Aber es gibt viele, die dieselben Werte repräsentieren wie Federer. Überhaupt meine ich, dass man Sportler nicht zu moralischen Instanzen hochstilisieren sollte. Das Potenzial ist doch begrenzt. Es ist anerkennenswert, dass Federer eine Stiftung hat, dass er sich anständig verhält. Aber das Gefühl, das er beim Betrachter auslöst, wenn er eine Vorhand oder einen Volley spielt, geht weit darüber hinaus. Und mein Eindruck ist, dass wir sehr viel, allzu viel von seinem Spiel auf seinen Charakter projizieren.
«So muss es sein! So ist es richtig!» Philosoph Hans Ulrich Gumbrecht
ist fasziniert von Federers Ästhetik.
So viele Rekorde Federer gebrochen hat, zwei seiner größten Spiele waren Niederlagen: die Wimbledon-Finals 2008 gegen Rafael Nadal und 2019 gegen Novak Djokovi´c. Wie beeinflusst das die Wahrnehmung von ihm?
Klar, man will immer gewinnen, alle Rekorde haben. Aber Federer ist davon anscheinend weniger abhängig als Rafael Nadal oder Novak Djoković. Es wäre wohl kein Problem, wenn er zwanzig Prozent weniger Titel gewonnen hätte. Weil sein Tennis so stimmig – und eben richtig ist. Sieg oder Niederlage sind ohnehin überschätzt, wenn man sich das große Bild anschaut. Siebzig Prozent der deutschen Fußballfans meiner Generation sollen in einer Umfrage, gefragt nach dem besten Spiel der Nationalmannschaft, das WM-Halbfinale 1970 gegen Italien genannt haben. Das verlor Deutschland bekanntlich 3:4 nach Verlängerung. Und es gibt ja keinen Mangel an WM-Titeln in der Geschichte des deutschen Fußballs. Sicher, man braucht als Fan das Siegenwollen als Motivation, um sich überhaupt auf ein Spiel einzulassen. Aber letztlich ist das nicht die Grundlage, nicht die Hauptkomponente an unserer Faszination für eine Mannschaft oder einen Sportler. Im Boxen sagt man ja, mindestens eine große Niederlage gehöre zu den ganz außergewöhnlichen Helden. Anders kann ein Boxer nicht wirklich populär sein. So gesehen, haben Federers große Niederlagen sein Profil nur noch prägnanter gemacht.
Wie würden Sie ihn einordnen im Vergleich mit den ganz Großen des Sports? Mit Muhammad Ali, Michael Jordan, Pelé, Babe Ruth oder Wayne Gretzky?
Für mich stehen Muhammad Ali und Federer zuoberst. Und sie haben auch tatsächlich erstaunlich viele – auf den ersten Blick gar nicht sichtbare – Parallelen. Auch Ali wollten die Leute in jedem Land und gegen jeden Gegner siegen sehen. Die ästhetische Komponente stach auch bei Ali gegenüber der Konfrontation hervor. Wie sagte er so schön: «Float like a butterfly, sting like a bee.» Sein Kampf gegen Joe Frazier 1971, den er verlor, war ein Fight des Jahrhunderts. So wie das Wimbledon-Finale 2008 als größtes Tennisspiel aller Zeiten betrachtet wird. Und vor allem hatte man bei Ali wie bei Federer das Gefühl: Da ist etwas richtig, das über den Sport hinausgeht! Ali gab mir schon als Kind vor dem Radio die Gewissheit, bei ihm könne nichts schiefgehen. Und das schließt Niederlagen ein. Natürlich sind Michael Jordan, Pelé, Babe Ruth oder Wayne Gretzky alle großartig und singulär gewesen. Aber ich möchte Federer und Ali noch über sie stellen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich Größe in Einzelsportarten viel prononcierter zeigt. Und dass Boxen und Tennis eben beide konfrontativ sind, mit einem selten aktivierten Potenzial von Schönheit.
Und was, wenn Federer nach Grand-Slam-Titeln von Rafael Nadal oder Novak Djokovi´c oder von beiden übertroffen würde?
Ich finde, die Diskussion nach dem Größten einer Sportart und im Sport überhaupt sollte man nicht nach rein statistischen Kriterien führen. War Muhammad Ali der statistisch beste Boxer? Babe Ruth der statistisch beste Baseballer? Wohl eher nicht. Würde man nur die Statistik zum Maßstab nehmen, ergäben sich keinerlei Diskussionen: Es gäbe dann immer und für jede Kategorie einen objektiv Größten. Je nachdem natürlich, wie man die Statistik anlegt. Und dann wäre die Diskussion schon vorbei. Wenn man dagegen die Debatte mit Begriffen führt, entfaltet man die verschiedenen Aspekte. Das wird den Sportlern eher gerecht. Mit Statistiken fängt man nicht ein, was ihre Faszination ist. Darüber hinaus transzendieren Ali wie Federer eben Sieg und Niederlage.
Das Leben der Federer-Fans ändert sich faktisch nicht durch seine Siege oder Niederlagen, und trotzdem hallen diese
in ihnen lange nach: wie der Sieg über Nadal in Melbourne 2017 oder die Niederlage gegen Djokovi´c in Wimbledon 2019. Ist er Teil der Identität seiner Fans geworden?
Natürlich. Seine Siege und Niederlagen sind Teil der Identität seiner Fans geworden. Dazu hat Christoph Biermann, der für die Fußballzeitschrift «11 Freunde» schreibt, die starke These geäußert, dass Leute durch solche psychische Investitionen ihrem Leben prägnante Sinnprofile geben können. Damit kann ich mich selbst voll und ganz identifizieren. Die Mannschaft, in die ich am meisten emotional investiert habe, ist Stanford Cardinal. Also College-Football. Da wirke ich mit bei der intellektuell-akademischen Betreuung von Spielern und verfolge jedes Heimspiel bei der Mannschaft am Spielfeldrand. Wenn wir ein Heimspiel verlieren, vielleicht sogar noch gegen unseren Erzrivalen Berkeley, sieht man mir das am nächsten Tag vermutlich an. Ich möchte dann nicht einmal nach
Europa fliegen, weil ich denke, mir stände selbst da die Niederlage ins Gesicht geschrieben. Obschon ja in der Schweiz oder in Dänemark niemand etwas vom College-Football weiß. Die zweite Mannschaft, mit der ich mich identifiziere, ist Borussia Dortmund. Als ich neun war, nahm mich mein Opa 1958 mit zu einem Europacupspiel unter Flutlicht gegen die AC Milan. Seitdem ist der BVB eine der Komponenten meines Lebens. So wie Federer zum Leben vieler gehört. Ich finde es immer absurd, wenn irgendwo steht, ich sei ein «bekennender» Fan von Borussia Dortmund. Was soll ich denn bekennen? Ich kann gar nicht anders. So wie es Federer-Fans gibt, die nicht mehr Tennis schauen können, seit er das Wimbledon-Finale 2019 verloren hat, weil es sie immer noch allzu sehr schmerzt. Das sucht man sich nicht aus. Es stößt einem zu.
Als Dortmund-Fan hat man einen Vorteil: Der Club bleibt einem wohl lebenslang erhalten, Federer wird aber irgendwann aufhören. Wie kann man als Fan damit umgehen, wenn diese wichtige Komponente wegfällt?
Man kann sie nicht ersetzen. Es wird keinen nächsten Federer geben. So wie es keinen nächsten Elvis Presley gab. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich im August 1977 hörte, Elvis sei gestorben. Ich war damals gerade in Rio. Klar kann man seine Songs immer wieder hören, aber das ist nie mehr dasselbe. So wie es nicht dasselbe sein wird, Federer-Videos zu schauen, wenn er seine Karriere beendet hat. Wenn Federer aufhört zu spielen, dann ist das schon – nicht nur
metaphorisch gesehen – wie ein Tod. Selbst wenn er danach der beste Tenniscoach werden sollte. Tode gehören eben zum
Leben.
Was wird zurückbleiben von Federer? Wie wird man ihn in fünfzehn, zwanzig Jahren betrachten?
Zurückbleiben wird, hoffe ich, dieses beglückende Gefühl, das er uns gab: Wenn es möglich ist, dass einer so Tennis spielt, dann ist etwas richtig an dieser Welt. Ich bin sehr dankbar, ihn als Zeitgenosse erlebt haben zu dürfen.