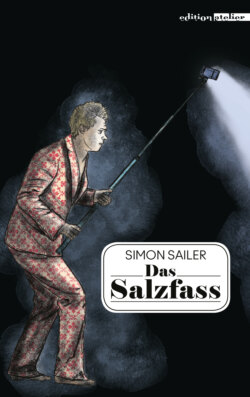Читать книгу Das Salzfass - Simon Sailer - Страница 11
ОглавлениеEr bedankte sich noch einmal für die »professionelle Abwicklung« und versicherte, er werde Maurice weiterempfehlen. Währenddessen stand er auf und verließ den Laden mit langen Schritten. Er wirkte, als wäre er lieber gelaufen – wie jemand, der bei der Anreise im Urlaub die Koffer deponiert hat und zum ersten Mal unbeschwert die unbekannte Gegend erkundet.
Maurice beäugte das Salzfass. Er benetzte seinen Zeigefinger mit Speichel und berührte die weißliche Stelle in der Mitte, um etwas von dem Pulver aufzulösen. Das Pulver roch nach nichts. Er wischte es mit einem Stofftaschentuch ab und brachte das Salzfass ins Lager, in ein Regal im hinteren Eck, wo er das Tafelsilber aufbewahrte. Damit alles seine Ordnung hatte, wollte er das Fass sogar im Computer in die Liste der im Fleck-Nachlass enthaltenen Gegenstände aufnehmen, aber das Programm stürzte ab und er schrieb stattdessen nur eine Notiz an den Rand der ausgedruckten Liste: »Englisches Salzfass, Sterlingsilber, Kobaltglas, um 1917«. Er schrieb in zittrigen Linien. Das ergab eine feine Schrift, die schwer zu lesen war, aber ein elegantes Schriftbild aufwies. So etwas gibt es. Meine Mutter hat auch so geschrieben.
Weil das Salzfass nicht im Computer erfasst war, nahm Maurice es auch nicht in den Onlineverkauf auf. Manchmal werden Stücke vergessen, weil sie aufgrund so eines Fehlers nicht mehr im System aufscheinen. So erging es dem Salzfass. Es war ja ein unauffälliges Ding. Wertvoll, aber nicht von enormem Wert. Zumindest nicht, soweit das für Maurice damals ersichtlich gewesen wäre. Manchmal, wenn er aus dem Lager die Silberauslage auffüllte, blitzte das Salzfass bläulich zwischen einem Tablett und einer Teekanne hervor und Maurice fiel ein, dass er es bei Gelegenheit eingeben müsse. Es mangelte auch nicht an Gelegenheiten, aber Maurice vergaß auf sein Vorhaben, sowie er das Silber auf dem dunkelgrünen Samttuch auflegte. Manchmal blickte er noch zurück zum Lager und überlegte, ob er etwas vergessen hatte. Aber das ist es eben mit dem Vergessen, wenn man etwas vergessen hat, erinnert man sich daran nicht.
Zu jener Zeit verbrachte Maurice seine Abende gerne in der Wunderbar. Kennen Sie die Wunderbar? Eine kleine Bar, verraucht, dunkel. Dafür ist sie bis spät nachts geöffnet und liegt gleich ums Eck vom Alt Wien. Wenn das Alt Wien schließt, ziehen die notorischen Kaffeehaussitzer weiter in die Wunderbar. Sie müssen einmal vorbeischauen, wenn Ihnen so etwas gefällt. Man sitzt sehr eng und die Decke ist niedrig. Wie eine Höhle, Sie sagen es. Jedenfalls war Maurice einer dieser Kaffeehaussitzer. Nach der Arbeit ging er ins Alt Wien und dann, wenn die Stimmung danach war – und oft genug war sie danach –, ging er weiter in die Wunderbar. Maurice stammte ja aus einer bürgerlichen Familie. Reich und konservativ. Aber seine Freunde waren alle Kommunisten. Nein, nicht solche. Junge Menschen, Studenten, arbeitslose Jungakademiker, Künstler. Oft auch aus gutem Haus, haben die Nächte das Erbe der Eltern versoffen und Ideen gewälzt. Besonders eng war er mit Raquel Ribeiro, einer Komparatistin, deren Eltern aus Porto stammten. Nein, keine Weinexporteure. Ihre Mutter war Opernsängerin, über den Vater weiß ich nichts. Raquel sprach perfekt Portugiesisch und Deutsch, lernte gerade Französisch, und Englisch beherrschte sie sowieso. Die Jungen können ja alle so gut Englisch, wissen Sie? Das kommt vom Internet. Selbstverständlich. Natürlich ist das sehr gut. Sie sagen es. Keine Frage, meine Enkelin war gerade in Amerika. Überall. New York und sonst wo. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau, danke.
An einem dieser Abende im Alt Wien war die Stimmung jedenfalls danach und Maurice ging mit Raquel weiter in die Wunderbar. Sie bestellten eine Flasche Rioja, und Raquel brach das von der Kerze geronnene Wachs ab und legte es oben an die Flamme, wo es schmolz und wieder die Kerze herunterlief. Maurice rauchte Zigarillos, Raquel rauchte nicht, sagte aber immer, wie sehr sie den Geruch des Rauches möge. Je mehr sie trank, desto wahrscheinlicher wurde es, dass sie von Sophia de Mello Breyner Andresen sprach oder eines ihrer Gedichte aufsagte. Maurice hatte nichts dagegen.
»É esta a hora perfeita em que se cala.« Sie steckte die Nase tief in das Weinglas und zog sie wieder heraus. »O confuso murmurar das gentes.«
»Wenn ich Portugiesisch lese«, sagte Maurice, »verstehe ich es sogar ein wenig. Dann ist es wie Französisch oder Italienisch. Aber wenn du es sprichst, klingt es, wie wenn jemand am anderen Ende des Raumes vor sich hin nuschelt.« Er hob sein Glas. »Saúde.«