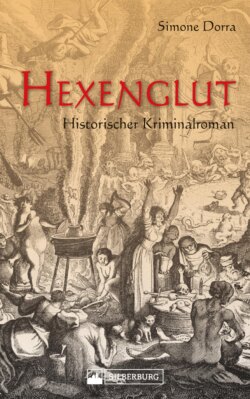Читать книгу Hexenglut. Historischer Kriminalroman. - Simone Dorra - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Haus mit den Rosenfenstern
ОглавлениеDie Reise von Frauenalb dauerte mehr als vier Tage, da der Wagen samt Zugpferd und Wachmännern nur sehr langsam vorankam. Vinzenz Stöcklin hatte zuerst um ein zusätzliches Pferd gebeten, um reiten zu können (und es auch erhalten), aber nach einem Tag im Sattel schmerzte das noch nicht vollständig verheilte Bein so heftig, dass er es vorzog, sich zu Fidelitas unter das Stoffdach zu setzen und dort auch für den Rest der Fahrt sitzen zu bleiben.
Am Morgen des fünften Tages erwachten sie in der Rheinebene; sie hatten Offenburg schon hinter sich gelassen und am Vorabend im Marktflecken Emmendingen frisches Brot und Obst gekauft.
»Wir sollten gut frühstücken, Schwester«, meinte einer der Knechte, die die Äbtissin zum Schutz mitgeschickt hatte. »Bis zur Stadt sind es vielleicht noch zwei Stunden, aber wenn wir am Tor aufgehalten werden, wartet sich's besser mit vollem Magen.«
»Als ob wir dort warten müssten!«, mischte Vinzenz Stöcklin sich ein, dem die Ungeduld deutlich anzusehen war. »Ich bin Bürger von Freiburg und sämtlichen Wachen an den Toren wohlbekannt.«
»Trotzdem kann es nicht schaden, wenn Ihr euch jetzt ein wenig die Beine vertretet«, gab Fidelitas sanft zu bedenken. »Dass Ihr nicht geritten seid, war hilfreich, aber das Gerüttel hat dem Knochen bestimmt nicht gerade gutgetan. Lasst uns ein paar Schritte machen, einen Becher Wasser trinken und eine Kleinigkeit essen. Keine Sorge – Ihr seid bald daheim.« Sie lächelte ihn an. »Und wenn Ihr Euch ein wenig warmgelaufen habt, müsst Ihr nachher nicht mühsam über die Schwelle Eures Hauses humpeln.«
Vinzenz Stöcklin zögerte, dann nickte er langsam. »Wie Ihr meint, Schwester.«
Zwei Knechte halfen ihm vom Wagen herunter, und er ging, auf Fidelitas' Arm gestützt, langsam die grasbewachsene Böschung seitlich der Straße entlang, darauf bedacht, das verletzte Bein nicht zu sehr zu belasten. Sie konnte sehen, dass ihn etwas beschäftigte.
»Vergebt mir meine Ungeduld«, sagte er endlich nach einer ganzen Weile des Schweigens. »Aber ich muss unbedingt wissen, wie die Dinge in Freiburg stehen. Vor einer Woche hat mich ein Brief meiner Mutter erreicht, und der hat nicht gerade dazu beigetragen, mir das Herz zu erleichtern.«
Fidelitas hielt es für reichlich rücksichtslos, einen Kranken, der sich erst auf dem Weg der Besserung befand, in Sorge zu versetzen, beschloss aber, ihre Ansicht für sich zu behalten.
»Hat der Überfall Euch viel Geld gekostet?«, fragte sie stattdessen. »Ist der Verlust so hoch, dass er Euren Geschäften dauerhaft schaden könnte?«
Vinzenz Stöcklin zog eine Grimasse.
»Wenn ich behaupten würde, dass es mir um die geraubten Stoffe und das Geld in meiner Kassette nicht leidtut, müsste ich lügen«, gab er zu. »Meine Mittel sind allerdings groß genug, dass ich die Sache immerhin verschmerzen kann. Meine Mutter sieht das anders. Was begreiflich ist, wenn man bedenkt, dass mein Vater als kleiner Händler angefangen und sein Lebtag hart gearbeitet hat, um meiner Familie einen respektablen Platz unter den Kaufleuten von Freiburg zu verschaffen. Jetzt, da Krankheit und Alter ihn bewogen haben, mir die Geschäfte zu überlassen, beschäftigt er sich lieber mit der Stadtgeschichte.« Er warf Fidelitas einen halb ironischen Blick zu. »Was immer Ihr über mein schönes Freiburg erfahren wollt – fragt ihn, und ich garantiere Euch, er wird es wissen.«
Fidelitas nickte, antwortete aber nicht, um seinen Gedankengang nicht zu unterbrechen. Sie wartete geduldig darauf, dass er fortfuhr.
»Mutter hat immer Angst, wir könnten eines Tages in Not geraten«, sagte er endlich. Er sprach leise, als verriete er ihr ein gut gehütetes Geheimnis. »Niemand führt unsere Bücher so gründlich wie sie, niemand prüft jede einzelne Lieferung so streng, und niemand feilscht so grimmig um jede Münze, die wir bezahlen müssen. Unsere Zulieferer fürchten sie wie den Leibhaftigen.«
Er räusperte sich ein wenig schuldbewusst.
»Wer hart für seinen Reichtum gearbeitet hat, hat sicherlich Angst, ihn eines Tages zu verlieren«, sagte Fidelitas langsam. »Das kann ich verstehen.«
»Tatsächlich?« Ein weiterer ironischer Blick. »Und das von einer Nonne, die lebenslange Armut gelobt hat? Ich muss sagen, Ihr erstaunt mich.«
»Der Orden sorgt für mein Wohl«, erwiderte Fidelitas ernsthaft, »und mein Kloster gibt mir ein Zuhause. Ich habe keinen Grund, mich vor Hunger und Besitzlosigkeit zu fürchten. Aber in der Welt ist das Leben ganz anders. Nicht wahr?«
»Richtig.« Vinzenz Stöcklin schnaubte leise. »In ihrem Brief hat Mutter mir vorgeworfen, ich hätte den Männern, die mich und meinen Wagen beschützen sollten, viel zu viel Geld gegeben. Schließlich hätten sie mich in der Stunde der Gefahr im Stich gelassen und wären schmählich geflohen.«
»Die beiden, die bei der Verteidigung Eures Besitzes ihr Leben verloren haben, hatten keine Gelegenheit mehr zur Flucht.« Fidelitas sah ihn an. »Die anderen beiden haben immerhin unsere Knechte zu Euch geführt. Und Euch damit das Leben gerettet.«
»Das weiß ich.« Vinzenz Stöcklin verzog den Mund. »Ich bezweifle bloß, dass meine Mutter das begreift.«
Fidelitas drückte tröstend seinen Arm. »Sie war in großer Sorge um Euch, als sie diesen Brief geschrieben hat«, sagte sie. »Und wer sich sorgt, der denkt nicht immer sehr vernünftig. – Wir sollten zurückgehen und essen, meint Ihr nicht?«
Sie tranken Wasser, das die Knechte aus dem letzten Bach im Wald geschöpft hatten; dazu gab es das Brot aus Emmendingen, ein paar Scheiben geräucherten Schinken, die von den Vorräten des Klosters noch übrig waren, ein paar frische Äpfel und Birnen. Danach halfen die Männer erst Fidelitas und dann Stöcklin wieder auf den Wagen, und der letzte Abschnitt der Reise begann.
Keine Wolke stand am Himmel, und während der Vormittag verstrich, wurde es frühsommerlich warm. Fidelitas legte ihren Reiseumhang ab und spähte an dem Knecht auf dem Kutschbock des Wagens vorbei; am Horizont tauchten verschwommen dunkle Umrisse auf: eine Stadtmauer, dahinter die Silhouetten von Häusern und ein hoher, schlanker Kirchturm. Je näher sie der Stadt kamen, desto deutlicher war er zu erkennen. Fidelitas musterte ihn staunend: Er wirkte so zart und elegant, als bestünde er nicht aus Stein, sondern aus feiner Spitze.
»Welche Kirche ist das?«, fragte sie.
Die Augen von Vinzenz Stöcklin leuchteten vor Stolz.
»Unser Münster«, sagte er. »Das müsst Ihr Euch unbedingt genauer ansehen, solange Ihr in Freiburg seid. Unsere Stadt ist reich und schön – aber das Münster ist ein Stein gewordenes Wunder.«
Fidelitas stellte fest, dass sie sich wirklich darauf freute, in diesem Münster zu beten. Ob sie sich auf die Familie von Vinzenz Stöcklin freuen sollte, wusste sie hingegen nicht so genau. Was der Kaufmann ihr mit solch erstaunlicher Offenheit über seine Mutter verraten hatte, sorgte für ein flaues Gefühl in ihrer Magengrube.
Sie konnte nur das Beste hoffen.
In der darauffolgenden Woche kam Fidelitas nicht dazu, das berühmte Münster zu besuchen; sie war viel zu beschäftigt damit, Stöcklins Familie kennenzulernen und sich um seine Frau zu kümmern.
Das Haus der Stöcklins lag einen kurzen Fußweg vom Münsterplatz entfernt, fast in Sichtweite des Martinstores und gerade weit genug weg vom Gerberviertel, dass man auch bei ungünstigem Wind die üblen Dünste nicht roch. Außer Vinzenz und seiner Mutter Gundis lebten dort noch Vinzenz' Frau Regula, sein Vater Heinrich und seine Tochter Veronika. Mit dem Hausgesinde waren es insgesamt neun Menschen, mit Fidelitas zehn.
Fidelitas bekam schnell heraus, dass Gundis Stöcklin in dem verwinkelten Fachwerkbau, den ihr Mann vor etwas mehr als vierzig Jahren gekauft hatte, herrschte wie eine Königin. Allerdings war ihr Regiment alles andere als milde. Die Dienerschaft hatte Angst vor ihr, und binnen kürzester Zeit hatte Fidelitas den starken Eindruck, dass es ihrer Familie keinen Deut besser ging.
Am ersten Tag hatte der Kaufmann sie freundlich gebeten, an den gemeinsamen Mahlzeiten im Speisezimmer teilzunehmen. Das war der größte Raum im ersten Stock, mit einer Kassettendecke aus dunkler Eiche, einem langen, glänzend polierten Tisch und Fenstern aus kostbarem Buntglas mit Rosen und Blätterranken. Gundis ließ allerdings keinen Zweifel daran, dass sie die Aussicht, mit der Pflegerin ihrer Schwiegertochter an einem Tisch zu essen, höchst unpassend fand.
»Ich bin sicher, die Schwester fühlt sich auch in der Küche wohl«, sagte sie, als Vinzenz ihr Fidelitas vorstellte und sie im selben Atemzug zum Mittagessen mit den Seinen einlud. Der Kaufmann öffnete protestierend den Mund – und schloss ihn wieder, als wäre ihm bereits klar, dass es keinen Zweck hatte, seiner Mutter zu widersprechen. Fidelitas hielt es für unklug, gleich am ersten Tag Anlass für einen Familienzwist zu sein; sie war auf das Wohlwollen von Gundis Stöcklin angewiesen, um den Dienst, für den sie gekommen war, möglichst ungestört und ohne Anfeindungen verrichten zu können. Also nickte sie und verneigte sich mit einem höflichen Lächeln.
»Selbstverständlich, Frau Stöcklin.«
Gundis saß in einem Lehnsessel in ihrem Zimmer, in einem Kleid aus fein gesponnener dunkelblauer Wolle, ein goldenes Kruzifix an einer Kette aus geschliffenen Rosenquarzperlen auf der Brust. Ihr faltiges Gesicht mit dem schmal zusammengepressten Mund und den scharfen, dunklen Augen wurde von einer reich gefältelten weißen Haube eingerahmt, am Ringfinger ihrer Rechten, die auf der Armlehne ruhte, steckte ein auffälliger Goldring mit einem weiteren Rosenquarz. Ihre ganze Körperhaltung war darauf angelegt, einschüchternd zu wirken.
»Du kannst sie jetzt durch das Haus führen, Vinzenz«, sagte sie zu ihrem Sohn. »Und zu deiner Frau – schließlich ist sie ja hier, damit sie sich um Regula kümmert, oder nicht?«
Ein abschätziger Blick, ein leicht verächtliches Gekräusel der Mundwinkel.
»Wobei es mir ein Rätsel ist, wieso du dafür unbedingt eine Nonne hast herschleppen müssen – ich bin sicher, wir würden schon bald einen neuen Medikus finden, der vielleicht endlich herausbekommt, warum die Gute es seit Jahren nicht fertigbringt, sich zu irgendeinem nützlichen Beitrag in diesem Haushalt aufzuraffen.«
Vinzenz wurde bleich. In seinen Augen blitzte es wütend, aber erneut wagte er keinen Widerspruch. Fidelitas hielt es für angebracht, ihm beizustehen.
»Wer lange leidet, verliert irgendwann alle Kraft«, sagte sie sanft. »Das wird bei Frau Regula nicht anders sein. Aber ich versichere Euch, Frau Stöcklin – ich bin im Umgang mit Kräutern und Arzneien sehr erfahren und will mich bemühen, ihr zu helfen, so gut ich irgend kann.«
»Wir werden sehen.«
Gundis Stöcklin musterte sie von Kopf bis Fuß, als hoffte sie, irgendeinen Fehler oder eine Schwäche zu finden. Fidelitas erwiderte ihren Blick ruhig, und ohne mit der Wimper zu zucken. Dann verneigte sie sich zum zweiten Mal, drehte sich um und folgte Vinzenz Stöcklin zur Tür hinaus.
Erst, als er sich sicher war, dass seine Mutter ihn nicht mehr hören konnte, blieb der Kaufmann stehen und räusperte sich verlegen.
»Ihr müsst ihr vergeben«, sagte er. »Sie ist Fremden gegenüber misstrauisch, und leider macht dieser Argwohn auch nicht halt vor Eurem Habit.«
»Ich bin auf Euren Wunsch hier«, erinnerte ihn Fidelitas. »Aber ich habe nicht die Absicht, Streit in Euer Heim zu tragen, und ich brauche weder ein feines Quartier noch irgendeine andere Vorzugsbehandlung.« Sie lächelte ihn an. »Das wäre bestimmt auch nicht im Sinne der Ehrwürdigen Mutter.«
»Ihr meint, Ihr sollt die Tugend der Demut nicht nur zu Hause in Eurem Kloster üben, sondern auch hier?« Die Lippen des Kaufmanns zuckten. »Nun – ich fürchte, dazu werdet Ihr noch reichlich Gelegenheit haben!«
Er geleitete sie über eine schmale Stiege hinauf unter das Dach, wo eine überraschend geräumige Kammer auf sie wartete – mit einem Bett, das deutlich breiter war als das Nachtlager in ihrer Klosterzelle, mit einem Tisch samt Stuhl, Pergament und Schreibfeder und einer kleinen Truhe für ihre überschaubaren Habseligkeiten. Fidelitas' Bündel, ihre Kräuterkiste und das kleine Kruzifix, das sie begleitete, wo immer sie auch hinging, waren bereits heraufgebracht worden. Fidelitas gefiel dieses Quartier, und sie bedankte sich mit ehrlicher Freude.
Der Rest des Hauses zeugte – wenn man vom Speisesaal absah – zwar von einem soliden Vermögen, nicht aber von protzigem Reichtum. Vinzenz' Vater residierte in einem Zimmer zwei Türen weiter; jeder Zoll der Wände war mit Bücherregalen bedeckt, und es roch anheimelnd nach Leder und Pergament. Fidelitas vermutete, dass der alte Herr – der auf sie so sanftmütig wirkte wie seine Frau herrisch – sich hier ein Refugium geschaffen hatte, in dem er von Gundis nicht gestört wurde. Und Gundis ihrerseits war es vermutlich ganz recht, dass er sich schon lange nicht mehr in die Geschäfte von Frau und Sohn einmischte.
Vinzenz' Tochter Veronika lernte Fidelitas erst am späten Nachmittag ihrer Ankunft kennen, als das junge Mädchen von der Schneiderin zurückkam. Ihre Großmutter hatte für sie ein neues Kleid bestellt, vermutlich, um sie für Bewerber um ihre Hand noch anziehender zu machen. Dabei war sie auch ohne Samt, Spitze und Stickerei anziehend genug.
Ihre leuchtend blauen Augen wurden von langen Wimpern umkränzt, so dunkel wie ihre dichten, glänzenden Locken, die ihr offen vermutlich bis fast zur Hüfte reichten. Ihr Gesicht war ein sanftes, rosiges Oval, ihr Mund so zart wie eine Rosenknospe kurz vor dem Aufblühen. Ihr Vater betrachtete sie mit liebevollem Stolz, und als sie Fidelitas begrüßte, war ihre Stimme hell, leise und freundlich. Fidelitas ertappte sich bei dem inständigen Wunsch, dass diese überaus begehrenswerte Jungfer mehr Substanz besäße, als die glatte Fassade vermuten ließ. Denn sonst würde ihre Großmutter sie mit Sicherheit an den Höchstbietenden verschachern wie ein Stück Mastvieh auf dem Markt.
Vinzenz' Frau war Fidelitas bis dahin noch nicht begegnet; bei ihrer Ankunft hatte sie noch geschlafen. Als es gegen Abend endlich zu einem ersten Treffen kam, fühlte es sich an wie der Besuch in einer anderen, hermetisch abgeschlossenen Welt. Die kleinen Butzenfenster des Zimmers, in dem Fidelitas' neue Patientin sich hauptsächlich aufhielt, waren mit dicken Vorhängen abgedunkelt, die Luft warm und stickig. Die Uhr des Münsters hatte gerade erst fünf geschlagen, aber auf dem Tisch und dem Nachtkasten neben dem Bett brannten bereits ein Dutzend Kerzen in Silberleuchtern, als könnte die Kranke das Licht der Sonne nicht ertragen.
Regula Stöcklin erwies sich als bleicher Schatten ihrer schönen Tochter. Das dunkle Haar war grau gesträhnt, das Gesicht seltsam leblos und hohlwangig. Als sie Fidelitas die Hand entgegenstreckte, spürte die jeden einzelnen Knochen der dünnen Finger in ihrem Griff.
»Mein Mann hat mir geschrieben, Ihr könntet mich heilen«, sagte sie, ihre Stimme heiser und so atemlos, als bereite jedes Wort ihr Mühe. »Jedenfalls glaubt er das.«
»Ich werde versuchen, Euch zu helfen«, erwiderte Fidelitas freundlich, »und wenigstens dafür zu sorgen, dass Euer Zustand sich bessert. Wunder kann ich keine wirken – die liegen einzig und allein in Gottes Hand.«
Regula nickte. Sie sah aus, als würde sie sich wenig Hoffnung auf Heilung oder wenigstens auf eine Besserung ihres Zustandes machen. Fidelitas kam es so vor, als hätte ihr gebrechliches Gegenüber sich schon viel zu lange in der eigenen Schwäche eingerichtet; sie erschrak über diesen Gedanken und rief sich selbst streng zur Ordnung. Frau Regula war nicht die erste Kranke, der ihre Hinfälligkeit auch noch die letzte Zuversicht raubte. Viele ihrer Mitschwestern im Kloster, die im Alter von immer mehr Leiden geplagt wurden, hatten mit wachsenden Glaubenszweifeln und Ängsten zu kämpfen und mussten nicht nur behandelt, sondern auch ermutigt und getröstet werden. Sie würde in den nächsten Wochen versuchen müssen, beides zu tun.
Zuletzt wurde sie in die Gesindeküche geführt, wo Vinzenz Stöcklin sich von ihr verabschiedete. Dort lernte sie die Köchin kennen, die Spülmagd Gretel, die auch das Haus sauber hielt und bei der Zubereitung der Speisen half, den Kutscher Wulf und eine blutjunge Zofe namens Birgitta, deren einzige Aufgabe es war, Veronika zu bedienen, anzukleiden und zu frisieren. Sie sah in ihrem schlichten, braunen Gewand so schlank und geschmeidig aus wie ein junger Weidenzweig. Ihre straff gebundene Haube aus ungebleichtem Leinen konnte ihr Haar nicht vollständig bändigen; weiche, blonde Strähnen stahlen sich an den Schläfen hervor, und ihr Gesicht war frisch, wach und selbstbewusst.
Fidelitas vermutete, dass Gundis sie eingestellt hatte – weil sie, was die Zukunft ihre Enkelin anging, nicht bereit war, auch nur die kleinste Einzelheit dem Zufall zu überlassen. Ansonsten war sie sehr eindeutig nicht gewillt, mehr als absolut notwendig für den Lohn der Dienerschaft auszugeben. Sie selbst hatte genauso wenig eine Zofe wie ihre Schwiegertochter Regula, und dass die Spülmagd nicht nur dafür zuständig war, die groben Arbeiten in der Küche zu erledigen, sondern obendrein das ganze Haus sauber halten musste, ließ ebenfalls tief blicken.
Die Köchin – eine dralle, freundliche Matrone namens Irmhild – tischte ihr als frühen Abendimbiss frisch gebackenes Brot und ein Gemüse aus Zwiebeln, Erbsen und Rahm auf. Fidelitas beantwortete geduldig jede Frage zum Klosterleben, die Irmhild einfiel, zog sich dann in ihr Zimmer unter dem Dach zurück und sprach die Gebete der Laudes, bevor sie sich schlafen legte. Es war ein langer Tag gewesen, und das Leben in diesem Haus versprach, alles andere als einfach zu werden.
In den nächsten Tagen sondierte Fidelitas behutsam das Terrain. Was das Leiden von Regula Stöcklin anging, stand sie vor einem Rätsel: Ihre Patientin war keine zehn Jahre älter als sie, lebte in komfortablen Verhältnissen und hätte eigentlich gar nicht so krank sein dürfen, wie sie es war. Es waren keine typischen Anzeichen für die Schwindsucht zu finden (abgesehen von einer erschreckenden Magerkeit und Appetitlosigkeit). Fidelitas schloss Bauchwassersucht ebenso aus wie Krampfanfälle oder eine schleichende Vergiftung, denn Regula aß (wenn sie denn etwas aß) genau dasselbe wie der Rest der Familie. Und sie hatte auch kein Fieber.
Nach einer Woche war Fidelitas noch immer ratlos. Sie schlief schlecht, zermarterte sich das Hirn auf der Suche nach einer Krankheit, die sie nicht kannte oder übersehen hatte, und wünschte sich zunehmend verzweifelt Schwester Maria Curatia herbei, die Infirmarin aus ihrem Kloster. Vielleicht hatte sie sich selbst überschätzt und wäre besser gar nicht erst hergekommen.
Als sie wenig später mitten in der Nacht die Matutin betete, erinnerte sie sich plötzlich an etwas, das sie vor ein paar Monaten in den sorgfältigen Aufzeichnungen von Schwester Agatha gelesen hatte – über den schweren Unfall einer jungen Postulantin vor dreißig Jahren, über ihre Behandlung und die Folgen. Und ihr ging plötzlich etwas durch den Sinn, was Mutter Scholastika einmal zu ihr gesagt hatte: Nicht immer hilft es, Fragen zu stellen, Kind. Manchmal ist es klüger, zu schweigen und stattdessen auf deinen Instinkt zu vertrauen.
Nach Sonnenaufgang stieg sie – noch reichlich übernächtigt – in die Küche hinunter, bekam einen heißen Haferbrei mit eingelegten Pflaumen serviert und löffelte ihn dankbar, während sie darauf wartete, dass auch der Rest des Gesindes auftauchte. Vielleicht konnte sie von einer Tatsache profitieren, die ihr schon in früheren Jahren aufgefallen war: dass man einer Nonne manchmal ebenso viel Zutrauen entgegenbrachte wie einem Beichtvater und dass man sie für ebenso verschwiegen hielt – was weder auf Nonnen noch Beichtväter ohne jede Ausnahme zutraf, wie Fidelitas sehr wohl wusste.
Wenige Minuten später erschien Veronikas Zofe Birgitta auf der Türschwelle, gegen die Morgenkühle in ein wollenes Umschlagtuch gehüllt und einen kleinen, zugedeckten Korb über dem Arm, in dem es leise klirrte, als sie ihn auf den Tisch stellte. Fidelitas bemerkte, dass sie erst ihr und dann der Köchin einen verstohlenen Blick zuwarf – als hätte sie nicht erwartet, die neue Hausgenossin hier vorzufinden. Und als wollte sie nicht, dass Fidelitas sah, was sich in diesem Korb befand.
Fidelitas entschied sich blitzschnell. Ehe die Zofe begriff, was sie plante, hatte sie den Korb bereits aufgeklappt und spähte hinein. Zwei Flaschen aus dunklem Glas lagen darin, verkorkt und mit Wachs versiegelt.
Sie hob den Kopf und begegnete den Augen der Köchin. »Was ist denn das?«
Ein langes, verlegenes Schweigen, dann wieder ein vielsagender Blickwechsel zwischen Zofe und Köchin.
»Ein Stärkungsmittel für Frau Regula«, sagte die Köchin endlich. »Der Medikus, der bis letztes Jahr versucht hat, ihr Befinden zu bessern, hat es extra für sie zusammengestellt, aus verschiedenen Kräutern. Hat er jedenfalls gesagt.«
»Ich mochte ihn nicht.« Das war Birgitta. »Immer, wenn er hier war, um Frau Regula zu behandeln und ihr ihre Medizin zu bringen, mussten wir ihn bedienen. Und anders als die arme Herrin hat er gefressen wie ein Scheunendrescher. Er hat sich's bei uns so gut gehen lassen wie ein gieriger Landjunker … und mich dabei jedes Mal mit den Augen ausgezogen. Ich war immer froh, wenn ich nicht allein war mit ihm. Herr Stöcklin hat ihm aber irgendwann nicht mehr vertraut. Er hat ihn hinausgeworfen und ihm verboten, jemals wieder das Haus zu betreten.«
Das junge Mädchen wirkte so unruhig wie ein Kind, das unerwartet bei einem zweifelhaften Streich ertappt worden war.
»Verstehe ich richtig, dass Frau Regula seit dem Verschwinden des Medikus nicht aufgehört hat, dieses Stärkungsmittel zu trinken?«, wollte Fidelitas wissen.
»Das … das ist wahr.« Birgitta wagte sichtlich nicht, etwas zu sagen; es war die Köchin, die antwortete. »Sie hat diesem Kurpfuscher ordentlich Geld für das Rezept gezahlt, bevor Herr Vinzenz ihm verboten hat, je wieder hierherzukommen. Und jetzt lässt sie sich die Mixtur von einem Apotheker in Neuburg anrühren, immer zwei Flaschen auf einmal.«
Fidelitas runzelte die Stirn. »Und da Frau Regula sich diesen Trank wohl kaum selbst beschaffen kann, erledigt ihr beide das für sie?«, bohrte sie nach. »Ihr bringt die leeren Flaschen zurück und holt die vollen beim Apotheker ab?«
Die beiden Frauen nickten.
»Weiß Herr Stöcklin von diesen Botengängen?« Fidelitas ließ den Blick langsam von der Köchin zur Zofe schweifen. »Oder Frau Gundis?«
Wieder schüttelten beide Frauen den Kopf. »Frau Regula hat uns verboten, es ihnen zu sagen«, kam es von Irmhild. »Sie wollte nicht, dass Herr Stöcklin sich aufregt – schließlich war er es, der den Medikus hinausgeworfen hat. Sie meint, das Mittel täte ihr gut. Und sie bezahlt es aus ihrer Privatschatulle.«
Fidelitas nickte. »Damit Frau Gundis nicht mitbekommt, dass Geld aus dem Haushaltssäckel fehlt.« Sie streckte die Hand aus. »Würdet Ihr mir ein Messer geben, Irmhild?«
Die Köchin gehorchte. Fidelitas schälte die dicke Wachsschicht herunter, die den hölzernen Stopfen bedeckte, und zog ihn aus der Flasche. Sie schnupperte vorsichtig. Tatsächlich befanden sich in der unbekannten Mischung Kräuter. Sie entdeckte Thymian, Minze und vor allem reichlich Rosmarin. Aber auch sein kräftiges Aroma war nicht imstande, den typischen Geruch der Hauptzutat zu überdecken, aus der der angebliche Stärkungstrank bestand. Branntwein … und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine reichlich bemessene Dosis Mohnsaft obendrein.
Sie stellte die Flasche auf den Tisch und korkte sie wieder zu.
»Ich bin sicher, ihr beide hattet nur das Beste für eure Herrin im Sinn«, sagte sie ruhig. »Was mehr ist, als ich über den Medikus sagen kann … oder über den Apotheker. Wie lange trinkt Frau Regula dieses Zeug schon?«
»Fast zwei Jahre«, antwortete die Köchin. Ihre Stimme war ein furchtsames Flüstern; ihr schien aufzugehen, dass sie und Birgitta der Herrin mit ihrer Komplizenschaft und ihrem Stillschweigen einen gefährlichen Bärendienst erwiesen hatten.
Fidelitas seufzte. »Bringt ihr erst einmal die Flaschen hinauf«, sagte sie. »Aber ich werde noch heute mit Herrn Stöcklin reden und ihm die Sache erklären.«
Die Köchin öffnete alarmiert den Mund, und Fidelitas hob die Hand.
»Ich werde ihm begreiflich machen, dass ihr getäuscht worden seid – genauso wie Frau Regula. Keiner von euch konnte ahnen, dass das, was ihr für eine Medizin gehalten habt, nichts anderes war als ein schleichendes, stümperhaft zusammengepanschtes Gift.«
»Es tut mir so leid!« Die Augen von Birgitta standen plötzlich voller Tränen. »Wir … wir wollten ihr doch nicht schaden!«
»Das weiß ich.« Fidelitas lächelte beruhigend. »Und ich werde Herrn Stöcklin gegenüber keinen Zweifel daran lassen, das verspreche ich euch.«
Trotz ihres Zornes auf den verantwortungslosen Kurpfuscher, der zum erbarmungswürdigen Zustand ihrer Patientin so entscheidend beigetragen hatte, fühlte sie sich gleichzeitig unendlich erleichtert.
Frau Regula mochte einen schweren Weg vor sich haben, aber mit Gottes Beistand konnte sie ihr wahrscheinlich helfen.