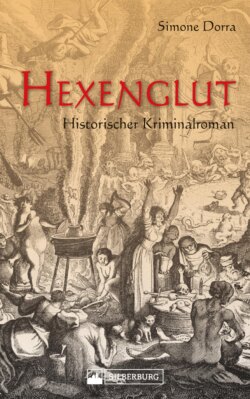Читать книгу Hexenglut. Historischer Kriminalroman. - Simone Dorra - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
… und nichts ohne Gift
ОглавлениеIm Speisezimmer des Hauses von Vinzenz Stöcklin herrschte Totenstille. Fidelitas stand mit dem Rücken zum Fenster. Der Kaufmann saß am Tisch, das Gesicht bleich und verkniffen.
»Ich müsste ja eigentlich erleichtert sein«, meinte Stöcklin endlich. »Es sollte mich freuen, dass meine Frau nicht so krank ist, wie ich die ganze Zeit gefürchtet habe. Aber jetzt sagt Ihr mir, dass sie seit Langem eine Arznei zu sich nimmt, die sie langsam vergiftet? Und dass sie es vorgezogen hat, mir das zu verschweigen?« Er sprach leise und mühsam beherrscht. »Das … das ist ungeheuerlich.«
»Ich kann mich natürlich irren.« Fidelitas blickte auf ihre gefalteten Hände hinunter. »Aber ich habe das Gebräu überprüft. Glaubt mir – wer das, was darin ist, zwei Jahre lang in den Mengen trinkt, wie Eure Frau es zweifelsohne getan hat, der fügt sich selbst mehr Schaden zu als manches schwere Leiden.«
Stöcklin starrte sie an. »Das will mir nicht in den Kopf. In vielen Medizinen ist Branntwein, und Mohnsaft hilft doch gegen Schmerzen – oder nicht?«
»Das ist richtig.« Fidelitas nickte. »Aber ›alle Ding sind Gift und nichts ohn Gift – allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist‹. Das hat der große Medikus Paracelsus gesagt … und meine Lehrmeisterin im Kloster hat in ihren Aufzeichnungen von einer jungen Mitschwester berichtet, die sich einmal bei einem unglückseligen Sturz mehrere Knochen brach. Es hat Monate gedauert, bis alles einigermaßen verheilt war, und sie hatte schreckliche Schmerzen. Also bekam sie zur Linderung Mohn und in Branntwein gelöste Kräuter. Sehr viel davon und sehr regelmäßig. Die haben sie ebenso apathisch und kraftlos gemacht wie Frau Regula. Und auch, als sie wieder auf den Beinen war und im Infirmarium keinerlei Heilmittel mehr bekam, ist es ihr nicht wirklich besser gegangen.«
Stöcklin runzelte die Stirn. »Worauf wollt Ihr hinaus? Wenn Ihr mir Hoffnungen machen wollt, dann müsst Ihr Euch schon ein wenig mehr anstrengen, fürchte ich.«
Fidelitas holte tief Luft. »Die Geschichte ist noch nicht vorüber. Agatha – so hieß meine Lehrmeisterin – schrieb, dass sie nach einiger Zeit etwas Verblüffendes entdeckte: ihre Vorräte an Mohnsaft und Kräutertränken mit Branntwein nahmen auf rätselhafte Weise ab, obwohl sie genau Buch führte. Flaschen waren plötzlich halb leer, Phiolen verschwanden. Sie hat sich auf die Lauer gelegt und herausgefunden, dass es ausgerechnet die junge Schwester war, die sie in aller Heimlichkeit bestahl. Nachdem sie ertappt worden war und befragt wurde, hat sie Agatha und der Ehrwürdigen Mutter Oberin gestanden, dass sie ohne diese Heilmittel nicht mehr zurechtkäme … obwohl es die Knochenbrüche längst nicht mehr gab. Sie sagte, dass sie sie trinken müsse, um sich besser zu fühlen.«
Der Kaufmann starrte sie an. »Wollt Ihr mir allen Ernstes weismachen, meine Frau hängt an dem Zeug in diesen Flaschen wie – wie ein alter Trunkenbold im Wirtshaus an seinem Schnapskrug?«
Fidelitas biss sich auf die Lippen. »Das ist sehr … unbarmherzig ausgedrückt, Herr Stöcklin. Aber ich fürchte, genauso ist es.«
Vinzenz Stöcklin ließ sich mit einem Ruck in seinen Stuhl zurücksinken. Das Holz knarrte laut.
»Und was, wenn Ihr Euch doch irrt? Wenn meine Frau trotz Eurer Annahme unter einer schweren Krankheit leidet, die Ihr bloß noch nicht gefunden habt?«
»Dann«, sagte Fidelitas ruhig, »werde ich weiterforschen müssen. Aber bis dahin wird Frau Regula von mir nichts bekommen, was ihr noch weiter schadet. Im Gegenteil – ich werde dafür sorgen, dass sie das Mittel, auf das sie sich bisher verlassen hat, nicht mehr trinken kann. So finden wir am ehesten heraus, ob ich recht habe.«
Sie betrachtete ihr Gegenüber forschend.
»Die Köchin und die Zofe Eurer Tochter haben mir gesagt, Ihr hättet den Medikus, der diese Arznei für Frau Regula zusammengerührt hat, aus dem Haus gejagt. Darf ich wissen, was der Grund dafür war?«
Der Mund des Kaufmannes wurde schmal. Es dauerte eine Moment, bis er antwortete.
»Michel Sebald hat viele Monate hindurch seine Heilkünste an meiner Frau versucht«, sagte er langsam. »Und er hat sich reichlich dafür bezahlen lassen. Versteht mich recht: Wäre er imstande gewesen, Regula zu helfen, ich hätte ihm mein halbes Vermögen dafür geschenkt, und mit Freuden. Ehe er auftauchte, verkühlte sie sich schwer – vor etwas mehr als zwei Jahren, als wir einen besonders strengen Winter hatten. Davon hat sie sich seither nicht mehr richtig erholt, und zuerst war ich dankbar, als er kam und behauptete, er könnte sie wieder gesund machen.«
Fidelitas hob die Augenbrauen. »Hat er einfach bei Euch angeklopft und seine Dienste angeboten?«
»Natürlich nicht!« Vinzenz Stöcklin schnaubte. »Ich bin doch kein Simpel, der auf jeden dahergelaufenen Kurpfuscher hereinfällt! Nein – unser alter Medikus war gestorben, und Sebald hatte sein Amt übernommen. Soweit ich das beurteilen kann, hat er sich ordentlich um die Leute gekümmert … Klagen sind mir jedenfalls keine zu Ohren gekommen. Ich hab ihn rufen lassen, als der Zustand meiner Frau sich nicht bessern wollte, und von dem Moment an war er fast täglich im Haus.«
»Ich verstehe.« Fidelitas ging zum Tisch hinüber und setzte sich. »Aber irgendwann müsst Ihr alles Zutrauen in seine Fähigkeiten verloren haben … Sonst hättet Ihr ihm wohl kaum die Tür gewiesen.«
Der Mund des Kaufmanns verzog sich zu einem schwachen, freudlosen Lächeln.
»Meine Mutter hat angefangen, sich darüber zu beklagen, wie viel Geld die Mittel, Pülverchen und Tränke kosteten, mit denen er Regula traktierte«, sagte er. »Wie gesagt – ich hätte ihn trotzdem weiter gewähren lassen und gut bezahlt, wenn ich nur gesehen hätte, dass meine Frau sich wirklich erholt. Aber das war leider nicht der Fall. Im Gegenteil: je länger Sebald sich um sie kümmerte, desto schwächer, kraftloser und gleichgültiger wurde sie. Also hab ich beschlossen, etwas genauer hinzuschauen.«
Er umfasste mit beiden Händen die Tischkante, als suchte er daran Halt.
»Irgendwann fiel mir auf, dass er seine Aufmerksamkeit nicht nur auf meine Frau richtete. Er … er fing an, dem weiblichen Gesinde nachzustellen. Veronikas Zofe, zum Beispiel.«
Fidelitas nickte; sie erinnerte sich daran, was Birgitta ihr an diesem Morgen unten in der Küche erzählt hatte.
»Als Nächstes begann er, auch Veronika mit begehrlichen Augen anzusehen. Erst vorsichtig, damit ich es nicht merke, dann ganz unverhohlen, mehr als einmal. Sie hat mir gesagt, dass sie sich vor ihm fürchtet. Und ein paar Tage später … da hab ich ihn auf frischer Tat ertappt. Beim Diebstahl, mit den Fingern in meiner eigenen Goldschatulle. Er war wohl zu gierig geworden. Ich hab ihn am Kragen gepackt, die Treppe hinuntergezerrt und hinausgeworfen. Dann hab ich den Kutscher mit einer Nachricht zum Rat der Stadt geschickt. Doch als die Büttel zu seinem Haus kamen, hatte er sich bereits aus dem Staub gemacht.«
Er seufzte.
»Ich hätte ihn wohl besser erst einmal in den Keller gesperrt. Aber wenigstens hat meine Tochter keinen Schaden genommen.«
»Eure Frau schon«, sagte Fidelitas leise.
»Das ist mir jetzt auch klar.« Vinzenz Stöcklin seufzte wieder, dann sah er ihr in die Augen. »Versprecht Ihr mir, dass sie wieder gesund wird?«
»Ich verspreche Euch, alles dafür zu tun, was ich kann«, erwiderte Fidelitas. »Es wird sicherlich nicht einfach werden – die junge Mitschwester damals hat elend schwere Wochen durchlebt, bevor es endlich wieder aufwärtsging mit ihr. Aber irgendwann war sie tatsächlich vollkommen wiederhergestellt. Wir wollen Gott vertrauen und darauf hoffen, dass es Eurer Frau genauso geht.«
Fidelitas sollte recht behalten; die nächsten Wochen wurden wahrhaftig elend schwer.
Vinzenz Stöcklin nahm es nach ihrem Gespräch auf sich, seiner Frau zu erklären, was es mit dem angeblichen Stärkungstrank des betrügerischen Medikus auf sich hatte. Der Inhalt der beiden letzten Flaschen wurde draußen vor dem Haus in die Gosse geleert; ab sofort durfte die Kranke nur noch Quellwasser und mit Honig gesüßte, warme Kräutertränke zu sich nehmen.
In den ersten Tagen behielt sie sowieso kaum etwas bei sich. Sie übergab sich wieder und wieder, schwitzte heftig und behauptete, sie würde verbrennen. Im nächsten Moment klapperte sie mit den Zähnen vor Kälte; ihre Haut war kalt und feucht. Die wenigen Stunden, in denen sie schlief, waren von Albträumen erfüllt, und ihre wachen Momente waren kaum besser. Sie sah Gesichter, die gar nicht da waren, und stammelte etwas von »teuflischen Fratzen«, die aus den Wänden herausträten und sie böse angrinsten. Dann schrie sie auf, klammerte sich an Fidelitas oder ihren Mann – je nachdem, wer von beiden bei ihr saß -, zitterte wie im Fieber und weinte verzweifelt.
Zwar war es vorrangig Fidelitas' Aufgabe, sich um Regula zu kümmern, aber sie war dankbar dafür, dass Vinzenz Stöcklin sich standhaft weigerte, ihr das ganz und gar allein zu überlassen. Denn Regulas Unruhe und ihre Angstzustände machten ihre Pflege aufwendig und überaus anstrengend, auch wenn Fidelitas kaum mehr für sie tun konnte, als ihr immer wieder Flüssigkeit einzuflößen, damit sie nicht austrocknete. Sie wusch Regulas zerbrechlich abgemagerten Körper mit einer Mischung aus Pfefferminzöl und warmem Wasser und hüllte ihn in Wolldecken. Mehr als einmal nickte sie bei den Stundengebeten ein und beruhigte ihr Gewissen damit, dass sie ohnehin ständig Zwiesprache mit ihrem Schöpfer und sämtlichen Heiligen hielt, wenn sie für Regula um Hilfe und Segen bat.
Gundis Stöcklin ließ sich kaum am Krankenbett ihrer Schwiegertochter blicken. Fidelitas wusste, dass Vinzenz Stöcklin ihr erklärt hatte, worunter Regula vermutlich litt, aber die Verachtung, die Gundis seiner Frau gegenüber an den Tag legte, war ihr noch frisch im Gedächtnis. Obendrein hielt Gundis Veronika gezielt von Regula fern. Als Fidelitas das junge Mädchen in ihrer Gegenwart freundlich dazu einlud, die Kranke zu besuchen, reagierte die alte Dame mehr als frostig.
»Die üblen Dünste in der Stube könnten ihr schaden«, sagte sie kurz und bündig. »Und sie hat Besseres zu tun, als den traurigen Wahn ihrer Mutter mit anzusehen … den die sich noch dazu selbst eingebrockt hat.«
Veronika wurde blass, erhob aber gegen diese offene Lieblosigkeit keinen Einspruch und fügte sich. Wieder einmal rätselte Fidelitas, wie viel eigener Wille und wie viel Kraft hinter dem hübschen Gesicht mit den niedergeschlagenen Augen steckten; sonderlich viel konnte es nicht sein. Allerdings hatte sie wenig Muße, sich länger darüber den Kopf zu zerbrechen. Sie musste sich wieder Regula widmen und Vinzenz Stöcklin Mut machen, den der Zustand seiner Frau zunehmend in Angst und Schrecken versetzte.
»Seid Ihr sicher, dass sie nicht vom Teufel besessen ist?«, fragte er eines Nachts auf dem stillen Flur, während Regula sich nebenan stöhnend in ihrem Bett hin und her warf. Im Licht der Kerze in dem kleinen Messinghalter, den Fidelitas bei sich trug, war sein Gesicht bleich und erschöpft, und sie sah, dass seine Hände bebten.
»Das ist nicht der Teufel«, erwiderte sie sanft. »Das ist ihre Krankheit. Nicht nur der Körper verlangt noch nach dem Gift, das sie ihm so lange zugeführt hat – auch der Geist leidet an dieser unseligen Gier. Der Schwester damals in unserem Kloster ist es genauso ergangen, meine Lehrmeisterin hat das in ihren Aufzeichnungen in allen Einzelheiten geschildert. Wir müssen – ebenso wie Eure Frau – nur noch eine kleine Weile durchhalten, dann ist es vorbei.«
»Aber sie ist so furchtbar geschwächt.« Fidelitas konnte selbst im Licht der Kerze die Furcht in seinen Augen überdeutlich erkennen. »Wird sie es denn wirklich überstehen? Sagt mir die Wahrheit – bitte!«
»Das weiß ich nicht«, sagte sie ehrlich. Sie hätte es sträflich gefunden, diesen guten Mann anzulügen. »Wir müssen hoffen und beten, dass ihre Kraft ausreicht. Ich tue seit Tagen nichts anderes.«
»Ihr tut viel mehr als das.« Jetzt war seine Stimme sanft. »Ich bin unendlich dankbar dafür, dass Ihr Euch bereit erklärt habt, mich nach Freiburg zu begleiten. Ich wüsste nicht, was ich in dieser Lage ohne Euch täte.«
»Ohne mich wärt Ihr doch gar nicht in dieser Lage«, konterte Fidelitas müde. »Immerhin ist es mein Einfall gewesen, Eure Frau dieser gefährlichen Rosskur auszusetzen. Und Ihr zahlt jetzt den Preis dafür.«
Er schüttelte entschieden den Kopf. »Ohne Euch würde meine Regula weiter vor sich hin siechen und jeden Tag ein wenig mehr sterben.« Er brachte es irgendwie fertig, sie anzulächeln. »Jetzt ist sie dank Gottes Gnade und Eurer Mithilfe vielleicht irgendwann wieder die Frau, die ich einmal geheiratet habe.«
Fidelitas wollte antworten, als ihr auffiel, dass es nebenan in Regulas Zimmer still geworden war – kein unablässiges Quietschen und Knarren des hölzernen Bettrahmens mehr, und das Stöhnen war verstummt. Schlief die Kranke endlich ein wenig ruhiger? Hatten die entsetzlichen Träume aufgehört? Oder war sie etwa …
Sie streckte die Hand nach der Klinke aus, von jäher Sorge gepackt. Und dann drang von jenseits der Tür eine schwache Stimme an ihr Ohr.
»Vinzenz …? Schwester …?«
Der Kaufmann fuhr heftig zusammen, machte förmlich einen Satz und riss im nächsten Moment die Tür weit auf. Fidelitas folgte ihm auf dem Fuß, den kleinen Halter mit der Kerze hoch erhoben.
Regula lag auf ihrer Matratze ausgestreckt, den Kopf in ihre Richtung gewandt. Das grau gesträhnte Haar war verwirrt und schweißnass, aber ihr bleiches Gesicht sah im schwachen Licht der einzelnen Flamme entspannt aus, und zum ersten Mal seit Tagen waren ihre Augen ruhig und klar.
Von Vinzenz Stöcklin kam ein erstickter Laut, eine Mischung aus Staunen und fassungsloser Erleichterung. In der nächsten Sekunde beugte er sich über seine Frau, streichelte ihre Wange und küsste sie auf die Stirn.
Fidelitas trat an das Bett, stellte den Kerzenhalter auf den Nachtkasten und griff nach Regulas Handgelenk. Unter ihrem Daumen konnte sie den Puls fühlen. Es war ein sachter, steter Rhythmus, der sie mit freudiger Hoffnung erfüllte.
»Wie geht es Euch?«, fragte sie leise.
»Ich weiß nicht recht …«, murmelte Regula. »Ich fühl mich furchtbar zerschlagen. Aber … aber ich glaube fast, ich habe ein klein wenig Hunger.«
Fidelitas lächelte.
»Irmhild hat unten in der Küche schon den ganzen Tag einen Topf mit Brühe auf dem Herd«, sagte sie. »Ich werde Euch sofort etwas davon bringen.«
Sie ging rasch hinaus und machte sich auf den Weg die Treppe hinab, jeder Schritt federleicht.
Deo gratias, dachte sie. Danke, oh Herr … dafür, dass du in deiner unendlichen Gnade mir ebenso beigestanden hast wie ihr.
Von dieser Nacht an ging es aufwärts. Zwar erholte Regula sich nur langsam, aber die Albträume schwanden ebenso wie ihre Schreckensvisionen. Sie gewann ihren Appetit zurück, und Irmhild, die Köchin, bereitete für sie leichte Suppen und Gemüse zu, nachdem sie sich bei Fidelitas Rat geholt hatte, welche Kräuter sie hinzufügen sollte, um ihre Herrin zusätzlich zu stärken.
Die ganze Stimmung im Haus änderte sich. Je besser es Regula ging, desto fröhlicher wurde die Dienerschaft, desto aufrechter die Haltung von Vinzenz Stöcklin und desto zugänglicher seine Tochter. Nachdem Regula zum ersten Mal das Bett verlassen und einen kleinen Spaziergang unternommen hatte, saß Veronika täglich bei ihr; das Verbot ihrer Großmutter schien sie nicht länger zu kümmern.
Das Verhalten von Gundis stellte Fidelitas vor ein Rätsel. Bei ihrer Ankunft in Freiburg hatte die Strenge der alten Frau über dem Haus gehangen wie eine dunkle Wolke. Die Dienerschaft hatte nur mit gesenkter Stimme über sie gesprochen, als fürchteten die Leute, sie könnte sie belauschen, und ihre Familie hatte ihr offenbar wenig entgegenzusetzen. Aber jetzt ließ Gundis sich kaum noch blicken, und ihre scharfe, fordernde Stimme schien fast verstummt zu sein. Oder aber ihre Umgebung war nicht länger bereit, ihr zu gehorchen.
»Und das wundert Euch?«, sagte Heinrich Stöcklin kurz darauf zu ihr. »Ihr habt das Gleichgewicht in diesem Haus verändert, und das ist das Ergebnis.«
Fidelitas saß nach dem Abendessen bei ihm in seinem bücherduftenden Rückzugsort; seit Regula nicht mehr ständige Aufsicht brauchte, besuchte sie Vinzenz Stöcklins Vater häufig und genoss seine Gesellschaft ebenso sehr wie er die ihre. Jetzt musterte sie ihn stirnrunzelnd.
»Ich verstehe nicht, was Ihr meint. Wie soll ich das denn angestellt haben?«
»Ganz einfach – dank Euch wird Regula endlich gesund«, meinte er. »Und sobald sie wieder den Platz im Haus einnehmen kann, der ihr zusteht, wird meine Frau zwangsläufig ihre Macht verlieren.«
Der alte Herr lächelte sie an. Er hatte es sich in seinem Lesesessel am Fenster gemütlich gemacht, und seine Augen blinzelten humorvoll durch die in Horn gefassten Gläser, die mithilfe einer weichen, geschlitzten Lederpolsterung um den Bügel fest auf seiner Nase saßen.
»Meiner armen Gundis ist es immer schon schwergefallen, etwas, das sie einmal in den Händen gehalten hat, wieder loszulassen«, erklärte er. »Als es mir nach vielen Jahren harter Arbeit endlich gelungen war, meinen Platz unter den Kaufleuten dieser schönen Stadt zu finden, ist das ein großer Triumph für sie gewesen. Doch seither wird sie von der ständigen Angst geplagt, das Glück könnte eines Tages ein unzeitiges Ende nehmen – durch Raub, Betrug oder Ungeschick im Handel. Und eines muss man ihr lassen: Was den Handel angeht, war sie immer die Klügere von uns beiden. Nun ja – vielleicht ist sie ja auch einfach nur gerissener als ich.«
Er gluckste.
»Und sie wollte und will immer alles unter Kontrolle haben – die Bücher überwachen, mit den Gerbern und Tuchmachern verhandeln und am liebsten jedes Goldstück selbst in die Truhen legen. Ich hab sie gewähren lassen. Vielleicht ist das ein Fehler gewesen … Denn als ich mein Geschäft an Vinzenz übergeben habe, musste sie gemeinsam mit mir aufs Altenteil. Das hat ihr deutlich weniger geschmeckt als mir.«
Er nahm die Augengläser ab und rieb sich die kleine Druckstelle auf dem Nasenrücken, bevor er sie wieder aufsetzte.
»Vinzenz stellt sich gottlob genauso geschickt an wie sie. Und Regula … Ehe sie vor etwas mehr als zwei Jahren krank wurde, ist sie eine gute Hausherrin gewesen, freundlich zum Gesinde und streng nur dort, wo es darauf ankam. Die Dienerschaft hat sie geliebt. Aber dann zog sie sich durch ihr Leiden immer mehr zurück. Ich wollte – und konnte – mir die Last unseres Geschäfts nicht mehr auf meine Schultern laden, also war Vinzenz darauf angewiesen, dass Gundis hier wieder das Ruder übernahm. Sonst hätte er nicht reisen und in Frankreich oder Italien die besten Stoffe einkaufen können … und ein Tuchhändler, der keine Tuche mehr anzubieten hat, geht irgendwann am Bettelstab.«
Fidelitas nickte langsam. Sie erinnerte sich gut daran, was die Äbtissin zu ihr über Vinzenz Stöcklin und seine Mutter gesagt hatte. Er brennt darauf, ihr die Zügel wieder aus der Hand zu nehmen. So schnell wie möglich.
»Seid Ihr nie auf die Idee gekommen, Eure Frau in die Schranken zu weisen?«, wollte sie wissen – und biss sich gleich darauf auf die Lippen. »Ich bitte um Vergebung. Es steht mir nicht zu …«
»Gewiss nicht.« Heinrich Stöcklin lachte leise. »Platzt Ihr immer mit allem heraus, was Ihr denkt? Das dürfte Euch im Kloster Schwierigkeiten machen.« Fidelitas musste ihm im Stillen recht geben. »Es tut mir wirklich leid.«
»Aber wahr ist es trotzdem«, versetzte er. »Es ist bloß nicht gerade einfach, meine Gundis zu etwas zu bewegen, das sie nicht will. Sie ist so störrisch wie ein Maulesel. Und ich muss leider sagen, dass mir für einen heftigen Streit mit ihr heutzutage die Kraft fehlt. Nicht nur mein Augenlicht hat nachgelassen, auch mein Herz ist mit den Jahren ein wenig … müde geworden.«
Fidelitas starrte ihn an. »Ihr seid krank? Das wusste ich nicht – warum habt Ihr denn nichts gesagt?«
»Weil Ihr mit Regula sowieso schon alle Hände voll zu tun hattet«, meinte Heinrich Stöcklin gelassen. »Ich habe einen Apotheker, der mich zuverlässig mit Fingerhutessenz versorgt. Die Rezeptur stammt noch von dem alten Medikus vor dem unseligen Michel Sebald, dem wir Regulas ›Heilmittel‹ verdanken. Und der Apotheker ist ein alter Freund, dem ich vertraue … nicht der Panscher, bei dem die Zofe und die Köchin immer die Flaschen mit diesem Teufelszeug geholt haben.«
Und der an Regulas Leiden wahrscheinlich ebenso gut verdient hat wie Sebald, dachte Fidelitas.
»Trotzdem: Falls ich Euch in irgendeiner Weise helfen kann, sagt es mir«, meinte sie. »Solange ich noch hier bin, meine ich.«
»Aber gewiss.« Die Augen des alten Herrn funkelten verschmitzt. »Und Ihr habt mir schon geholfen, Schwester. Mit einer gesunden Regula an seiner Seite wird es Vinzenz viel leichter fallen, sich gegen Gundis durchzusetzen. Das gibt ihm mehr Selbstvertrauen. Und es wird meinem willensstarken Weib bestimmt nicht schaden, ein wenig zurückzustecken. – Habt Ihr eigentlich das Münster schon besucht?«
Fidelitas schüttelte den Kopf. »Nein. Mir hat bisher die Zeit gefehlt.«
»Das müsst Ihr unbedingt nachholen.« Die Stimme von Heinrich Stöcklin wurde lebhaft. »Es hat mehr als dreihundert Jahre gedauert, es zu errichten, und noch immer wird daran gebaut … Im Moment entsteht gerade eine neue Vorhalle, an der Südfassade.«
Er lachte.
»Der Freiburger Rat hat vor achtzig Jahren schon darüber geklagt, dass das Chorgewölbe viel zu kostspielig und immer noch nicht fertig war … und vor fünfundvierzig Jahren Gott dafür gedankt, dass der letzte Stein endlich eingefügt worden ist. Ihr seht, nicht nur meine Gundis schaut geizig auf jeden einzelnen Gulden.«
»Ihr habt recht.« Fidelitas erhob sich. »Ich muss unbedingt dorthin; vielleicht habe ich morgen endlich die Gelegenheit dazu.«
Sie lächelte Heinrich Stöcklin an, verneigte sich und ließ ihn mit seinen Büchern allein. Als sie kurze Zeit später in ihrem Zimmer die Laudes gesprochen hatte und vor dem Schlafen noch ein wenig in ihrem Buch mit den Kräuterrezepten der Hildegard von Bingen blättern wollte, das sie aus Frauenalb mitgebracht hatte, stellte sie fest, dass sie es wohl bei Irmhild in der Küche vergessen haben musste. Seufzend machte sie sich mit ihrer Kerze auf den Weg nach unten, so lautlos wie möglich, um den Rest der Familie, der sich längst zurückgezogen hatte, nicht zu stören.
In der stillen, leeren Küche führte das Licht der Kerzenflamme sie zum sauber geschrubbten Tisch, auf dem das Buch noch immer lag, und sie steckte es in die Tasche ihrer Tunika. Als sie auf dem Rückweg an der Haustür vorbeikam, hörte sie erst ein leises Kratzen und dann das unverkennbare Klirren eines Schlüssels, der ins Schloss gesteckt wurde. Das kam von draußen. Sie blieb stehen und blies instinktiv die Kerze aus.
Dann trat sie zur Seite und wartete, den eigenen Herzschlag als rasches Hämmern in den Ohren. Die Haustür quietschte und öffnete sich, erst einen kleinen Spalt, dann weiter. Vor wenigen Minuten hatte die Turmuhr des Münsters zehn geschlagen, und das schwache Restlicht der Abenddämmerung zeigte ihr eine schlanke, zierliche Gestalt, die hereinschlüpfte und die Tür vorsichtig wieder hinter sich zuzog. Mit einem Klicken wurde der Riegel vorgelegt, dann hörte sie, wie jemand tief und erleichtert durchatmete.
Fidelitas machte einen raschen Schritt vorwärts, streckte die Hand aus und bekam weichen Stoff zu fassen. Ein leiser Schreckensschrei und ein panisch geflüstertes »Heilige Mutter Gottes!« Fidelitas schnappte verblüfft nach Luft, als sie die Stimme erkannte.
»Veronika? Wieso seid Ihr so spät noch unterwegs – und wo seid Ihr gewesen?«
Sekundenlange Stille, dann ein schwerer Seufzer.
»Das … das kann ich Euch nicht sagen. Aber bitte, bitte … verratet mich nicht!«
Fidelitas überlegte.
»Ich werde Euch nichts versprechen«, erwiderte sie endlich. »Nicht, ehe ich weiß, wieso Ihr Euch zu einer Zeit ins Haus schleicht, in der jede vernünftige Jungfer längst in ihrem Bett liegen sollte.«
Sie ließ Veronikas Mantel los und nahm ihren Arm.
»Kommt mit mir hinunter in die Küche; es ist bestimmt noch etwas Glut im Herd, an der ich meine Kerze anzünden und Euch ansehen kann, während wir miteinander reden.«