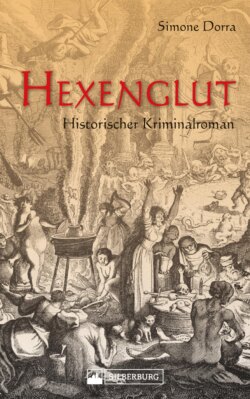Читать книгу Hexenglut. Historischer Kriminalroman. - Simone Dorra - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zuflucht im Kloster
ОглавлениеDas Erste, was ihm auffiel, als er langsam wieder zu sich kam, war ein leichter, aber deutlicher Duft nach Kräutern. Er erfüllte seine Sinne, während er mit geschlossenen Augen dalag, noch nicht ganz bei Bewusstsein, und die Eindrücke seiner Umgebung bruchstückhaft in sich aufnahm: ein kühles, glattes Laken unter seinem Körper; leiser Frauengesang in der Ferne, sanft auf- und absteigend mit einer beruhigend gleichförmigen Melodie; der dumpfe Schmerz in seinem rechten Bein, deutlich stärker als das Pochen und Stechen in seinem Kopf; und über allem das starke, bittersüße Aroma von Engelwurz.
Er blinzelte und sah, dass er tatsächlich in einem Bett lag. Das Bett stand in einem großen, lichtdurchfluteten Raum. Gleich mehrere Spitzbogenfenster ließen die Sonne ein, und er entdeckte ein halbes Dutzend weiterer Betten, schlicht aus Holz zusammengezimmert und bis auf eines alle leer. In dem lag ein älterer Mann. Er schien zu schlafen, aber was immer es auch für ein Leiden war, das ihn quälte, es hatte tiefe Linien in sein bleiches Gesicht gezeichnet, die auch der Schlaf nicht tilgen konnte.
Was war das hier? Wo war er bloß hingeraten?
Er machte den Versuch, sich aufzusetzen, und sank hilflos wieder auf das Laken zurück. In seinem Kopf drehte sich alles, seine Ohren klingelten, und ihm war übel. Er versuchte, sich die Ereignisse der vergangenen Stunden ins Gedächtnis zu rufen, stellte fest, dass er das nicht konnte, und fühlte sich noch elender. Er schloss die Augen wieder und hätte am liebsten geweint.
Das Dröhnen in seinem Kopf ertränkte die Schritte, die sich seinem Bett näherten, aber die leise, freundliche Stimme, die als Nächstes kam, übertönte es nicht.
»Seid Ihr wach, Herr? Könnt Ihr mich hören?«
Er tastete ziellos nach Halt; seine Hand wurde erfasst und in einem tröstlich warmen Griff festgehalten.
»Deo gratias – so ist's recht. Jetzt müsst Ihr mich nur noch anschauen und mit mir reden, dann habe ich eine Sorge weniger.«
Er öffnete die Augen einen Spaltbreit und sah, dass eine Frau auf einem niedrigen Schemel neben seinem Bett saß. Eine Nonne. Sie trug das schwarze Habit mit der weißen Haube, die ihr Gesicht eng einrahmte; ein kluges, eckiges Gesicht mit reiner, heller Haut, dessen Alter sich merkwürdigerweise nur schwer schätzen ließ. Vielleicht war sie Mitte zwanzig oder auch Anfang dreißig, er konnte es unmöglich sagen. Ihr Kinn sprang leicht vor, was von einer gewissen Sturheit sprach. Ihre Augen waren groß und von einem leuchtenden Haselnussbraun, in dem goldene und grüne Lichter tanzten.
»Wo … wo bin ich?«
Seine Stimme klang so heiser, als hätte er eine Handvoll Kieselsteine verschluckt.
»Ihr seid im Kloster Frauenalb, Herr«, sagte die Nonne. »Im Infirmarium, genauer gesagt. Unsere Knechte haben Euch letzte Nacht hergebracht, nachdem sie Euch fast in Sichtweite unseres Gasthofes besinnungslos aufgefunden haben. Ihr müsst böse gestürzt sein.«
»Ich …«
Plötzlich kehrte die Erinnerung zurück und traf ihn wie ein heftiger Schlag in die Magengrube. Das Gebrüll der Räuber, die ihm und seinem Wagen aufgelauert hatten … Ein wilder Tumult aus klirrenden Schwertern und Schmerzensschreien … Im Licht der fast untergegangenen Sonne zwei grässlich verkrümmte Leichen auf dem Waldboden … Und er war geflüchtet, als wäre ihm der Leibhaftige auf den Fersen.
»Wir wurden überfallen«, murmelte er. »Zwei der Wachen, die meinen Besitz schützen sollten, sind ermordet worden von dem Gesindel, das scharf war auf meine kostbaren Tuche und mein Gold. Die anderen beiden … Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben sind.« Er stellte fest, dass er am ganzen Leib zitterte. »Vielleicht sind sie ja auch tot.«
Die Nonne schüttelte den Kopf. Ihr Daumen strich beruhigend über seinen Handrücken. »Nein. Sie haben genauso hergefunden wie Ihr. Und von ihnen haben wir auch gewusst, dass wir nach Euch suchen müssen. Die Mutter Oberin hat sofort unsere Knechte ausgeschickt, und ich bin dankbar, dass sie Euch so schnell entdeckt haben. Ein gebrochenes Bein ist übel genug – nach einer Nacht im Wald hättet Ihr Euch vielleicht auch noch eine Lungenentzündung zugezogen, Herr Stöcklin.«
Er bewegte versuchshalber das rechte Bein … und biss sich auf die Lippen, als der Schmerz bis hinauf in seine Leiste schoss.
»Es ist ein sauberer Bruch«, meinte die Nonne beruhigend. »Er ist ordentlich geschient, und bislang habt Ihr noch kein Fieber. Wenn Ihr lange genug stillhaltet und es mit Gottes Hilfe zu keiner Entzündung kommt, seid Ihr in ein paar Wochen so gut wie neu.«
Plötzlich war er sehr erschöpft.
»Mein … mein Wagen? Was ist mit meinem Wagen?«
»Das wissen wir nicht«, erwiderte die Nonne. »Wir haben uns erst einmal um Euch und Eure Verletzung gekümmert. Aber ich vermute, dass die Männer, die Euch überfallen haben, den Wagen ebenso mitgenommen haben wie das Zugpferd.«
Sein Herz sank. Er versuchte, zu überschlagen, wie hoch der Verlust sein mochte, den er erlitten hatte, aber die Zahlen vollführten in seinem Kopf nur einen verwirrenden Tanz. Er schloss die Augen und seufzte.
»Waren kann man ersetzen, Herr Stöcklin.« Die Stimme der Nonne war sanft, aber bestimmt. »Ein verlorenes Leben nicht.«
Jetzt klang sie deutlich näher. Er spürte, wie die Decke über ihm glatt gestrichen wurde, und der vertraute Kräuterduft verstärkte sich.
»Meine Mutter hat mir immer Engelwurz gegeben«, murmelte er. »Wenn mich mal wieder der Magen gedrückt hat vom guten Essen unserer Köchin.«
»Dann hat Eure Frau Mutter sich gut ausgekannt.« Er konnte hören, dass sie lächelte. »Ich gebe Euch jetzt auch etwas: ein Tonikum aus Weidenrinde und Mohn. Das hilft gegen die Schmerzen, gegen das Fieber, und es sorgt für einen ruhigen Schlaf. Könnt Ihr Euch hinsetzen, was meint Ihr?«
Er stemmte sich mühsam hoch, und ein erstaunlich kräftiger Arm half ihm, sich aufrecht zu halten. Der Rand eines Bechers berührte seine Lippen. Er öffnete den Mund, trank gehorsam und verzog das Gesicht. Gallebitter. Dann wurde er behutsam wieder zurück in die Kissen gebettet.
Er hörte Stoff rascheln und schaffte es mit einiger Anstrengung, noch einmal die Augen zu öffnen. Die Nonne hatte sich erhoben und stand neben dem Bett, die Hände in den weiten Ärmeln ihres Habits.
»Ruht Euch aus«, sagte sie. »Ein paar Stunden Erholung, und die Welt ist gleich ein gutes Stück heller. Ein Bote ist schon nach Freiburg unterwegs, um Eure Familie zu benachrichtigen, damit sie sich keine Sorgen mehr um Euch machen muss.«
»Danke.« Er schluckte. »Vergelt's Gott, Schwester. Darf ich … darf ich wissen, wie Ihr heißt?«
Sie lächelte und verneigte sich leicht.
»Fidelitas«, sagte sie. »Ich bin die Kräutermeisterin von Frauenalb. Dominus vobiscum, Herr Stöcklin. Schlaft gut.«
Sie drehte sich um und war im nächsten Moment mit leisen Schritten durch die Tür verschwunden.
Zwei Monate gingen ins Land; es war ein ausgesprochen nasser Frühling. Auch in den letzten Tagen hatte es fast ununterbrochen geregnet. Doch jetzt hoben sich endlich die Wolken, die wie ein schwerer grauer Mantel über dem Albtal hingen, und die Sonne kam heraus. Der Himmel am Horizont zeigte ein verwaschen bleiches Blau, hoffnungsvoll wie das junge Laub an den Bäumen, das den nahenden Sommer ankündigte.
Fidelitas von Frauenalb stand auf dem Friedhof des Klosters; er lag in kleinem Abstand von der Kirche – immer noch dicht genug bei den lebenden Schwestern, dass die sterblichen Überreste der Nonnen, die hier zur Ruhe gebettet worden waren, ein Teil der Gemeinschaft blieben. Jedes Grab trug auf einem schlichten Stein den Namen der Frau, die hier der Auferstehung entgegenschlief.
Auf dem Stein des Grabes zu ihren Füßen war der Name Agatha zu lesen, darunter das Geburts- und das Sterbedatum 1553. Sechsunddreißig Jahre hatte Agatha in Frauenalb gelebt, erst als Postulantin, dann als Novizin und nach den ewigen Gelübden als Schwester unter Schwestern. Sie hatte vor Fidelitas dem Kloster erst als Infirmarin und zuletzt als Kräutermeisterin gedient; von ihr hatte die jüngere Nonne alles gelernt, was sie heute über Medizin und die Heilung von Kranken mit den Pflanzen wusste, die in den Klostergärten wuchsen. Fidelitas hatte Agatha fast ebenso sehr geliebt wie die Ehrwürdige Mutter Scholastika, die ihr in Frauenalb ein Zuhause gegeben hatte, nachdem sie mit noch nicht einmal zehn Jahren hierhergekommen war, als Oblate in einem Pferdewagen, möglichst weit außer Sicht verfrachtet von einem Vater, der nicht bereit war, sie öffentlich als seine Tochter anzuerkennen.
Fidelitas' ewige Profess hatte Mutter Scholastika nicht mehr miterleben dürfen, und die nächste Äbtissin, Catharina von Remchingen, war dem Schützling ihrer Vorgängerin mit Misstrauen und instinktiver Abneigung begegnet. Als die Gräfin Johanna von Eberstein – Mäzenin des Klosters und Mitglied des Adelsgeschlechts, von dem das Kloster im zwölften Jahrhundert gegründet worden war – vor fünf Jahren darauf bestanden hatte, Fidelitas als private Pflegerin auf eine Reise mitzunehmen, war sie bei der Mutter Oberin auf bemerkenswert wenig Widerstand gestoßen.
Als Fidelitas nach neun Wochen von dieser – mehr als turbulenten – Reise in den Schoß ihrer Klosterfamilie zurückgekehrt war, neigte sich die Herrschaft der Catharina von Remchingen bereits dem Ende entgegen. Natürlich hatte das keiner von ihnen geahnt – aber im November 1550 zog die Äbtissin sich eine schwere Erkältung zu, die sich in ihren Lungen festsetzte und der sie kurz vor Weihnachten erlag.
Katharina II. von Wittstadt – genannt »die Hagenbachin« – hatte ihre Stelle als Ehrwürdige Mutter eingenommen, aber in den wenigen Jahren, während derer sie das Kloster führte, war es ihr kaum gelungen, einen prägenden oder wenigstens angenehmen Eindruck zu hinterlassen. Im Sommer 1554 war sie ganz plötzlich verstorben. Fidelitas vermutete bis heute ein Magenleiden, war aber mangels der nötigen Überprüfung auf Spekulationen angewiesen. Die Hagenbachin hatte ihr verantwortungsvolles Amt zuallererst als Werkzeug zur Mehrung ihres persönlichen Wohlstandes missverstanden; mehr als eine Abgabe der klösterlichen Lehenshöfe war stillschweigend in ihre persönliche Schatulle gewandert. Obendrein hatte sie ausgesprochen gern und reichlich gegessen – viel zu gern und viel zu reichlich, und Fidelitas hatte immer wieder versucht, ihr behutsam zuzureden, sie möge um ihrer Gesundheit willen und als Vorbild für ihre Töchter doch etwas mehr Maß halten.
Während die Mutter Oberin unbelehrbar der Sünde der Völlerei frönte, hatte Fidelitas' Lehrmeisterin Agatha zusehends den Appetit verloren. Im Frühjahr 1553 tat sie, geschwächt und abgemagert zu einem bloßem Schatten ihrer selbst, ihren letzten Atemzug, tief betrauert von Fidelitas und ihren Mitschwestern, deutlich tiefer jedenfalls als die Hagenbachin, die Agatha nur um dreizehn Monate überlebte.
Und nun war seit wenigen Monaten die dritte Katharina am Ruder, eine Freifrau von Bettendorf und die Schwester des Bischofs Dietrich von Worms. Sie war erst ein knappes Jahr vor dem Ableben ihrer Vorgängerin nach Frauenalb gekommen – eine energische Frau, hochgewachsen und so schmal wie eine Schwertklinge, mit harten Gesichtszügen, hinter denen sich eine unvermutete Güte verbarg, gepaart mit großer Klugheit. Fidelitas hatte sich auf Anhieb gut mit ihr verstanden, und als Katharina das Amt der Äbtissin übernahm, atmete sie ebenso erleichtert auf wie die anderen Nonnen. Dies war eine Ehrwürdige Mutter, die ebenso gut führen konnte wie ihre geliebte Mentorin Scholastika und die dabei das Wohl ihrer Töchter und das des Klosters gleichermaßen fest im Auge behielt.
Fidelitas senkte den Kopf und sprach das Gebet, das sie jedes Mal wiederholte, wenn sie hierherkam: Requiem aeternam dona ei, Domine: et lux perpetua luceat ei. Sie beugte sich vor und legte das mitgebrachte Kräutersträußchen aus Bärlauch, Huflattich und Schlüsselblumen vor Agathas Grabstein ab. Ich vermisse dich, dachte sie. Möge Gott dir die ewige Ruhe schenken und das ewige Licht über dir leuchten lassen. Und mögen wir uns im Kräutergarten der Mutter Gottes wiedersehen.
»Schwester …? Schwester Fidelitas?«
Fidelitas wandte den Kopf und sah Margaretha auf sich zukommen, das Habit gerafft, um auf dem unebenen Friedhofspfad nicht über den Saum zu stolpern. Margaretha stolperte ständig – über Betschemel, Gartenharken, Türabsätze und alles andere, das ihr unglückseligerweise in den Weg geriet. Sie befand sich im dritten Jahr ihres Noviziats und würde vermutlich auch über den Wortlaut der ewigen Gelübde stolpern … aber ablegen würde sie sie trotzdem, denn bei allem Ungeschick konnte es an ihrem hingebungsvollen Glauben nicht den Hauch eines Zweifels geben.
Es spielte keine Rolle, dass sie im Dienst bei der Schwester Mesnerin einen ganzen Kessel Bienenwachs verschüttet und sich dabei gefährlich verbrannt hatte. Es war auch gleichgültig, dass Schwester Saporosa, die seit dreißig Jahren in der Klosterküche für das leibliche Wohl der Nonnen sorgte, sich standhaft weigerte, Margaretha irgendetwas in die Hand zu geben, das schärfer war als ein Holzlöffel. Die neunzehnjährige Novizin war freundlich, mitfühlend und humorvoll und unter den Schwestern trotz ihrer Tollpatschigkeit ausgesprochen beliebt. Ihr sonniges Gemüt hatte ihr geholfen, die Tatsache zu verkraften, dass ihr Vater – ein kleiner Landjunker mit chronisch leerem Säckel – sie kurzerhand wie ein lästiges Möbelstück ins Kloster abgeschoben hatte, das eher bereit war als jeder adelige Bräutigam, die junge Frau ohne nennenswerte Mitgift zu akzeptieren. Auch ihre ständigen Unfälle ertrug sie mit philosophischer Gelassenheit.
Fidelitas runzelte die Stirn, als Margaretha atemlos vor ihr zum Stehen kam. »Langsam, Kind! Was ist denn los?« Ein alarmierender Gedanke schoss ihr durch den Kopf, und ihre Augen wurden schmal. »Der Hustensirup ist doch hoffentlich nicht angebrannt?«
Die Vermutung lag immerhin nahe, denn im letzten Herbst hatte Fidelitas Margaretha auf Anweisung der neuen Äbtissin unter ihre Fittiche genommen. Sie achtete sorgsam darauf, dass ihre Gehilfin mit den gefährlicheren Heilmitteln so wenig wie möglich in Berührung kam, leitete sie aber geduldig in der Gartenarbeit und Pflanzenlehre an, ließ sie unter Aufsicht Kräuter hacken, fertige Tränke abfüllen und in ihren Kesseln rühren. Und in den Kessel, den Margaretha augenblicklich zu überwachen hatte, waren Fidelitas' letzte Vorräte von getrocknetem Spitzwegerich gewandert, gemeinsam mit einem Krug Branntwein und einem ganzen Pfund kostbarem Tannenhonig.
»Nein, nein!« Margaretha wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Der ist fertig, Schwester … genau so dick und süß, wie Ihr ihn haben wolltet. Ich hab ihn zum Abkühlen beiseitegestellt und das Feuer gelöscht.«
Fidelitas gab einen lautlosen Seufzer der Erleichterung von sich. »Sehr schön, Kind. Aber was ist denn dann der Anlass für diese Aufregung?«
»Die Ehrwürdige Mutter möchte Euch sehen«, erklärte Margaretha. »Sie bittet darum, Euch zu beeilen, da sie noch vor der Terz das Kloster für den Rest des Tages verlassen muss.«
Die Terz war das Stundengebet, das täglich um neun Uhr morgens stattfand. Fidelitas warf einen Seitenblick auf den Horizont, der inzwischen ganz hell geworden war; die frühe Sonne ließ die regennassen Rasenflächen zwischen den Grabsteinen blassgolden aufglitzern.
»Dann«, meinte sie, »sollte ich mich wohl besser beeilen.« Sie schenkte Margaretha ein rasches Lächeln. »Und du lässt bis zur Terz den Kessel nicht aus den Augen und rührst ihn regelmäßig durch, damit der Sirup keine Kristalle bildet.«
»Selbstverständlich, Schwester.«
Fidelitas eilte an der jungen Novizin vorbei. Das Quartier der Äbtissin befand sich in einem seitlich versetzten Nebengebäude, in bequemer Nähe zur Kirche. Sie öffnete die kleine Seitenpforte, die hineinführte; bei den letzten paar Schritten durch den Flur umrundete sie den Eimer einer jungen Magd, die mit einer Bürste den Steinboden scheuerte. Zwar wurden die Nonnen in Frauenalb strikt dazu angehalten, die Regeln des Heiligen Benedikts zu befolgen und nicht nur zu beten, sondern durchaus auch zu arbeiten, aber für die wirklich groben Dienste gab es Gesinde.
Sie grüßte das Mädchen freundlich und bekam einen scheuen Gruß zurück, und dann klopfte sie an die vertraute, mit Schnitzereien geschmückte Tür.
»Ehrwürdige Mutter? Ich bin es – Fidelitas.«
»Komm herein.«
Die Äbtissin saß hinter ihrem Schreibtisch direkt neben einem großen Ostfenster. Helles Sonnenlicht fiel auf die viereckig zugeschnittenen Pergamentbögen, die vor ihr gestapelt lagen; in einem Tintenfass steckte eine Schwanenfeder.
»Guten Morgen, meine Tochter«, sagte sie ruhig. »Steht bei deinen Kesseln und Phiolen alles zum Besten?«
Fidelitas lächelte. »Wegen Margaretha, meint Ihr? Keine Sorge – sie macht sich sehr gut. Außerdem ist sie die geborene Gärtnerin. Was sie sät oder pflanzt, das gedeiht, und sie hegt jeden Setzling so liebevoll wie eine Mutter ihr Neugeborenes.«
»Dann hat sie endlich ihren Platz in unserer Gemeinschaft gefunden?« Die Äbtissin betrachtete sie aufmerksam. »Ich muss sagen, das erleichtert mich. Mir ist schon aufgefallen, dass wir in den letzten Monaten weniger zerbrochenes Essgeschirr und weniger haarsträubende Missgeschicke zu beklagen hatten. Das tut dem lieben Kind sicher so gut wie uns allen. – Aber deswegen habe ich dich nicht hergerufen.«
Sie faltete die Hände auf dem Tisch vor sich.
»Wie würdest du das Befinden von Herrn Stöcklin einschätzen? Ist er gesund genug, um nach Hause zurückzukehren? Er hat mich gestern aufgesucht, und mir scheint, er ist ein wenig ungeduldig.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Fidelitas nickte. »So lange von daheim entfernt und von seinen Lieben getrennt zu sein, das muss ihm schwerfallen.«
»Richtig. Obendrein macht er sich Sorgen um seine Geschäfte. Er hat mir gegenüber erwähnt, dass sein Tuchhandel in Freiburg im Moment von seiner Mutter geführt wird, und er brennt darauf, ihr die … äh … Zügel wieder aus der Hand zu nehmen. So schnell wie möglich.«
In den Augen der Äbtissin funkelte ein kleines, ironisches Licht, und plötzlich hatte Fidelitas eine ziemlich genaue Ahnung davon, wie sie sich die Mutter des Kaufmannes vorstellen musste. Vermutlich kam der Gevatterin Stöcklin die lange Abwesenheit ihres Sohnes durchaus gelegen … und der fürchtete nun, dass sie die Herrschaft ganz an sich riss.
»Das Bein ist gut verheilt«, erklärte sie. »Ein wenig empfindlich vielleicht, und er sollte es besser noch nicht allzu lange belasten, aber er ist gewiss reisefähig.«
»Schön.« Die Äbtissin wirkte zufrieden. »Dann können wir ihn wohl ziehen lassen.«
Fidelitas neigte den Kopf. »War das alles, Ehrwürdige Mutter?«
»Nicht ganz.« Die Äbtissin lehnte sich zurück und musterte sie scharf. »Er hat mich um einen Gefallen gebeten. Offenbar hast du mit deinen Kenntnissen und deiner Pflege großen Eindruck auf ihn gemacht. Und jetzt wünscht er sich, dass du ihn nach Freiburg begleitest.«
Fidelitas fuhr zusammen.
»Ich? Aber was soll ich denn in Freiburg?«
»Herr Stöcklin hat eine kranke Frau«, meinte Katharina von Bettendorf gelassen. »Sie ist seit Jahren schwächlich, und kein Medikus konnte bislang dauerhaft eine Besserung ihres Zustandes herbeiführen. Er hofft, dass du dank deiner Erfahrung die rechten Kräuter und Heilmittel findest, um ihr zu helfen.«
Fidelitas spürte, wie sich ihr Rückgrat versteifte. Die bloße Vorstellung, das Kloster zu verlassen, bereitete ihr fast körperliche Schmerzen. Aber dann erinnerte sie sich an die rheumatischen Beschwerden, unter denen die Äbtissin regelmäßig litt, und griff danach wie nach einem rettenden Strohhalm.
»Wenn Eure Hand- und Kniegelenke sich wieder fiebrig entzünden«, gab sie zu bedenken, »wer sorgt dann für Euch?«
Katharina von Bettendorf lächelte leicht ironisch; Fidelitas begriff, dass ihre Finte durchschaut worden war.
»Deine Lager sind gut gefüllt und deine Aufzeichnungen leicht verständlich. Unsere Infirmarin Schwester Maria Curatia kennt sich außerdem genügend mit der Kräuterkunde aus, um dich zu vertreten. Sollten meine unerfreulichen Gelenkschmerzen zurückkommen, weiß sie, wo sie deinen Weidenrindenextrakt findet.«
»Herr Stöcklin könnte mir die Anzeichen der Krankheit beschreiben, und ich könnte ihm eine passende Kräutermischung mitgeben.« Es war der letzte Versuch, dem Unvermeidlichen zu entgehen.
Die Äbtissin legte die Fingerspitzen aneinander und musterte sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ohne seine Frau je untersucht zu haben?«, fragte sie milde. »Ohne genau zu wissen, was ihr fehlt? Das wäre doch sicher ein wenig fahrlässig, meinst du nicht?«
Fidelitas biss sich auf die Lippen. »Natürlich, Ehrwürdige Mutter.«
»Überdies hat Herr Stöcklin dem Kloster eine stattliche Summe angeboten, wenn wir bereit sind, für – sagen wir – fünf oder sechs Wochen auf dich zu verzichten. Das sollte dir genügend Zeit geben, um die Natur ihrer Krankheit gründlich genug zu studieren und mit Gottes Hilfe das rechte Mittel zu finden, das sie wieder gesund macht. Immer gesetzt den Fall, ein solches Mittel gibt es.«
»Was ich nicht versprechen kann.« Fidelitas seufzte. Sie erkannte den in beharrliche Freundlichkeit gekleideten Befehl mehr als deutlich. »Es ist Euer Wunsch, dass ich nach Freiburg gehe.«
»Ganz recht. Herr Stöcklin wird übermorgen abreisen; wir stellen ihm einen Wagen zur Verfügung und werden ihm ein paar kräftige Knechte zur Begleitung mitgeben, damit er heil in Freiburg ankommt. Und du ebenfalls.«
Der Blick der Äbtissin wurde sanft.
»Keine Sorge – Maria Curatia wird sich auch um Schwester Margaretha kümmern.« Ihre Lippen kräuselten sich humorvoll. »Aber selbst wenn es uns gelingt, deine Abwesenheit ohne nennenswerte Zwischenfälle zu überstehen, werden wir uns sehr freuen, dich nach erfüllter Aufgabe daheim willkommen zu heißen.«
»Genauso wie ich, Ehrwürdige Mutter.« Fidelitas verneigte sich und ging hinaus, den Kopf gesenkt.
Bis zur Terz war es noch eine knappe halbe Stunde. Sie stellte fest, dass es sie nicht in die Kirche zog, um für eine sichere Reise zu beten. Stattdessen verließ sie das Hauptgebäude, eilte durch den Kreuzgang und am Friedhof vorbei und hatte endlich ihren geliebten Kräutergarten erreicht.
Margaretha war nirgendwo zu sehen, und in diesem Moment empfand Fidelitas große Dankbarkeit dafür. Sie wollte keinerlei Fragen beantworten oder gar die junge Novizin beruhigen müssen – denn die würde bei der Aussicht, wochenlang ohne ihre Lehrmeisterin auskommen zu müssen, vermutlich in Panik geraten. Und sie war selbst schon panisch genug.
Erinnerungen an ihren letzten »Ausflug« in die Welt stürmten auf sie ein. Auch damals hatte sie ihrer Äbtissin gehorcht und war fortgegangen, um eine Kranke zu pflegen und ihr Leiden zu lindern – und dadurch war sie in ein schreckenerregendes Chaos aus Verschwörungen, Mord und Totschlag geraten, das sie sich zuvor niemals hätte träumen lassen.
Sie hatte die Leiche eines vergifteten jungen Mannes entdeckt und ausgerechnet gemeinsam mit einem protestantischen Professor aus Tübingen versucht, das gefährliche Netz aus Lügen und Intrigen zu entwirren, das rings um sie her gewoben worden war. Sie war sogar niedergeschlagen, betäubt und verschleppt worden. Und noch heute dankte sie ihrem Schöpfer bei jedem Gebet, dass sie trotz allem lebend und mehr oder weniger unversehrt in die Sicherheit des Klosters und zu ihren Schwestern hatte heimkehren dürfen.
Sie hob die Augen zum Himmel. Nachdem die Wolken über die bewaldeten Hügel davongezogen waren, war er jetzt von durchsichtiger Klarheit, und die Kräuter in den Beeten noch nass von Regen und Tau. Der Duft nach frühem Thymian, Frauenmantel, Rosmarin, Beinwell und Salbei stieg rings um sie her auf wie eine balsamische Wolke und besänftigte ihre innere Unruhe.
Fidelitas atmete tief durch und schloss die Augen.
Adiuva me, Domine, dachte sie. Geh den Weg nach Freiburg an meiner Seite. Und bring mich danach schnell wieder zurück nach Hause.
(14. Mai A. D. 1555)
Es scheint, als hätte ich mich zu früh gefreut.
Zwar ist mir der Überfall auf den dummen, vertrauensseligen Stöcklin wie ein unverhofftes Geschenk des Schicksals in den Schoß gefallen, aber genutzt hat er mir nichts. Die Räuber haben ihm zwar seine Waren abgenommen, doch bedauerlicherweise haben sie versäumt, ihn umzubringen, und er ist geflüchtet wie der Hase vor dem Fuchs. Dabei hat er sich ein Bein gebrochen, aber anstatt zu sterben, ist er ausgerechnet in einem Kloster gelandet, wo die frommen Frauen ihn wieder gesund gepflegt haben.
Und jetzt kommt er nach Hause zurück – noch dazu in Begleitung einer Nonne. Damit ist der Schatz, den ich schon im Sack zu haben geglaubt hatte, wieder in weite Ferne gerückt. Denn um ihn mir widerstandslos auszuliefern, ist Vinzenz Stöcklin bei all seiner erbärmlichen Schwäche wahrscheinlich nicht skrupellos genug. Anders als seine Mutter, die vermutlich nicht zögern würde, für eine Handvoll Goldmünzen ihr Seelenheil zu verkaufen.
Also werde ich mich in Geduld üben müssen.
Erst einmal jedenfalls.