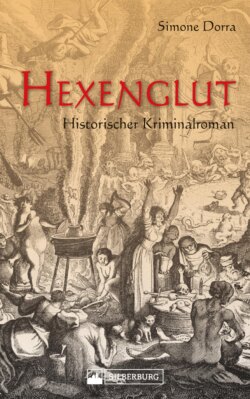Читать книгу Hexenglut. Historischer Kriminalroman. - Simone Dorra - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine wertvolle Braut
ОглавлениеManchmal wünschte sich Veronika Stöcklin, sie wäre nicht als Mädchen geboren worden.
Ihre Freundinnen – Töchter von Ratsherren und wohlhabenden Kaufleuten in Freiburg – beneideten sie von jeher um ihre Schönheit und ihre guten Aussichten. Veronika fand inzwischen keines von beidem mehr sonderlich beneidenswert.
Im letzten Dezember war sie siebzehn geworden, und ihre Großmutter Gundis hatte diesen Geburtstag zum Anlass genommen, ernsthaft nach einer guten Partie für sie zu suchen. Wobei sie nicht lange suchen musste – der gewünschte Ehemann für ihre Enkeltochter hatte eigentlich schon festgestanden, als Veronika ihre Pausbacken und ihre kindliche Unbeholfenheit verlor, als ihre Gestalt zierlich und anziehend wurde und die jungen Burschen in den Gassen anfingen, ihr nachzustarren, wenn sie vorüberging. Und das war jetzt gut zwei Jahre her.
Im März hatte Gundis sie zu sich gerufen und ihr erklärt, wen genau sie zum Mann nehmen sollte – Martin Danner, den ältesten Sohn von Sebaldus Danner. Dieser war genau wie Vinzenz Stöcklin ein erfolgreicher Tuchhändler gewesen und letztes Jahr einem Schlaganfall erlegen. Gundis glaubte offensichtlich, dass die Ehe mit Sebaldus' Erben das Vermögen der Stöcklins so stark mehren würde, dass es sich gar nicht erst lohnte, im Kreise der angesehenen Ratsherren nach einem anderen Kandidaten für Veronika Ausschau zu halten. Das passte zu ihr – der jahrzehntelang heiß ersehnte und hart erarbeitete Aufstieg in die besseren Kreise von Freiburg war längst gelungen, jetzt hieß es, durch möglichst großen Reichtum dafür zu sorgen, dass es nie wieder zu einem Abstieg kam.
Veronika verstand das durchaus. Gundis wollte den Status der Familie sichern, koste es, was es wolle – und Veronika war das Mittel, mit dem sich genau dieses Ziel erreichen ließ. Das einzige Mittel – denn Veronikas Mutter Regula war es leider nicht gelungen, einen männlichen Erben zur Welt zu bringen, der den einträglichen Tuchhandel von Vinzenz Stöcklin eines Tages übernehmen konnte. Gundis hatte sie das deutlich spüren lassen.
Regula ihrerseits hatte die Tyrannei und die ständigen giftigen Vorwürfe ihrer Schwiegermutter nur schwer ertragen, sich aber selten wirklich zur Wehr gesetzt, um ihrem Mann – den sie innig liebte – das Leben nicht schwer zu machen.
Also war Veronika den Wünschen ihrer Großmutter mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Noch hatte Gundis den Termin der Hochzeit mit Martin Danner nicht festgesetzt – was ausschließlich daran lag, dass der Tod seines Vaters erst sechs Monate zurücklag und ein großes Fest sich nicht mit der Trauerzeit vertrug. Aber Martin kam häufig zu Besuch und bewegte sich (wenigstens in Veronikas Augen) durch das Haus, als gehörte es bereits ihm – was eines Tages zwangsläufig der Fall sein würde, weil Veronikas Erbe nach der Hochzeit nach herrschendem Recht genauso an ihn fallen würde wie alles, was sie sonst noch besaß.
Dass Vinzenz Stöcklin nach dem Überfall auf seiner Reise durch den Schwarzwald gottlob gesund und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt war, änderte nichts an Gundis' Plänen. Dass die Nonne, die ihn begleitete, es tatsächlich fertiggebracht hatte, Veronikas Mutter aus dem gleichgültigen Nebel herauszuholen, in dem sie vor zwei Jahren versunken war, ebenso wenig. Veronika glaubte, dass Regula noch viel zu schwach und zu anfällig war, um den Kampf mit Gundis wieder aufzunehmen. Und sie war viel zu erleichtert, sie zurückzuhaben, und auch viel zu besorgt um ihr Wohlergehen, um ihr diesen Kampf jetzt zuzumuten.
Immerhin: Martin Danner war nicht nur reich, sondern auch gut aussehend. Er vertrug sich bestens mit Gundis, erwies Vinzenz Stöcklin stets eine makellose Höflichkeit und machte sich, obwohl das Verlöbnis bereits so gut wie feststand, immer noch die Mühe, Veronika mit Geschenken zu umwerben, hübsche Schmuckstücke und andere durchaus kostspielige Kleinigkeiten, die er für passend hielt. Inzwischen wurde sie von sämtlichen Freundinnen um ihren zukünftigen Ehemann beneidet.
Veronika verzichtete darauf, zu widersprechen. Sie sagte auch nichts darüber, dass sie statt der sorgsam ausgewählten Kleinodien, die Martin ihr zukommen ließ, lieber Bücher gehabt hätte. Sie las für ihr Leben gern, hatte aber den Verdacht, dass Martin Bücher nur dann zu schätzen wusste, wenn sie mit den Zahlenkolonnen seiner Rechnungen und Lieferungen gefüllt waren. Genau wie ihre Großmutter.
Außerdem gab es noch etwas, das sie nicht nur ihren Freundinnen, sondern auch Gundis, ihrem Vater und allen anderen verschwieg – nämlich den Grund, wieso sie seit einem halben Jahr mindestens zweimal die Woche abends den Schlüsselbund aus dem Zimmer ihrer schlafenden Großmutter stahl, warum sie dann in größter Heimlichkeit das Haus verließ und erst zwei oder drei Stunden später wieder ebenso heimlich zurückkehrte.
Sie wusste, dass es falsch war, was sie da tat, und gefährlich obendrein. Sie wusste, dass ihre Ehrbarkeit, ihr guter Ruf und sämtliche Aussichten, die sie besaß, dahin sein würden, wenn man sie ertappte. Sie würde Schande über ihre Familie bringen. Und Martin Danner würde sie auf keinen Fall mehr haben wollen … Weswegen sie sich in seltenen, besonders waghalsigen Momenten beinahe wünschte, bei dieser besonderen, bittersüßen Heimlichkeit ertappt zu werden. Damit sie endlich aufhören konnte zu lügen, damit ihre Großmutter keine Gelegenheit mehr hatte, sie wie eine Figur auf einem Spielbrett umherzuschieben – und damit die Welt erfuhr, was sie selbst wollte. Wenn das geschah, musste es bald geschehen – Veronika wusste genau, dass ihr die Zeit davonlief. Über kurz oder lang würde Martin Danner den Geschenken, mit denen er sie behängte, den Ehering folgen lassen, und dann war es zu spät.
Trotz alledem war sie zu Tode erschrocken, als sie sich an diesem Abend ins Haus schlich … als sie die Hand spürte, die sie am Umhang festhielt, und die ruhige Stimme hörte, die sie anwies, ihr hinunter in die Küche zu folgen.
Sie war verloren.
Abgesehen von dem kleinen Lichtkreis der Kerze, die Fidelitas mitgebracht hatte, war die Küche vollkommen dunkel.
Veronika saß auf einem Hocker am Tisch, die Schultern angespannt, den Kopf gesenkt. Den Umhang zog sie fest um sich zusammen, als könnte sie sich damit vor der Strafpredigt schützen, die ihr zweifellos bevorstand.
Aber die Nonne schwieg.
Veronika blickte auf und studierte ebenso schweigend das Gesicht, das sich vor ihr aus der Finsternis schälte – ebenmäßige Flächen, vergoldet vom Flammenschein, die gerade Nase, der volle, ein wenig herbe Mund, das eckige, willensstarke Kinn. Es kam ihr so vor, als würde sie Fidelitas zum ersten Mal richtig sehen, und ihr stockte das Herz bei dem Gedanken, dass diese fast vollkommen fremde Frau buchstäblich ihr Schicksal in den Händen hielt.
»Werdet Ihr meinem Vater erzählen, dass ich heimlich aus dem Haus war?«, fragte sie endlich, als sie die Stille nicht länger aushielt. »Oder … oder meiner Großmutter?«
»Euer Vater würde zweifellos beunruhigt und enttäuscht sein. Aber natürlich fürchtet Ihr Euch am meisten vor dem, was Frau Gundis zu solchen Eigenmächtigkeiten sagen würde. Nicht wahr?« Fidelitas betrachtete sie forschend. »Kommt es häufiger vor, dass Ihr Euch heimlich davonschleicht? Oder ist das heute zum ersten Mal geschehen?«
Veronika hätte liebend gerne gelogen, brachte es aber einfach nicht fertig. »N… – nein. Ich mach das schon ein paar Monate.«
»Soso.« Fidelitas faltete die Hände vor sich auf dem Tisch. »Darf ich den Namen des jungen Mannes erfahren?«
Veronikas Kopf zuckte hoch. »Woher wisst Ihr …«
»Das ist nicht weiter schwer.« Die Nonne lächelte sachte. »Wenn Ihr eine Freundin aufsuchen wollt, könnt Ihr das jederzeit bei Tageslicht tun … und bei einem Händler wollt Ihr zu dieser späten Stunde wohl kaum noch etwas kaufen. Aber da Eure Großmutter im Moment Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um Euch möglichst gewinnbringend unter die Haube zu bringen, bleibt eigentlich nur eine Sache übrig, die Euch zu solchen Heimlichkeiten treiben könnte – jemand, an den Ihr Euer Herz verschenkt habt, ohne dass Eure Familie davon wissen darf. – Wie heißt er?«
»Jörg.« Veronika sprach sehr leise. »Er … er ist ein guter, anständiger Mensch. Und wir haben nichts getan, was … ich meine, wir …« Sie biss sich auf die Lippen; ihre Wangen waren brennend heiß.
»Wenn er so ein anständiger Mensch ist, wie Ihr sagt – warum kommt er dann nicht her und bittet Euren Vater um Eure Hand?« Die Stimme der Nonne enthielt erstaunlicherweise nicht einen Hauch von Tadel, sondern ehrliche Anteilnahme. »Das würde Euch diese Heimlichkeiten mitten in der Nacht ersparen – und ehrbarer wäre es auch, meint Ihr nicht?«
Veronika starrte die Nonne an, und die Verzweiflung über den schmerzhaften Zwiespalt, in dem sie sich befand, schlug wie eine eiskalte Woge über ihr zusammen.
»Ehrbarer wäre es ganz sicher«, entgegnete sie bitter. »Aber in diesem Fall ist alle Ehrbarkeit vergebens, Schwester. Denn ich bin Martin Danner versprochen. Der ist reich, wohlhabend und angesehen und alles, was sich meine Großmutter als Bräutigam für mich erhofft hat. Jörg ist nichts davon.«
Sie schluckte heftig.
»Und außerdem … außerdem ist er Martins jüngerer Bruder.«
»Jörg Danner? Ja, freilich kenn ich den! Er ist ein wirklich guter Junge.«
Es war am folgenden Mittag. Fidelitas hatte Heinrich Stöcklin ein leichtes Essen hinaufgebracht, weil er sich heute zu schwach und müde fühlte, um mit am Familientisch zu sitzen. Sie hatte extra gewartet, bis sein Beichtvater – ein raubvogelgesichtiger und ziemlich furchteinflößender Priester namens Paulus Mayr, der ihn einmal wöchentlich besuchte – sich verabschiedet hatte und mit wehender Soutane durch die Haustür verschwunden war.
Nach gründlichem Abwägen und viel Gebet war sie sich inzwischen sicher, dass es klüger sein würde, nicht mit Vinzenz und erst recht nicht mit Gundis über das zu sprechen, was Veronika ihr erzählt hatte, sondern besser mit Veronikas Großvater. Und nachdem der Name des heimlichen Liebsten seiner Enkelin das erste Mal gefallen war, vergaß der alte Herr auf verblüffende Weise alle Schwäche und wirkte mit einem Mal ausgesprochen munter.
»Mein Mädel ist klug«, verkündete er, »genau wie Jörg. Es wundert mich gar nicht, dass er es war, der ihr Herz gewonnen hat, und nicht sein hochmütiger Laffe von Bruder. Ginge es nach mir, ich würde sie Jörg sofort zur Frau geben. Er mag keine Reichtümer und keinen Einfluss besitzen, aber er ist ehrlich und fleißig. Er lernt ein ordentliches Handwerk bei einem Uhrmachermeister, und eines Tages würde er sie sehr gut versorgen können, da bin ich ganz sicher.«
»Frau Gundis sieht das anders, nehme ich an?«, wollte Fidelitas wissen.
»Weiß Gott!«
Heinrich Stöcklin sank ein wenig in sich zusammen, als ginge ihm einmal mehr auf, dass es nicht seine Meinung war, die zählte.
»Schon seit Jahren ist sie hinter Martin her wie der Teufel hinter der armen Seele. Nicht, dass der sich sonderlich dagegen wehren würde – ganz im Gegenteil.« Er schnaubte verächtlich. »Er weiß genau, was für ein Schatz ihm in den Schoß fällt, wenn er sich zu dem unschuldigen Kind ins Brautbett legt. Kein Wunder, dass er auf die Mitgift verzichtet hat – ich wette, für das Versprechen, Veronika heiraten zu dürfen, hat er noch ordentlich Geld auf den Tisch gelegt. Denn wenn Vinzenz einmal nicht mehr lebt und er das Vermögen seiner Frau erbt, ist er auf einen Schlag der größte Tuchhändler in ganz Freiburg.«
Fidelitas schwieg eine Weile. Sie wusste, dass es ihr nicht zustand, ihre Meinung zu äußern, und sie konnte sich lebhaft das Stirnrunzeln ihrer Ehrwürdigen Mutter vorstellen, wenn sie sich hier einmischte. Außerdem war sie bei ihrem letzten »Ausflug« in die Welt jenseits der Klostermauern schon einmal zwischen die Fronten eines Familienstreites geraten und hatte dabei beinahe ihr Leben verloren. Es würde sicherlich weiser sein, sich aus diesem Konflikt herauszuhalten.
Doch sie konnte den trostlosen Jammer in Veronikas Gesicht nicht vergessen. In diesem Fall ist alle Ehrbarkeit vergebens, hatte sie gesagt.
»Ihr meint, Jörg sei ein guter Junge«, meinte sie. »Könnt Ihr mir etwas mehr über ihn erzählen?«
»Er war, was seine Geburt angeht, nicht gerade von Glück begünstigt«, meinte Heinrich Stöcklin. »Martin ist der Sohn von Sebaldus' erster Frau Marie. Die starb, als er fünf war, und Sebaldus heiratete zum zweiten Mal – Anna, eine sanfte, friedliche Seele. Die hat ihm dann Jörg geschenkt. Sebaldus hat ihn sehr geliebt, war aber an das Erbrecht gebunden, durch das dem Erstgeborenen das gesamte Vermögen zufällt.«
Er zog eine Grimasse.
»Die zweite Frau ist durch genau dieses Erbrecht samt ihrer Nachkommen auf das Wohlwollen des Erstgeborenen angewiesen … und Martin kann seine Stiefmutter auf den Tod nicht ausstehen. Nach Sebaldus' plötzlichem Ableben hat er ihr das Leben im Haus so sauer gemacht, dass sie inzwischen ein paar Meilen weit weg in Kirchzarten lebt, bei einer gebrechlichen alten Patin, die bereit war, sie aufzunehmen, und die reichlich Pflege braucht. Jörg schickt ihr regelmäßig einen Teil der Ersparnisse, die er zu Lebzeiten seines Vaters hat zusammentragen können, um sie zu unterstützen. Er befindet sich in einer sehr schwierigen Lage; er besitzt nicht die Mittel, um einen eigenen Hausstand zu gründen, und er weiß genau, dass sein Halbbruder ihn nur deswegen noch unter seinem Dach duldet, weil der plötzliche Auszug von Anna einiges Aufsehen erregt hat und Martin keine Lust hat auf noch einen Skandal.«
Der sich wohl kaum vermeiden lässt, wenn er sich eine Frau ins Haus holt, die eigentlich seinen Bruder liebt, dachte Fidelitas und zog schaudernd die Schultern hoch. Nicht zum ersten Mal sehnte sie sich heftig nach dem Frieden ihres Klosters zurück.
»Das Blatt kann sich für Jörg allerdings durchaus wenden«, fuhr der alte Stöcklin fort. »Der Meister, der ihn die Uhrmacherkunst lehrt, hält große Stücke auf ihn, und er hat außer einer verwitweten Schwester weder lebende Verwandte noch Kinder. Ein halbes Jahr noch, und Jörg hat ausgelernt. Sein Lehrherr hat ihm versprochen, dass er ihn – solange er ihm die Treue hält und weiter so gute Arbeit leistet, wie er es tut – zu seinem Erben macht. Und dann hätte er Veronika weit mehr zu bieten als jetzt.«
»Gibt es ein Schriftstück, das dieses Versprechen zweifelsfrei beweist?«, wollte Fidelitas wissen. »Vielleicht ein Testament?«
Stöcklin schnaufte überrascht durch die Nase. »Merkwürdig, dass Ihr das erwähnt. Das hab ich Jörg nämlich auch gefragt – denn mit diesem Testament wäre er für Gundis vielleicht endlich ein erstrebenswerter Kandidat für Veronikas Hand. Gesetzt den Fall, sie ist bereit, Martin den Schatz, den er bereits halb in der Tasche hat, im letzten Moment wieder vor der Nase wegzunehmen.«
Er seufzte.
»Aber leider gibt es kein Schriftstück – jedenfalls keines, von dem Jörg weiß. Der Junge geht nach Treu und Glauben und verlässt sich darauf, dass der Meister sein Wort hält, wenn es so weit ist.«
»Damit wird Eure Frau sich nicht zufriedengeben«, sagte Fidelitas. Es war eine Feststellung, keine Frage.
»Wahrscheinlich nicht.« Heinrich Stöcklin seufzte zum zweiten Mal. Sein Blick war traurig und ein wenig beschämt. »Ihr müsst mich für einen feigen Tropf halten, Schwester – dass ich Gundis die Herrschaft überlasse, anstatt sie in ihre Schranken zu weisen und das Zepter wieder selbst in die Hand zu nehmen.«
»Das ist nicht mehr Eure Aufgabe«, entgegnete Fidelitas sanft. »Es ist die Eures Sohnes. Und jetzt, da seine Frau sich von ihrem Leiden erholt, hat er vielleicht endlich die Kraft dazu.«
Sie streckte die Hand aus und legte sie leicht auf seinen Arm.
»Wisst Ihr noch? Ihr habt mir selbst gesagt, ich hätte das Gleichgewicht in diesem Haus verändert«, erinnerte sie ihn. »Euer krankes Herz mag Euch daran hindern, allein in die Schlacht zu ziehen. Aber es dauert nicht mehr lange, und Ihr werdet starke Verbündete haben. Herr Vinzenz und Frau Regula können gemeinsam mit Euch verhindern, dass Frau Gundis ihren Kopf durchsetzt und Martin Danner Veronika zur Frau nimmt. Alles, was Ihr braucht, ist ein wenig mehr Zeit.«
Heinrich Stöcklin straffte sich; in seinen Augen glomm plötzlich ein kriegerischer Funke.
»Dann«, meinte er, »muss ich wohl jetzt meine Lenden für die Schlacht gürten, nicht wahr?« Er lachte leise. »Ich muss sagen, Ihr macht mir Mut. Ich werde Gundis erst einmal bitten, die Hochzeit noch ein wenig weiter hinauszuschieben. Schließlich sollte Regula erst vollständig genesen, bevor sie ihre Tochter ziehen lässt. Und bis dahin lässt Jörgs Meister sich ja vielleicht dazu bringen, ein Testament zu Jörgs Gunsten aufzusetzen. Damit wir etwas in der Hand haben.«
Fidelitas wies mit einem Lächeln auf das Tablett mit der kleinen, zugedeckten Schüssel, das sie zu ihm heraufgebracht hatte.
»Ich wünsche Euch, dass Ihr Erfolg habt«, sagte sie. »Ihr solltet Euch für das Gespräch mit Eurer Frau stärken … Und außerdem wäre Irmhild bestimmt sehr enttäuscht, wenn ihr schönes Buttergemüse kalt wird. Sie hat extra für Euch Speckwürfel mit Wacholder hineingeschnitten.«
»Wirklich?« Heinrich Stöcklin hob den Deckel von der Schüssel und schnupperte genießerisch. »Dann will ich es mir schmecken lassen – und Ihr dürft Irmhild in meinem Namen herzlich danken. Sehen wir uns heute noch einmal?«
»Sehr gern – nach dem Abendessen, wenn Frau Regula sich schlafen gelegt hat.« Fidelitas erhob sich. »Aber vorher werde ich tun, was Ihr mir schon die ganze Zeit ans Herz legt, seit ich hier bin: Ich besuche endlich Euer berühmtes Münster und spreche darin ein Gebet.«
»Für mich?« Der alte Herr schmunzelte.
»Für Euch. Für alle, die in diesem Haus leben«, erwiderte Fidelitas ernst. »Und für mich ebenfalls.«
Es war tatsächlich das erste Mal, dass Fidelitas länger als für wenige Minuten das Haus verließ. Sie erkundete die fremde Stadt mit dem Eifer eines neugierigen Kindes, dem endlich gestattet wurde, die ersten selbstständigen Schritte ohne Begleitung zu tun, und sie fand sie gleichzeitig ehrfurchtgebietend, furchteinflößend und wunderschön.
Sie brauchte kaum zehn Minuten, um den Platz zu erreichen, über dem das Münster mitsamt seinem schwindelerregend hohen, grazilen Turm seinen Schatten warf. Bei einem ihrer Besuche in seiner Studierstube hatte Heinrich Stöcklin ihr augenzwinkernd von den vielen Wasserspeiern erzählt, die das Kirchendach säumten; speziell von dem »Hinternentblößer«, der den Gläubigen dreist seine nackte Kehrseite entgegenreckte. Allerdings war ihr im Moment nicht nach derben Scherzen zumute. Zu schwer wog die Verantwortung, die sie auf ihren Schultern lasten fühlte, seit sie Heinrich ermutigt hatte, den Kampf gegen Martin Danner und obendrein gegen seine eigene Frau aufzunehmen.
Bevor sie das Münster betrat, ging sie langsam an den Gebäuden entlang, die den Platz säumten. Sie betrachtete staunend die prächtige rote Fassade des Kaufhauses. Die Statuen der österreichischen Fürsten unter ihren goldgezierten Baldachinen sprachen von Hochmut, von ungezügelter Macht und dem Verlangen, eine unauslöschliche Spur im Strom der Geschichte zu hinterlassen. Eine ganze Weile blieb sie unter der gekrönten Statue von Karl dem Fünften stehen, der in einer Hand den Reichsapfel und in der anderen das erhobene Schwert hielt … Und plötzlich kam das Echo einer Stimme zu ihr zurück, die sie zuletzt vor fünf Jahren gehört hatte. Die meisten hohen Herren verkaufen ihren Glauben und den ihrer Untertanen an den, der ihnen am meisten bietet, sei er nun Katholik oder Protestant.
Diese Aussage war so wahrhaftig wie traurig, und trotzdem stellte Fidelitas fest, dass sie lächelte. Sie sah das Gesicht des Mannes vor sich, den sie kennengelernt hatte, als sie damals versucht hatte, das Rätsel um den Tod eines jungen Adeligen zu lösen, der auf heimtückische Weise an Gift gestorben war. Ein spanischer Landsknecht, ohne Skrupel und gefährlich wie eine scharf geschliffene Messerklinge. Und doch hatte er ihr das Leben gerettet.
Ich segne dich, Juan Alvarez de Santa Cruz y Fuego, dachte sie. Möge dein Mut niemals sinken, möge kein Schwert dich fällen und Gott dir gnädig sein, solange du lebst. Falls du noch lebst, was ich trotz deiner Sünden inständig hoffe.
Sie überquerte den Platz und näherte sich der kleinen Andreaskapelle, deren Keller lange Jahre als Beinhaus gedient hatte. Jedenfalls zu der Zeit, als rund um das Münster noch Freiburger Bürger regelmäßig ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten; dieselbe Zeit, aus der auch die Mauer des ehemaligen Friedhofs rings um das Münster stammte. Heinrich Stöcklin hatte ihr davon erzählt, und von dem Befehl des österreichischen Kaisers Maximilian, der schon vor knapp vierzig Jahren angeordnet hatte, den Friedhof zu verlegen. Aber noch immer standen vor der Kapelle ein steinernes Kreuz und eine Säule mit einem ewigen Licht.
Das hölzerne Tor zum nördlichen Seitenschiff des Münsters knarrte leise, als Fidelitas es aufstieß, und dann nahm der stille, weihrauchduftende Dämmer der riesigen Kirche sie auf. Ihre Sandalen machten kaum ein Geräusch auf den Steinfliesen, während sie auf den Hochaltar zuging. Sie wusste, dass das Münster Maria geweiht war, und sie hielt den Blick fest auf das Bildnis gerichtet, das den Altar dominierte und selbst im Halbdunkel unter dem hohen Gewölbe noch strahlte, als würde es jeden Funken Licht, der durch die bunten Glasfenster fiel, einfangen und bündeln. Maria als Himmelskönigin – die Krone über dem lockigen, leicht zur Seite geneigten Kopf, das Gesicht lieblich und sanft, das Gewand golden und der Mantel tiefblau, schimmernd wie kostbarer Samt.
Sei mir gnädig, Mutter Gottes, betete Fidelitas. Wenn ich meine eigentliche Aufgabe vergessen und mir wider besseres Wissen angemaßt habe, in das Leben von Menschen einzugreifen, die mir vertrauen, obwohl sie mich kaum kennen … dann vergib mir und wende ihr Schicksal trotz meiner Einmischung zum Guten. Vergib mir.
(13. Juni A. D. 1555)
Ich könnte aus der Haut fahren.
Heinrich Stöcklin hat mich zu sich rufen lassen und mir mitgeteilt, dass er meine Absichten unter keinen Umständen zu unterstützen gedenkt. Der alte Zausel hat sich die letzten Jahre in seinen Büchern vergraben und keinen Mucks getan, und jetzt plötzlich droht er, all meine Pläne zu durchkreuzen. Obendrein erholt sich auch noch Frau Regula, die so lange im Hause Stöcklin überhaupt kein Hindernis gewesen ist. Wenn es Heinrich gelingt, sie auf seine Seite zu ziehen, dann wird auch Vinzenz folgen. Und dann ist der Schatz, um den ich mich monatelang bemüht habe, unwiederbringlich dahin.
Das alles hat mit dieser Nonne angefangen. Bevor sie nach Freiburg gekommen ist, lag mein Weg klar vor mir, ohne jedes Hindernis. Ich muss ihr Einhalt gebieten, um jeden Preis, genau wie Heinrich.
Und ich werde sie dafür büßen lassen. Alle beide.