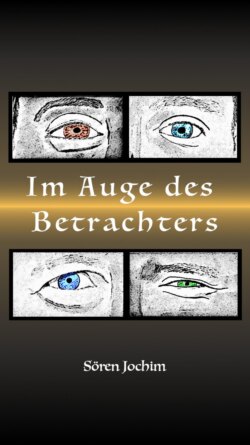Читать книгу Im Auge des Betrachters - Sören Jochim - Страница 4
Kapitel 2 
ОглавлениеEinige Tage später in einem Wohnviertel mit Reihenhäusern
Die grünen Zahlen des Weckers erhellen den sonst dunklen Raum. Geklingelt hat er nicht, es ist 4:50 Uhr. Mein Körper zittert, ich wische mir den Angstschweiß von der Stirn. Alles nur wegen diesem Traum. Immer und immer wieder kehrt er zurück und immer und immer wieder reagiert mein Körper auf ähnliche Weise. Im Traum ist es Nacht, die Sterne am Himmel sind deutlich zu erkennen, der Mond ist halb gefüllt und erhellt die Landschaft. Mein Vater steht aufrecht vor mir und zeigt in Richtung eines Hügels, gesprochen wird nicht, alles geschieht mit Zeichensprache. Das Gewehr in seiner Hand verheißt nichts Gutes. Langsam pirschen wir uns vor, nur wir beide sind weit und breit zu sehen. Welchen Auftrag wir haben, weiß ich nicht. Nach einem Drittel des Anstiegs hält mein Vater inne und lauscht. Außer dem Zirpen der zahlreichen Grillen ist nichts zu hören. Wir gehen weiter, die Beine allzeit gebeugt, um das Gewicht besser abzufedern. Ich habe meine Augen meist nach Hinten und zur rechten Seite gerichtet, mein Vater übernimmt die anderen Gebiete. Nach zwei Dritteln des Weges hält er erneut inne. Wieder ist kein unnatürliches Geräusch zu vernehmen. Er deutet mir an, dass wir uns das letzte Stück robbend fortbewegen sollten, um noch unauffälliger zu sein. Wir lassen uns zu Boden und kriechen Meter für Meter näher an die Hügelkuppe. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Auf der rechten Seite, etwas abhängig, ist ein Waldstück zu erkennen, zahlreiche Tannen ragen meterhoch in die Luft und werfen ihre Schatten in unsere Richtung. Sie wirken wie bedrohliche Riesen, die kommen, um uns zu holen und in absolute Schwärze zu verbannen. Hinter uns liegt das Tal, aus dem wir emporgestiegen sind. Ein kleines Dorf ist in der Ferne erkennbar, zwei, drei Laternen erhellen es. Ansonsten relativ kurz geschnittene Wiesen und abgeerntete Felder wohin man blickt, kaum Deckung. Wir haben Glück gehabt, dass wir bislang nicht aufgefallen sind. Ich blicke zu meinem Vater, er schaut konzentriert nach links. In dieser Richtung scheint es nach einem kleinen Tal noch einmal gute 20m höher zu gehen. Auch dort ragen Bäume empor, mehr von diesen furchteinflößenden Tannen. Bewegungen sind nicht auszumachen. Vor uns erstreckt sich zwischen all den Wäldern ein Pfad von links nach rechts, gesäumt von einem kleinen Holzzaun auf beiden Seiten. Eine Sitzbank erlaubt den Blick in unsere Richtung, sie ist leer.
In der Ferne ragt ein unidentifizierbares Bauwerk ein Stück in die Luft, könnte ein alte Ruine sein oder ein alleinstehendes Haus. Auch meinem Vater ist es aufgefallen. Das werden wir uns genauer ansehen, gibt er mir zu verstehen. Sein Plan ist es, die Dunkelheit der Tannen zu unserer Rechten zu nutzen, wir robben also noch ein kleines Stück weiter in diese Richtung und verschwinden im Schwarz der Schatten. Nachdem wir uns aufgerichtet haben und einige Schritte gegangen sind, werden die Umrisse des Objektes klarer. Es scheint sich um eine kleine Scheune mit einem Speichertank daneben zu handeln. Das Scheunendach verläuft spitz zu und der Tank ragt daneben ein paar Meter höher in den Nachthimmel. Licht brennt keines. Wir setzen unseren Weg fort, müssen gleich aber wieder die Schatten verlassen. Mein Vater stoppt und hält einmal mehr den Zeigefinger vor den Mund. Er lauscht. Ein leichtes Klappern ist zu hören oder ist es mehr ein Quietschen? Dann knackt es plötzlich hinter uns im Wald. Blitzartig drehen wir uns um und werfen uns zu Boden. Der Ast, so meine Vermutung, muss ein gutes Stück im Wald zu Bruch gegangen sein. Es ist wieder ruhig. Dann wieder das Quietschen aus der anderen Richtung, kaum wahrnehmbar. Zeit, sich zu entscheiden, wir können hier nicht ewig verharren. Mein Vater deutet auf die Scheune, wir robben los. Das Quietschen verstummt immer wieder, kommt dann zurück und wird manchmal von einem Klappern gefolgt. Es handelt sich offenbar um eine schwingende Tür oder ein Fenster, das im leichten Wind hin und her schwingt und dann gegen den eigenen Rahmen stößt, ohne zu schließen. An sich ein gutes Zeichen, denn es deutet darauf hin, dass die Scheune verlassen ist. Ich drehe mich um, war das da ein Schatten, der sich bewegt hat oder spielen mir meine Augen einen Streich? Verdammt schwer, irgendetwas in der Dunkelheit der Bäume zu erkennen. Es sind vielleicht noch 50m bis zur Scheune, als ein lauter Knall ertönt. Keine Armlänge neben mir trifft etwas den Boden, das war knapp. Es vergehen keine zwei Sekunden, dann knallt es wieder. Jemand aus dem Wald schießt auf uns. Agil springt mein Vater auf und läuft in möglichst geduckter Haltung Zickzacklinien. Ich tue es ihm gleich und versuche, schnell voran zu kommen. Normalerweise kann man 50m in ein paar Sekunden zurücklegen, doch mir kommt es vor, als würden wir minutenlang versuchen, den Schüssen auszuweichen. Wieder ein Knall, das Holz der Scheune splittert. Mein Vater ist knapp vor mir, ich blicke hinter uns und sehe gleich zwei Funken aufblitzen, die Schüsse werden gefolgt von einem Aufstöhnen. Kurz nur. Dann sinkt mein Vater vor mir zu Boden und ich reiße die Augen auf und erwache.
Hannes Truggenbrot, Ehemann von Svenja Truggenbrot, Vater von Rolf Truggenbrot, verstorben im Alter von nur 36 Jahren. Damals war ich 12 Jahre alt. Die genauen Umstände des Todes sind bis heute nicht bekannt. Mein Vater war beim Wehrdienst und wurde für einen Einsatz ins Ausland geschickt, ja, in ein Kriegsgebiet, aber laut offizieller Stelle nicht gefährlich. Eigentlich sollte sein Einsatz nur vier Wochen dauern, doch er wurde zweimal verlängert und in der elften Woche erreichte meine Mutter dann die Nachricht. Ein Hauptmann, so erzählt sie immer, stand an einem Novemberabend vor unserer Haustür. Er berichtete, dass Papa in einem nächtlichen Einsatz verschollen sei. Der Funkkontakt sei plötzlich abgebrochen und da nach zehn Tagen keine Spur von ihm auffindbar war und die Gegend dafür bekannt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, keine Gefangenen zu machen, schätzten die Offiziere vor Ort die Überlebenschancen auf unter einem Prozent.
Sie sollten recht behalten, obgleich der Leichnam nie gefunden wurde. Nur wenige Wochen später begannen die Alpträume und dauern bis heute, 32 Jahre später an. Auf Grund meines Berufes als Journalist habe ich viele Quellen angezapft, um mehr Klarheit über die Vorfälle damals zu bekommen, aber gebracht hat es nichts. Immer wieder verlief ich mich in Sackgassen, immer wieder verliefen sich die Spuren im Sand. Bei den Einsätzen sind noch zwei weitere Männer spurlos verschwunden und die damals verantwortlichen Offiziere sind inzwischen alle tot. Einige Dokumente sind wegen Geheimhaltung noch weitere zwanzig Jahre unter Verschluss, andere Dokumente sind zwar zugänglich, aber meist fast durchgehend geschwärzt. Es stinkt alles zum Himmel. Bei meinen Recherchen hatte ich stets das Gefühl, dass die Wahrheit einfach nicht ans Licht kommen soll. Ob die Träume jemals aufhören? Ich bezweifle es.
Die Nachricht über den vermutlichen Tod meines Vaters traf meine Mutter und mich hart und unerwartet. Ich habe ihn abgöttisch geliebt. Jeden Tag, an den ich mich erinnern kann, zeigte er mir, wie viel ich ihm bedeutete. Er sagte es nicht nur, er zeigte es. In seinen Gesten und in seiner Mimik lag reine Liebe für mich. Er war ein unglaublich guter und geduldiger Lehrer, der mir erklärte, wie die Natur funktioniert, was es mit den Sternen auf sich hat und wieso es Ebbe und Flut gibt. Er regte meine Neugier an und ließ mich alles erforschen, was ich wollte. Meiner Mutter fiel mehr die Rolle zu, mich hier und da in meinen Bestrebungen zu zügeln und zu bremsen. Auch sie wollte natürlich nur das Beste für mich, aber wuchs irgendwie mit der Zeit in diese Rolle hinein. Nach dem Tod konnte sie diese Rolle leider nie wirklich ablegen, blieb die Mahnerin und war übervorsichtig bei allem, was auch nur im Ansatz gefährlich hätte sein können. Dies brachte einen klaren Bruch in unsere Beziehung, weshalb ich mich öfters aus dem Haus schlich, Hauptsache weg von ihr und ihrem Aufsichtswahn. Wozu diese Ausflüge führten, wenn ich dann wieder heimkehrte, kann man sich denken.
Hilfe im täglichen Leben bekam meine Mutter durch meinen Onkel, der sich verstärkt um die Aufgaben kümmerte, die sonst mein Vater erledigt hatte: Reparaturen, Verwaltungskram und die Gartenarbeit. Er war auch Journalist und ermutigte mich immer wieder, mich auch in dieser Richtung zu betätigen. Ich machte mehrere Praktika bei Zeitungen und schrieb für die Schülerzeitung monatlich mindestens zwei lange Berichte. Recherchieren machte mir Spaß und deckte meine große Neugier zumindest zum Teil ab. Ich fragte meinen Onkel damals, ob er nicht herausfinden könnte, was wirklich passiert sei, aber er antwortete nur, dass ihm die Hände gebunden seien. Damals konnte ich nicht fassen, dass er sich nicht mehr dahinter zu klemmen schien. Er war nicht so gut im Erklären wie mein Vater. Heute weiß ich, was ihn in seinen Recherchen stoppte. Wir haben uns schon oft über das Thema unterhalten. Der Tod von Hannes Truggenbrot bleibt nach wie vor ein Rätsel, Nachforschungen werden große Steine in den Weg gelegt und immer mehr Menschen, die Informationen hätten, versterben. Mit ihnen stirbt auch das Wissen über die Vorfälle. Wer weiß, ob die Wahrheit je ans Licht kommen wird.
Ich schalte das Licht meiner Nachttischlampe ein und sehe mich um. Die weißen Wände starren mir ausdruckslos entgegen, die ebenso weiße Decke wirkt erdrückend. Außer meinem nussbraunem, viertürigen Kleiderschrank, meinem farblich dazu passendem Nachttisch mit zwei Schubladen, meinem 1,60m breiten Metallbett und meinem viereckigen Bambuswäschekorb ist das Zimmer leer. Der laminierte Boden hat bereits zwei Dellen vom Vormieter und der kleine darauf befindliche grüne Teppich, ein Überbleibsel aus meiner letzten Beziehung, ist fast der einzige Farbklecks, der erkennbar ist. Die Jalousien sind unten, Gardinen hab ich nicht. Wofür auch? In den zweiten Stock kann man von der Straße ohnehin nicht hineingucken. Das letzte Mal, das eine Frau hier übernachtet hat, ist Jahre her, vier oder fünf. Sie sagte, es sei lieblos eingerichtet, so steril und eintönig. Ich habe da kein Auge für, klar ist es einfach gehalten, aber eben auch praktisch. Keine Pflanzen, die man gießen muss und die dann doch eingehen, keine kitschigen Objekte oder Fotos, die einen an längst vergangene Zeiten erinnern und auch kein sonstiger Krimskrams, der nur unnötig Geld kostet.
An ein Wiedereinschlafen ist nicht zu denken. Nicht unbedingt, weil ich es nicht könnte, eher, weil ich es nicht will. Die reale Welt um 4:55 Uhr ist deutlich friedlicher als die Traumwelt. Kaum eine Menschenseele ist auf den Beinen und erst nach und nach wird der Geräuschpegel des Alltags die Oberhand über die Stille ergreifen. Stille ist etwas Merkwürdiges, kurz aushalten kann man sie ja, aber dann macht sie einen verrückt. Ich überlege das Radio meines Weckers einzuschalten, aber gleich kommen nur die Nachrichten, man kann den Tag auch angenehmer starten. Von den neuesten Dingen in der Welt erfahre ich noch früh genug. Die Beine aus dem Bett geschwungen, richte ich mich langsam auf und strecke mich, hole meine grauen, gefilzten Hausschuhe unter dem Bett hervor, werfe meinen weißen Morgenmantel über und begebe mich durch den kleinen Flur in die Küche. Selbige ist nur knapp 10qm groß und dennoch viel zu überdimensioniert. Allein gekocht hab ich hier noch nie. Aber die Kaffeemaschine ist top und der Wasserkocher hat auch schon Wasser für den ein oder anderen Tee erhitzt. Es ist auch nicht so, dass ich nicht Vorräte da hätte, nur schmeiße ich 80 Prozent davon irgendwann nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums weg. Reinste Geldverschwendung, aber im Notfall will man ja doch was da haben. Zuletzt aussortiert habe ich vor ungefähr zwei Wochen. Eine ganze Klappkiste habe ich entsorgt, mir war nicht einmal bewusst, dass ich überhaupt so viel gekauft hatte. Von Konfitüre über Knäckebrot bis hin zu Dosengemüse war alles dabei, teilweise über ein Jahr abgelaufen. Bei ein paar Wochen schmeiße ich die Sachen nicht gleich weg, aber irgendwann ist die Grenze dann auch erreicht. Eine Zeit lang war ein Kollege regelmäßig nach der Arbeit mit zu mir gekommen, als wir gemeinsam an einem Artikel über den geplanten Autobahnausbau durch den Nachbarort geschrieben haben. Da gingen einige der kleineren Sachen weg, zum Beispiel so asiatische Terrinen und vorgefertigte Pfannkuchen, die man nur in der Pfanne heiß machen muss. Höchstwahrscheinlich habe ich danach einmal zu viel eingekauft und als ich dann wieder komplett allein war, stapelte sich alles im Abstellraum. Wie dem auch sei, jetzt ist wieder Platz und Besuch hat sich für die nächsten zwei Wochen bislang nicht angekündigt.
Ich öffne die Jalousien in allen Zimmern und blicke schließlich im Wohnzimmer durch das große Klappfenster hinaus. Im letzten Jahr ließ der Vermieter alle Jalousien elektrisch umstellen, davor musste man noch selbst kurbeln, jetzt reicht ein Knopfdruck und in aller Seelenruhe fährt eine Lamelle nach der anderen nach oben. Gegenüber steht quasi das selbe Reihenhaus wie das, in dem ich wohne. Dahinter nochmal und dahinter nochmal. Viermal das genau gleich Bauwerk, einzig unterschieden durch die Menschen, die es bewohnen. Die Fassade wirkt trist, was aber auch nur so wirken kann, weil meine Fenster das letzte Mal vor - ich muss überlegen - wahrscheinlich vor zwei Jahren geputzt wurden. Damals kam meine Mutter zu Besuch und ich wollte keinen völlig schockierenden Eindruck hinterlassen. Ist mir allerdings nur zum Teil gelungen. Das Dach läuft leicht spitz zu, bietet aber keinen Platz für einen Dachboden. Die Wohnungen besitzen alle einen kleinen Balkon. Wenn man sich ganz dünn macht, passen sogar zwei Stühle drauf. Ich selbst verbringe nie Zeit dort, aber andere Parteien haben ihre tatsächlich mit Pflanzen behangen oder sogar einen kleinen Grill dort stehen, quasi eine zweite Küche - nichts für mich.
Automatisch führt mich mein Weg ins Badezimmer. Zeit für den schlimmsten Moment des Morgens: den Blick in den Spiegel. “Du siehst heute schlimm aus.”, murmele ich vor mich hin. Die Augenränder sind tief, die Augen selbst klein. Die Wangen, früher straff und rund, fallen langsam ein und hängen nur noch schlaff da. Die Haare sind völlig zerzaust, der Bart zu lang. “Kein Wunder, dass du so niemanden findest.” Ich greife zum elektrischen Bartschneider und stutze den Bart zurecht. Danach schnappe ich mir meinen Kamm und versuche, die Haare geschickt über die kahlen Stellen zu verteilen. Geht schon irgendwie, so genau schaut eh keiner hin. Zeit für die nächste Tasse Kaffee. Eine der zwei Birnen der Küchenlampe flackert, die andere ist seit Monaten kaputt. Muss ich unbedingt mal dem Vermieter sagen, der soll sich drum kümmern.

Die Funktionskleidung saß auch schon mal besser. Wäre ich letzte Woche doch noch zweimal mehr trotz des schlechten Wetters gelaufen. Man wird nicht jünger darf nicht so häufig als Ausrede gelten, die Beine hochzulegen und nichts zu tun. Die neuen Laufschuhe allerdings fühlen sich fantastisch an, leicht und doch gut gepolstert federn sie meine Schritte ab. Der nächste offizielle Marathon ist nur noch knapp zwei Monate weg, bis dahin steht drei- bis viermal die Woche laufen auf dem Programm - immer mindestens einen Halbmarathon und mindestens einmal in der Woche auch die Gesamtstrecke. So schnell wie vor fünf Jahren bin ich nicht mehr, aber bei den letzten drei Rennen war ich immer unter den besten Fünf in meinem Alter. In den Rennen merke ich den Unterschied zu den alltäglichen Läufen. Letztere sind durch hügeliges Terrain und daher bedeutend anstrengender als die flachen Laufstrecken, bei denen es um Medaillen geht. Zwei Silbermedaillen liegen in der Schublade meines Schreibtisches, für Gold hat es nie gereicht. Ich rede natürlich nicht von Olympia, das waren immer ganz andere Dimensionen mit all den Stars aus Afrika.
Eines der Probleme, wenn man in einer Stadt Marathon laufen möchte, ist der Verkehr. Es dauerte knapp sechs Monate, bis ich eine Strecke gefunden hatte, bei der ich auf keine Ampel warten musste und ohne anzuhalten durchlaufen konnte. Dabei handelt es sich um einen Rundkurs, der entlang der Goethestraße führt, beim Theater links reingeht, vorbei am Zoo und dem kleinen Naturschutzgebiet bis an den Stadtrand. Von dort aus schwenke ich in Richtung Tannenallee, dann wieder links in die kleine Parkanlage beim Sendeturm, vorbei an meiner Arbeitsstätte und über die Fußgängerbrücke zurück wieder Richtung Goethestraße. Beim ganzen Marathon drehe ich zwei von diesen Runden. Heute habe ich die Zeit dafür, schließlich war ich ja früh hoch.
Als ich am Theater vorbeilaufe, lese ich auf einem der Schilder, dass heute Abend eine Vorführung von einem regionalen Künstler läuft, über den ich auch schon geschrieben habe. Sein Name ist Bernard Veteri und sein neuesten Stück Der Preis der Erkenntnis soll sehr tiefgründig sein. Vielleicht kann ich es mir zu Recherchezwecken demnächst anschauen. Ein paar Minuten später ist die kleine Parkanlage, wie ich erwartet hatte, noch ziemlich verlassen. Lediglich eine ältere Dame mit Hund begegnet mir dort, würdigt mich allerdings keines Blickes. Wer weiß, wo sie mit ihren Gedanken war. An der Fußgängerbrücke, die über insgesamt vier Spuren verläuft, hängt ein großer Banner, der mir ins Auge fällt. Welchen Sinn oder von wem er dort aufgehängt worden ist, erschließt sich mir zwar nicht, aber in großen Buchstaben ist dort zu lesen: Das Wahre vom Bequemen zu unterscheiden, erfordert Mut. Klingt wie aus einem Film, irgendwas, das eine alte, weise Frau zu einer jungen Frau sagen würde.
Nach Ende meiner ersten Runde kommen mir Seitenstechen, das passiert mir alle paar Wochen immer wieder mal. Gewöhnlich verschwinden die Schmerzen aber nach kurzer Pause schnell und ich kann meinen Lauf fortsetzen. Wäre heute Wettkampf, würde ich selbstverständlich durchlaufen, aber den Zwang brauche ich mir in meinem Alter, jetzt beim normalen Laufen, nicht zu geben. Ich halte deshalb in der Nähe eines Kiosks an, neben dem eine Litfaßsäule steht. Wer liest die Anzeigen darauf überhaupt noch im Zeitalter von Smartphones und Social Media? Mindestens eine Person, ertappe ich mich selbst. Nochmals Werbung für das Theater, eine entlaufene Katze wird vermisst, veraltete Anzeigen von diversen Konzerten und noch so ein seltsamer Spruch, der ohne Grund dort steht: Wie eine Pflanze irgendwann den Weg durch den Asphalt findet, so findet auch der Kern der Wahrheit irgendwann den Weg durch das Geflecht an Lügen. Ob das alles Teil einer großen Kampagne ist? Aber wofür?
“Die neuen Forschungsergebnisse sind bahnbrechend. Niemand hätte gedacht, dass so etwas möglich ist.”, höre ich einen jungen Mann sagen. Seine Gesprächspartnerin erwidert, “Ich zuallerletzt! Ich bin damit aufgewachsen, dass es nichts, aber auch gar nichts gibt, was in der Lage wäre, die chemische Verbindung zwischen diesen Molekülen aufrechtzuerhalten - es macht ja auch gar keinen Sinn.” Wahrscheinlich sind die zwei Arbeitskollegen, irgendwelche Forscher. Der Mann nickt. “Eigentlich nicht, aber die Versuche haben es ein ums andere Mal gezeigt. Die veröffentlichten Paper scheinen stichfest zu sein. Ist ein wenig so, wie die Menschen sich gefühlt haben müssen, als die Erkenntnis aufkam, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern sich um die Sonne dreht.” Sie lacht nur. “Also dieser Vergleich ist doch etwas überzogen. Du sollst doch nicht immer übertreiben.”, ermahnt sie ihren Gesprächspartner und fügt dann an, ”Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, damit diese Entdeckung Auswirkungen auf unser aller Leben haben wird.” Worüber die zwei wohl genau sprechen? Nachdenklich blickt der Mann gen Himmel: “Das weiß wohl nur Gott, aber wenn du mich fragst, nicht lange. Bei all dem wissenschaftlichen Fortschritt, den die Menschheit in den letzten Jahren gemacht hat, bei all der Beschleunigung und bei all dem rasanten Wandel finden die schlauen Köpfe da oben bestimmt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre diverse geniale Anwendungen. Und der Markt regelt den Rest, das ist ja bekannt.” Es wird Zeit weiterzulaufen, denn das Seitenstechen hat aufgehört. Worum es bei dem Gespräch genau ging, finde ich leider nicht heraus. Aber was soll’s, auf in die zweite Runde.
Am Ende meiner zweiten Runde, die ich ohne jegliche Beschwerden absolviere, halte ich noch kurz beim Bäcker um die Ecke - ja, den gibt es hier tatsächlich noch - und hole mir zwei belegte Brötchen mit Salat, einem saftigen Stück Fleisch und ein paar Gurken und Tomaten. So günstig kann man es ja nicht selber machen, zumal die Zeit für die Zubereitung wirklich besser genutzt werden kann. Ich bezahle bar, da gehöre ich zur aussterbenden Sorte. Die meisten Menschen, die mir in meinem Alltag sonst beim Einkaufen auffallen, sind überzeugte Kartenzahler. Ich mag das Kleingeld aber irgendwie und für meine Laufrunden habe ich immer einen kleinen Bauchbeutel dabei.
Wieder daheim angekommen, packe ich mir eines der Brötchen für die Arbeit ein, das andere verzehre ich zusammen mit einer weiteren Tasse Kaffee. Beim Überfliegen der Zeitung stoße ich auf kein besonders spannendes Thema, aber auf der Arbeit werde ich sicher noch über was stolpern. Eigentlich gibt es ja heutzutage keinen Tag mehr, an dem nicht irgendetwas Weltbewegendes geschieht. Der Kaffee ist schon ein wenig abgekühlt inzwischen, das tut der Wirkung aber keinen Abbruch. Ich fühle mich fit für den Tag und die verkürzte Nacht auf Grund des Alptraums ist fast vergessen. Ich springe noch schnell unter die Dusche, putze die Zähne und schmeiße mich in meinen legeren, dunkelblauen Anzug. Viele der Kollegen tragen inzwischen nur noch Jeans und T-Shirt oder Pullover zur Arbeit, aber ich finde, elegante Kleidung gehört schon zum guten Stil, gerade auch, wenn man mal Interviews führt. Es muss ja nicht piekfein sein, also keine Krawatte oder so, aber ein bisschen Klasse gehört sich schon.
Beim Anziehen meiner Schuhe fällt mir ein, dass ich noch zwei Dokumente mit zur Arbeit nehmen wollte. Ich stapfe ins Arbeitszimmer, blicke auf einen Berg Papiere und zwei große Tafeln mit Zeitungsausschnitten und Pinnadeln, die Verbindungen anzeigen, ganz so wie man es aus guten Filmen kennt. Ich bin altmodisch, was das betrifft. Andere machen inzwischen alles digital und brauchen kaum noch Papier und Tafeln, aber mir ist das zu eingeengt. Ich brauche das Bild möglichst lebensgroß vor mir. Dann funktioniert mein Kopf besser und Zusammenhänge fallen mir auf, die ich sonst nie erkennen würde. Es dauert bestimmt zehn Minuten, bis ich die beiden Dokumente gefunden habe, aber was lange währt, wird gut, heißt es ja so schön. Ich müsste mal wieder etwas mehr Ordnung schaffen, dann ginge es bestimmt schneller. Am liebsten hätte ich eine Sekretärin, die das für mich erledigt, aber wer blickt schon durch das Chaos, was ich tagtäglich fabriziere. Der Gedanke ringt mir ein Lächeln ab.
Auf dem Hausflur ist es laut. Michael und Dennis müssen zur Schule beziehungsweise in den Kindergarten. Die zwei haben beide ein unfassbares Organ, was sie auch mehr als genug in Schreiwettbewerben gegeneinander demonstrieren. Ich frage mich, was in der Erziehung dort falsch läuft. Wahrscheinlich sind die Eltern einfach zu lasch, lassen den Kindern alles durchgehen. Ich sage ja nicht, dass es früher richtig war, die Kinder mit dem Rohrstock zu schlagen, aber in gewisser Weise übertreiben es die meisten Eltern jetzt in der anderen Richtung. Egal was das Kind tut, es ist ein Engel, böse Worte oder Zurechtweisungen sind verpönt. Die Folge ist mangelnder Respekt vor Erwachsenen, Missachtung von einfachsten Verhaltensregeln und fehlendes Gespür dafür, wann eine Grenze erreicht ist. Manchmal mache ich mir echte Sorgen über die zukünftigen Erwachsenen und dabei bekleckert sich meine Generation schon nicht mit Ruhm.
Ich öffne die Wohnungstür und ein kreischendes “Ich will meine Jacke aber heute nicht anziehen. Es ist viel zu heiß!”, peitscht mir entgegen. “Tag.”, sage ich kurz und knapp. “Guten Morgen Herr Truggenbrot, welch schöner Tag heute, wie geht es Ihnen?”, fragt Frau Dinsel, ich glaube Jennifer ist ihr Vorname. “Den Umständen entsprechend.”, antwortete ich, ohne genauer auf selbige einzugehen. Nach kurzem Stutzen sagt sie: “Die Kinder haben schlecht geschlafen die Nacht und sind etwas aufgebracht. Ich bitte das zu entschuldigen, sie können hin und wieder ganz schön Krach machen.” Hin und wieder ist gut, denke ich mir, bis 21 Uhr ist täglich nicht an ruhiges Arbeiten von zu Hause aus zu denken. Immer wieder schreien die Kinder, immer wieder gibt es Gemecker und immer wieder knallen Türen. Erst wenn die Gören im Bett sind, wird es ruhiger. “Ja.”, ist alles, was ich hervorbringe und beginne, die Treppe hinab zu steigen. Frau Dinsel wünscht mir noch einen schönen Tag. Kurz vor der Haustür angekommen, höre ich eines der Kinder fragen: “Mama, wieso ist der Mann so seltsam und redet so wenig?” Ich bilde mir ein, einen Seufzer zu hören, “Ach Dennis, wahrscheinlich ist er nur sehr im Stress wegen der Arbeit. Du weißt doch, er ist Journalist, das ist ein anstrengender Job.” Damit hat es nicht so viel zu tun, genervt von deinem Lärm würde es besser treffen.
Ich trete hinaus ins Freie und lege die knapp 200m zur Bushaltestelle zurück. Ich besitze zwar seit meinem zwanzigsten Lebensjahr einen Führerschein, aber ein eigenes Auto besitze ich nicht. Die wichtigsten Orte sind zu Fuß oder mit dem Bus erreichbar. Das war auch schon als Kind immer so, weshalb mir die Vorstellung eines eigenen Autos immer irgendwie befremdlich vorkam. Mein Onkel drängte mich damals, den Führerschein zu machen, wofür ich ihm unterm Strich auch dankbar bin. Es gab vereinzelte Momente, in denen ich ihn gut gebrauchen konnte. Zuletzt fahre ich aber lediglich noch von der Arbeit aus, wenn meine Recherche verlangt in kleine, abgelegenere Orte zu reisen. Privat nehme ich mir im Zweifel einfach ein Taxi. Zur Arbeitsstelle sind es von hier aus lediglich vier Bushaltestellen, die Busse sind meist noch einigermaßen leer und ich finde in der Regel noch einen Sitzplatz. Meistens stehe ich allerdings trotzdem, für die paar Stationen lohnt es sich ja nicht, sich extra hinzusetzen. So alt fühle ich mich dann an den meisten Tagen doch noch nicht.
An der Bushaltestelle sehe ich schon wieder eines dieser Plakate. Dieses Mal steht drauf: Man will nur wissen, was einem hilft, das eigene Weltbild zu bestätigen. Mit dem Spruch kann ich wenig anfangen. Für meine Recherchen will ich allerlei Dinge erfahren, als Journalist muss man schließlich nachhaken und der Wahrheit auf den Grund kommen. Da kann man sich nicht nur hinstellen und sich die Kirschen raussuchen. Wie sollte das denn funktionieren? Man muss schon immer versuchen, möglichst viele Seiten zu beleuchten, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Wenn ich Nachforschungen anstelle, reichen sogar meine zwei großen Tafeln in manchen Fällen nicht aus, aber zum Glück habe ich noch zwei weitere im Keller stehen. Wenn es wirklich eng wird, hole ich eine oder sogar beide davon auch noch hoch. Aber gut, nicht jeder Mensch ist journalistisch ausgebildet und weiß diese Dinge. Kann schon sein, dass der Spruch für andere zutrifft.
Ich bin an diesem Morgen der einzige Gast, der auf den Bus wartet. Drei Minuten habe ich noch Zeit und blicke mich um. Die Straßen sind normal gefüllt, die wenigen Fußgänger sind mit geneigtem Kopf auf ihre Handys fixiert und sehen sich wahrscheinlich die aktuellen Aktionskurse an. Oder sie surfen in den sozialen Medien. Da fällt mir ein, dass ich doch auch noch was nachschauen wollte. Ich zücke mein Handy, aktiviere mit meinem Daumen den Zugang und prüfe die neusten Nachrichten. Sieben sind es heute Morgen. Sechs davon brauche ich nach Kenntnisnahme der Absender gar nicht erst zu lesen und die siebte ist von meiner Mutter. Aus Pflichtgefühl öffne ich sie. Sie würde sich freuen, wenn ich mich mal wieder bei ihr melde. Ihr Auto müsste mal wieder in die Reparatur, ob ich nicht Zeit hätte, mal vorbeizuschauen. Ich antworte kurz und knapp, dass es vielleicht am Wochenende klappen könnte. Lust habe ich ja keine.
Als ich mit 24 Jahren endlich ausgezogen bin, hatte ich die Schnauze komplett voll von meiner Mutter. Dieses ewige Genörgel war nicht mehr auszuhalten. Die ersten drei Jahre danach habe ich sie nicht einmal besucht. Nicht mal zu Weihnachten haben wir uns gesehen. Sie war zwar nicht besonders glücklich darüber, aber das war mir egal. Im Endeffekt hat dann wieder mal mein Onkel dafür gesorgt, dass wir uns zumindest wieder ein bisschen annähern. Wir haben einander einfach nicht viel zu erzählen. Sie interessiert sich nicht dafür, was ich mache, sondern immer nur dafür, ob ich endlich eine Frau gefunden habe. Natürlich nicht. Und wenn würde das eh nicht lang halten. Schau dir doch die Beziehungen in der Welt an, das lohnt sich doch alles nicht, sage ich ihr immer. Aber wenn sie das akzeptieren würde, hätte sie wahrscheinlich nichts mehr zu meckern. Wir telefonieren inzwischen regelmäßig einmal im Monat, das reicht uns beiden - mir vor allem - dann aber wieder. Unser Verhältnis hat sich über die letzten Jahre insgesamt zwar stabilisiert, aber Freude bereitet mir ein Besuch trotzdem nicht. Es ist auszuhalten, sofern es nicht zu lange dauert und nicht zu viele Fragen gestellt werden.
Ich wollte doch aber noch irgendwas anderes schauen. Vergessen, fällt mir schon wieder ein. Da kommt auch der Bus, sechs Minuten Verspätung, ganz schön viel für die frühe Uhrzeit. Er hält mit der hinteren Tür neben mir, so dass ich genug Zeit habe, die Aufschrift zu lesen: Heute schon aufgewacht? Werbung für Matratzen, auf denen man himmlisch gut schlafen können soll. Aufgewacht schon, sonst könnte ich das ja jetzt nicht lesen, denke ich mir. Bei all dem Blödsinn wäre eine weitere Runde Schlaf vielleicht gar nicht so verkehrt, aber auf der Arbeit werde ich dazu keine Zeit haben. Ich steige ein und halte meine Fahrkarte hoch. Der Busfahrer erkennt mich im Spiegel und nickt mir zu, die Tür schließt und der Bus setzt sich in Bewegung. Kaum ist der Bus losgefahren, klingelt mein Handy. Das Display signalisiert einen Anruf von Richard Zweigritter, meinem Chef und Redaktionsleiter der Zeitung. Wir kennen uns seit meinem Vorstellungsgespräch vor etlichen Jahren. Er war damals federführend bei meinem Interview und beeindruckte mich zutiefst mit seinem Wissen und seiner Menschenkenntnis. Auf Anhieb haben wir uns verstanden und fortan ist er so etwas wie mein Ziehvater in der Zeitung geworden. Klar lernt man im Studium so allerlei über Journalismus, aber die Praxis sieht doch immer etwas anders aus. Was ich von Richard gelernt habe, könnte ich zwar heute schon in einem großen Band über das perfekte Schreiben von Artikeln zusammenfassen, aber würde wohl trotzdem nur einen Bruchteil seines Wissens wiedergeben.
“Guten Morgen Richard, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, was kann ich für dich tun?”, begrüße ich ihn. “Guten Morgen Rolf, ich habe eine Frage. Traust du dir zu, einen Artikel oder sogar eine Reihe von Artikeln über einen Musiker zu schreiben? Ich weiß, das ist sonst nicht dein Gebiet, aber hast du nicht schon mal so etwas gemacht?” Vor ein Paar Jahren war tatsächlich mal eine lokale Band ins Rampenlicht gerückt, weil sie einen sehr erfolgreichen Song produziert hatte. Als sie daraufhin erstaunlich hohe Beträge für soziale Stiftungen gespendet haben, sind sie auch in meinen Fokus gerückt und ich habe sie interviewt. Beeindruckende Menschen waren das, die sehr bodenständig waren und sich nicht viel aus ihrem plötzlichen Ruhm machten. Was sie jetzt machen, weiß ich aber nicht. Ich habe ewig nichts mehr von ihnen gehört. “Ja, da war mal was. Aber wir haben doch mit Christian und Evelyn zwei Mitarbeiter, deren Ressort dazu viel besser passt oder gibt es besondere Hintergründe?” Christian und Evelyn sind beide im Kulturbereich tätig, während ich mich mehr um Soziales und Recht kümmere, manchmal auch in Richtung Unterhaltung aber eher selten. “Christian hat Urlaub die nächsten zwei Wochen und unglücklicherweise fällt Evelyn wegen eines Unfalls mindestens vier Wochen aus. Du bist mein erster Ersatzkandidat, weil ich weiß, was du drauf hast. Komm bitte in mein Büro, sobald du da bist, ja?” Ich antworte ihm, dass ich das natürlich mache und wir dann vor Ort alles Weitere besprechen können. Es piept und eine weibliche Stimme benennt den nächsten Stop, noch eine Haltestelle.