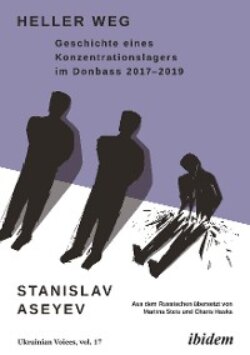Читать книгу Heller Weg: Geschichte eines Konzentrationslagers im Donbass 2017-2019 - Stanislav Aseyev - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеDer Rauch der Öfen von Sachsenhausen und Auschwitz
setzt sich auf dem Eis von Magadan und Kolyma ab.
Brüder Vajner, Im Zeichen von Schlinge und Stein
Ich weiß auch jetzt noch nicht, ob ich die richtigen Worte finden werde: Das Spektrum der Ereignisse war zu breit. Wir haben ein Leben gelebt, das vom Klicken einer Plastikflasche, das den ganzen Keller zum Aufspringen brachte, bis hin zu klassischer Musik, die an verhältnismäßig ruhigen Tagen aus dem Radio erklang, reichte. Wie diese Gegensätze erklären? Hieß die Klassik, dass genau jetzt niemand mit verschränkten Beinen im Keller kniete, mit einer Plastiktüte über dem Kopf? Nein.
In diesem Buch wird es um ein geheimes Gefängnis mitten im Zentrum von Donezk gehen. Um ein Gefängnis, das das Donezker Dachau genannt wird. Aber für die, die diesen Ort durchlebt haben, wird das Buch nicht nur eine Erzählung über ein Gefängnis sein. Das, was hinter den Mauern der Isolation geschah – denn so hieß dieses Gelände –, liegt selbst dort jenseits des gesunden Menschenverstandes, an einem Ort, an dem man, so scheint es, außer Grausamkeit nichts zu erwarten hat. Ich bin schon viele Monate in Freiheit und frage mich immer noch: "War das wirklich? Konnte so etwas mit mir geschehen?" All diese Menschen, Stromstöße, Folter und Klebeband, kollektiv gesungene Lieder, mit denen die Schreie derer übertönt werden, zu denen die Drähte führen ...
Dieses Buch war als trockene Reportage gedacht: Ohne Wertungen, Emotionen; Skizzen über das, wovon ich selbst Zeuge wurde. Als ob ich in dieses Gefängnis nicht als Gefangener, sondern als Journalist geraten wäre. In achtundzwanzig Monaten Aufenthalt in der Isolation habe ich dort einige Texte verfasst, die diesem Ausgangsgedanken entsprachen. Ich musste gefasst und lakonisch schreiben, entwarf nur das Skelett eines künftigen Buches, weil ich wusste, dass sie jederzeit alles wegnehmen und lesen könnten. Was dann tatsächlich auch geschah. Aber als ich mich in Freiheit wiederfand, erkannte ich, dass trockene Publizistik unmöglich ist: Viele Monate später überwältigen mich die Emotionen immer noch. Genau aus diesem Grund werden einige Kapitel dieses Werkes dem Leser kalt und in einigem zynisch vorkommen, während andere buchstäblich schreien werden.
Als ich dieses Buch zu schreiben begann, ahnte ich selbst nicht, wie viele Fragen es für mich aufwerfen würde. Als ich es beendete, konnte ich nicht glauben, dass ich auf keine einzige eine Antwort gefunden hatte. Vielleicht ist die Antwort dieses Buch selbst: Um es zu schreiben, musste ich überleben. Um zu überleben, war es unerlässlich zu wissen, dass ich es werde schreiben müssen. In diesen seltsamen Labyrinthen des Bewusstseins versucht das Denken einen Sinn zu finden: "Das ist alles nicht zufällig", "das konnte nicht einfach nur so geschehen …" Aber im Ergebnis ist alles, was bleibt, nur einige Sätze, die sich in Absätze fügen. Der Cursor blinkt, der Gedanke friert ein, und man sinkt wieder in den Abgrund. Die Isolation lehrt, dass es keinen Tiefpunkt an sich gibt: Es bleibt immer Raum für den Fall. Es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht. Dieses Buch handelt auch davon. Wenn man diesen Ort – dieses Gefängnis – in einem Wort auszudrücken versucht, dann wäre das "Unvermeidlichkeit", und zwar deswegen. Wenn Sie auf einen Tisch gelegt und fest mit Klebeband umwickelt werden, können Sie so viel schreien, wie Sie wollen – das wird überhaupt nichts ändern. Weder ein Beschwören der Familie noch ein Anrufen von Gott, weder Ihr Geschlecht noch Ihr Alter noch Ihre Schmerzen selbst, weder Schreck noch Schreien werden auch nur das Mindeste ändern. Das sind nicht einfach Worte – das ist der lokale Glaube, fast die Religion derer, die einige hundert Menschen auf den Foltertisch gebracht haben. Genau in einem solchen Moment erkennt der Mensch seine ganze Zerbrechlichkeit, Kraftlosigkeit, Schwäche. Er ist das Schilfrohr, über das Pascal geschrieben hat1. Vor Schmerz drängen die Gelenke förmlich nach außen, der Mensch beginnt zu schwitzen, von oben wird er – für den Effekt – mit Wasser übergossen. Unvermeidlichkeit. Es ist unnötig, zu schreien und zu betteln – sie werden nicht ablassen, sie werden Sie trotzdem foltern.
Aber, so seltsam es ist, im Hellen Weg geht es nicht um Folter. Nicht Folter definiert dieses Gefängnis. Schließlich sind allein in Donezk mindesten ein Dutzend Orte – abgesehen von der Isolation selbst – zu finden, an denen auch jetzt weiter gefoltert wird. Wie drückt man den Kern aus? Erklärt ohne Emotionen, was dieses Gefängnis darstellt? Vielleicht ist der Kontrast ein lohnender Ausgangspunkt. Ich erinnere mich, wie in der Mitte des Sommers 2018 die erste Welle der Massenverlegungen aus der Isolation in andere Gefängnisse begann. Ich selbst saß zu dieser Zeit in der fünften Zelle, und wir alle hatten schon gehört, dass in den letzten Tagen einige Leute aus der "Zweier" und der "Achter" in das Donezker Untersuchungsgefängnis gebracht worden waren. In der Zelle herrschte eine Atmosphäre, die an Weihnachten erinnerte: Viele hatten schon ihre spärlichen Habseligkeiten zusammen gesammelt und warteten darauf, wann das Wunder auch ihnen zuteilwerden sollte.
Und da öffnet sich die Tür und der Aufseher nennt vier Nachnamen zugleich und sagt: "Fertig machen!" Es ist schwierig zu beschreiben, was in diesem Moment passierte. Wir begannen, den Glückspilzen zu gratulieren, ihnen den letzten Tee und Papier zu schenken – das Einzige, was viele von uns hatten. Wir schüttelten ihnen die Hände, umarmten sie und freuten uns aufrichtig, obwohl wir unsere eigenen Namen noch nicht gehört hatten. Hätte ich nur gewusst, dass ich es erst ein Jahr später von hier ins Gefängnis schaffen würde! Aber in diesem Moment waren wir aufrichtig glücklich, denn wir alle hatten Hoffnung, dass – wenn es schon einmal seinen Anfang genommen hatte – auch wir einmal von hier fortkommen würden. Und dann öffnete sich die Tür wieder, und ein Gefangener schaffte es nicht, den ihm gerade geschenkten Tee einzupacken. Der Aufseher schrie, sie würden ohne ihn fahren – und sofort stürzte dieser Mensch, stolpernd, über die Schwelle der Zelle, schaffte es nicht einmal richtig, seine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen. Die Tür schloss sich erneut, aber in der Zelle herrschten noch immer Begeisterung und Euphorie. Und einzig der erst vor einer Woche angekommene neue Gefangene fragte befremdet: "Und wohin eilen die alle so glücklich?" "Ins Gefängnis", antworteten wir ebenso verdutzt.
Kann man sich so etwas überhaupt vorstellen? Ja, den Tag der Verlegung hielten viele für einen Tag der Befreiung; und in gewisser Weise sagt das mehr über die Isolation aus als Schreie und Stromschläge. Manchmal schien es uns, als sei all das ein Experiment. Die Irrealität dessen, was passierte, in Kombination mit Dutzenden Überwachungskameras, führten zu solch seltsamen Gedanken. Es schien, dass die Verantwortlichen dieses Ortes nach der Grenze suchten: "Was, wenn man noch etwas mehr Druck ausübt? Kommandiert: 'Gib Laut! Unter die Pritsche!' Beginnt er, wie ein Hund zu heulen oder nicht? Sieh an, er hat aufgeheult. Jetzt kann man das Glied aus der Hose holen …"
Alles wird eindeutig festgehalten: In jeder Zelle, in den Karzern, in jedem Keller ist eine Videokamera installiert, Terabytes an Videoaufzeichnungen, hunderte Stunden für internationale Gerichte. Desto mehr erscheint es wie ein Experiment: Menschen können nicht sechs Jahre ungestraft, zynisch gegenüber jedem UN-Bericht weiter ihre Verbrechen filmen. Oder können sie es doch? In diesem Fall wäre die Isolation genau die Antwort darauf, was sie ist, unsere Welt. Alle Sinnlosigkeit, alle Grausamkeit und Ungerechtigkeit haben sich exakt hier, auf der "Straße des Hellen Wegs Nr. 3", konzentriert. Ohne Strafe, ohne Abrechnung, mit Gelächter über uns, die Besiegten. Mögen sich viele mit dem künftigen, dem Jüngsten Gericht trösten. Ich glaube nicht daran. An was glaube ich? An das Gelächter dieser Leute in den Kellern, wenn sie jemanden mit Klebeband am Tisch fixieren.
Ich werde oft gefragt, ob ich diesen Leuten verziehen habe. Nun, meine Gefühle ihnen gegenüber sind nicht einfach Hass, sie sind tiefer. Verzeihen kann man denen, die man hasst; dieser Ort steht aber außerhalb jeglichen Sinns, darunter auch des Sinns des Verzeihens. So sehe ich die Dinge. Vielleicht denkt jemand anders.
1 "Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das schwächste der Natur, aber er ist ein denkendes Schilfrohr." (Blaise Pascal, 1623–1662, frz. Mathematiker und Physiker) (A.d.Ü)