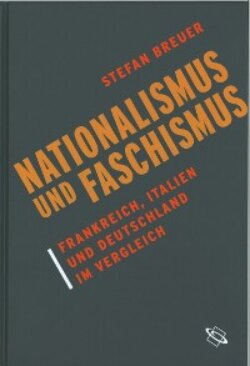Читать книгу Nationalismus und Faschismus - Stefan Breuer - Страница 10
1.2 Nation – Nationalbewußtsein – Nationalismus
ОглавлениеNimmt man diese Bestimmungen ernst, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß sich ein erheblicher Teil der neueren Nationalismusforschung auf Zusammenhänge bezieht, die bestenfalls im Vorfeld des hier Gemeinten liegen. Das gilt speziell für jene primär kommunikationstheoretischen Deutungen, die als Nationalismus jede Semantik identifizieren, bei der „die Zugehörigkeit einer Personengruppe zu einer ‘Nation’ ein wesentliches Kriterium ist, an dem das Selbstverständnis von der politischen, sozialen und/oder kulturellen Lebensführung dieser Personengruppe ausgerichtet wird“33. In dieser Perspektive liegt etwa (deutscher) Nationalismus bereits dann vor, „wenn die Existenz einer deutschen Nation oder eines deutschen Volkes (…) axiomatisch behauptet oder vorausgesetzt wird“, gilt als Nationalist jeder, „für den das ‘Volk’ mehr ist als die Summe seiner Teile, nämlich ein handelndes und leidendes Subjekt der Geschichte“34. So sieht es auch Philip S. Gorski, wenn er als Nationalismus „any set of discourses or practices“ definiert, „that invoke ‘the nation’ or equivalent categories“35.
Nur unwesentlich weiter gehen diejenigen, die den Nationalismus eher handlungstheoretisch als Verwirklichung einer bestimmten Gemeinschaftsvorstellung deuten, wie z. B. Anderson, Hobsbawm oder auch David A. Bell, der den Nationalismus als Bauprogramm für eine souveräne politische Gemeinschaft deutet, „grouping together people who have enough in common – whether language, customs, beliefs, traditions, or some combination of these – to allow them to act as a homogeneous, collective person“36. Nationalismus wird in all diesen Definitionen gleichbedeutend mit nationbuilding und deckt damit nur einen relativ kleinen Teil dessen ab, was den Nationalismus der Nationalisten ausmacht. Dies gilt auch noch für den gern zitierten Vorschlag Ernest Gellners, unter Nationalismus ein politisches Prinzip zu verstehen, demzufolge politische und nationale Einheiten deckungsgleich sein sollten37.
Daß sich die genannten Definitionen im Vorfeld des eigentlichen Nationalismus bewegen, besagt natürlich nicht, daß sie diesen ausschlössen. Im Gegenteil: sie sind so allgemein gehalten, daß sie ihn einschließen. Ausgesprochen oder unausgesprochen liegt den Annahmen die Vorstellung eines Kontinuums zugrunde, das von der bloßen Konstruktion einer Wir-Gruppe qua Nationssemantik bis zu den exaltierten Manifestationen dessen reicht, was dann allerdings zumeist nicht mehr als Nationalismus der Nationalisten erscheint, sondern mit Bezeichnungen wie „extremer Nationalismus“, „radikaler Nationalismus“ oder „Ultranationalismus“ belegt wird. Sehr klar bringt dies eine von Pierre-André Taguieff im Anschluß an Jean Leca entwickelte Typologie zum Ausdruck, die zwischen verschiedenen Versionen des Nationalismus unterscheidet: einer „ultra-schwachen“ Version, die auf eine (nicht notwendigerweise in der Form souveräner Staatlichkeit organisierte) Art des Self-government zielt, um ein gewisses Maß an kollektiver Identität sicherzustellen; einer „Minimalversion“, die die Gellner-Formel erfüllt, derzufolge sich die ethnischen Grenzen nicht mit den politischen Grenzen überschneiden dürfen; einer „starken“ Version, die den Nationalismus als Idee, Ideologie oder Doktrin deutet; und einer „ultra-starken“ Version, nach der die Nation einen natürlichen Charakter besitzt und allem anderen überzuordnen ist38.
An dieser Begriffsbildung ist zweierlei problematisch. Zum einen leuchtet nicht ein, warum der Nationalismus der Nationalisten als Steigerung und Radikalisierung eines „Normalnationalismus“ gelten soll und nicht selbst als der Normalfall, an dem sich die Konstruktion eines Idealtypus orientieren könnte. Die oben herausgearbeiteten Merkmale sind hinreichend deutlich, um die Grundlage eines Grenzbegriffs abzugeben, „an welchem die Wirklichkeit zur Verdeutlichung bestimmter bedeutsamer Bestandteile ihres empirischen Gehaltes gemessen, mit dem sie verglichen“ werden kann39. Dies gilt um so mehr, als der Nationalismus der Nationalisten schon rein sprachlich gesehen sich hierfür am besten eignet, meint doch ein Wort mit dem Suffix -ismus üblicherweise „a theory or mode of thinking“40, was man weder von der ultraschwachen noch von der schwachen Version sagen kann. Zum andern ist nicht plausibel, weshalb statt dessen auf Kommunikations- und Handlungsmuster Bezug genommen wird, die für etwas ganz anderes stehen: für die Äußerungen eines Nationalbewußtseins, einer nationalen Identität oder, aktivistischer, für nation-building. Daß diese oder jene Nation existiert, ist zunächst nur eine überprüfbare Tatsachenbehauptung und sollte sprachlich von den Absichten, Wünschen und Werturteilen getrennt werden, die sich an diese Behauptung knüpfen. Wer jede Kommunikation über Nation gleich für Nationalismus erklärt, fischt mit einem Schleppnetz: in ihm bleibt dann soviel hängen, daß am Ende nichts mehr unterscheidbar ist.
Angesichts dieser Sachlage hält man sich besser an jene Minderheit von Autoren, die ein engeres Verständnis von Nationalismus bevorzugen. Gewiß stößt man auch hier mitunter auf Fragwürdigkeiten, wie etwa die Neigung, das Nationalbewußtsein als eine Art anthropologische Konstante zu interpretieren oder den Nationalismus mit Organizismus gleichzusetzen, doch findet man dafür eine klare Erkenntnis der Besonderheit des Nationalismus als einer Ideologie oder einer Doktrin. Das gilt etwa für Isaiah Berlin, der im Nationalismus „die Erhebung des Interesses der Einheit und Selbstbestimmung der Nation zum höchsten Wert“ sieht, „dem im Konfliktfalle alle anderen Erwägungen untergeordnet werden mußten“; für Peter Alter, der zwischen dem Grundprozeß der Nationsbildung und dem Nationalismus als Ideologie und politischer Bewegung differenziert, „die sich auf die Nation und den souveränen Nationalstaat als zentrale innerweltliche Werte beziehen und die in der Lage sind, ein Volk oder eine große Bevölkerungsgruppe politisch zu mobilisieren“; oder für Kurt Hübner, der das „von einer Menge geschichtlicher Regelsysteme“ bestimmte Nationale vom Nationalismus abgrenzt, welchen er als Hypostasierung der Nation zum obersten Wert identifiziert, als Streben nach einem Zustand, in dem die Nation nichts will als sich selbst41. Auch die Arbeiten von Anthony D. Smith sind hier zu nennen, nach denen zu unterscheiden ist zwischen der von ethnisch-genealogischen und/oder staatlich-territorialen Vorgaben geprägten nationalen Identität als solcher und dem Nationalismus als einer Doktrin, „that makes the nation the object of every political endeavour and national identity the measure of every human value“42.
Die in meinen Augen präziseste Terminologie hat auf dieser Linie Bernd Estel entwickelt, der zwischen den Begriffen „ethnische Gruppe“, „Volk“, „Nation“, „Nationalbewußtsein“ und „Nationalismus“ differenziert. Eine ethnische Gruppe ist bestimmt durch einen (allerdings nur schwachen und kontingenten) Gebietsbezug, durch gewisse kulturelle Gemeinsamkeiten (etwa der Sprache, der Sitten, der Religion etc.) sowie durch ein Wir-Bewußtsein, das seinerseits geprägt ist durch den Glauben an eine gemeinsame Abstammung, durch gruppenintern geteilte historische Erinnerungen, ein gewisses, bis zum Ethnozentrismus steigerbares Überlegenheitsbewußtsein und eine allgemeine Anerkennung bestimmter mythischer bzw. historischer Personen sowie kultureller Gegebenheiten als verehrungswürdiger Symbole. Für ein Volk ist ein ähnlich geartetes Wir-Bewußtsein essentiell; hinzu kommt, neben dem Besitz eines Kerngebiets und der Existenz einer Zeugungsgemeinschaft von einiger Kontinuität und faktischer Exklusivität, die Fähigkeit, eine eigene, arbeitsteilige Gesellschaft zu bilden. Eine Nation wiederum ist ein Volk, bei dem einerseits das Kriterium der Zeugungsgemeinschaft zurücktritt, andererseits aber das mehr oder weniger vorpolitische ethnische Zusammengehörigkeitsgefühl durch ein spezifisch politisches Selbstverständnis ergänzt oder überformt wird, „eben die Auffassung, miteinander eine Gemeinschaft zu bilden bzw. bilden zu sollen, die ein natürliches Recht auf politische Unabhängigkeit besitze und die deshalb gewöhnlich auch einen eigenen, den Nationalstaat errichten oder behalten sollte. Kurz, Nation ist so eine sich mehrheitlich als eigene soziale Einheit und Gemeinschaft verstehende Bevölkerung mit dem Willen zur kollektiven Selbständigkeit“43.
Auf die Nation im so verstandenen Sinne bezieht sich das Nationalbewußtsein, das in der doppelten Form des Bewußtseins der einzelnen Person über die eigene Nation und des sozial geteilten Wissens in Gestalt eines offiziellen, herrschenden Selbstverständnisses auftritt; auf dieses letztere wiederum der Nationalismus, der durch eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung sowie durch zwei spezifische Grundannahmen bestimmt ist. Voraussetzung dafür, daß ein Nationalbewußtsein nationalistische Züge annimmt, ist die Transformation des mehr oder weniger naiven und unreflektierten Wissens über die Nation in systematisierte und kohärente Wissensbestände, „die die betreffende, womöglich erst propagierte moderne Nation umfassend, d.h. im Weltganzen deuten und dabei auch ihren menschheitlichen Rang zu bestimmen suchen“, anders gesagt: die Formulierung einer um die je eigene Nation zentrierten Weltanschauung. Nationalismus kann daraus werden, sobald sich daran die Vorstellung knüpft, die Nation besitze einen überragenden Stellenwert für die soziale und personale Wirklichkeit bzw. die Auffassung, Person und Nation seien miteinander ontisch verschränkt. Eng damit zusammen hängt die weitere Annahme, „daß die Nation ein sehr hohes ontisches und sittliches Gewicht, ja ein Dignitätsübergewicht gegenüber allen anderen sozialen Gebilden zumindest innerweltlicher Zielsetzung besitze, und daß eben primär die jeweilige Dignität der Nation über die soziale Dignität ihrer Angehörigen, d.h. ihre nach der wahren Seinsordnung gegebene Würde, ihren Wert als soziale Wesen entscheide“. Dies könne, aber müsse nicht unbedingt die Annahme einer Dignitätshierarchie implizieren, in der die je eigene Nation einen hohen, wenn nicht den höchsten Rang einnehme. Eingeschlossen aber sei darin zum einen nach innen die Forderung an die Mitglieder, sich der eigenen Nation gegenüber loyal zu verhalten, ja ihr die oberste Loyalität entgegenzubringen, zum andern nach außen die Forderung nach Freiheit und Souveränität, wie sie sich völkerrechtlich im Prinzip der Selbstbestimmung niedergeschlagen habe44.
Eine weitere Präzisierung läßt sich erreichen, wenn man sich vor Augen führt, daß „Nationalismus“ nicht nur positiv auf „Nation“ bezogen ist, sondern auch eine Negation impliziert: die Ablehnung des „Kosmopolitismus“ oder „Universalismus“. Versteht man unter cosmopolite den „Begriff für den sich an keine Nation gebunden fühlenden Weltbürger oder den abwechselnd in verschiedenen Ländern lebenden Menschen“ 45 – ein Verständnis, das für den französischen Sprachraum seit 1560 belegbar ist –, so lassen sich Kosmopolitismus und Nationalismus als Extrempunkte auf einer Skala fassen, die durch einseitige Steigerung „universalistischer“ bzw. „partikularistischer“ Orientierungen charakterisiert sind46; mit der Folge, daß im ersteren Fall die Zugehörigkeit des Individuums zu einer sozialen Einheit unterhalb der Ebene der weltbürgerlichen Gesellschaft als Zufall und keine Verpflichtung rechtfertigendes Faktum erscheint, im zweiten Fall dagegen eben diese Einheit als fensterlose Monade sich darstellt, für die der alte Satz des ultra posse nemo obligatur gilt. Extrempunkte auf einer Skala aber heißt zugleich, daß auch mit einer breiten Zone von Zwischenstufen, Ambivalenzen, Vermittlungsversuchen zu rechnen ist, bei denen es jeweils sorgfältig abzuwägen gilt, wie stark der in die eine oder die andere Richtung drängende Vektor ist47. Gerade bei den so oft für den Ursprung des Nationalismus in Anspruch genommenen Erscheinungen des späten 18. und frühen 19.Jahrhunderts – speziell der sogenannten deutschen Bewegung seit Herder – ist diese Gewichtung außerordentlich schwer, weil ebensowenig bestritten werden kann, daß die meisten Autoren (oder jedenfalls: die bedeutenderen unter ihnen) sich um eine Balance zwischen beiden achievement patterns (Parsons) bemühen, wie daß diese Balance von Fall zu Fall mißlingt48. Solange diese Konstellation unbeachtet bleibt, wird die Debatte über die „Sattelzeit“ des Nationalismus einem Pingpongspiel gleichen, bei dem stets die gleichen Zitate gegeneinander ausgespielt werden.
Die hier skizzierte Auffassung vermag einen großen Teil der Merkmale einzufangen, die oben für den Nationalismus der Nationalisten herausgestellt wurden. Im Unterschied zum konstruktivistischen Verständnis trennt sie zwischen Nation und Nationalbewußtsein auf der einen, Nationalismus auf der anderen Seite, ohne damit dem Fehlschluß zu verfallen, die beiden ersteren seien naturgegebene Größen. Sie stellt klar, daß der Nationalismus eine politische und ideologische Erscheinung ist, die auf einem bestimmten Welt- und Geschichtsbild fußt und daraus Aussagen über die Rolle der Nationen und ihr Verhältnis zu anderen Organisationen und Institutionen ableitet. Und sie trägt schließlich dem Kriterium der Höchstrelevanz Rechnung, indem sie darauf abhebt, daß die Bindung an die Nation gegenüber allen anderen Bindungen durchschlägt.