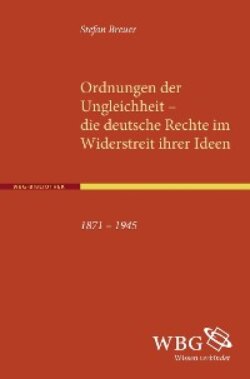Читать книгу Ordnungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871 – 1945 - Stefan Breuer - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Denker der Volksnation
ОглавлениеIm Gegensatz zur Staatsnation konstituiert sich die Volksnation über ethnische Gemeinschaftsbeziehungen. Grundlage hierfür ist, nach Max Weber, der subjektive Glaube an die Existenz von Stammverwandtschaft zwischen sozialen Gruppen, der durch Gemeinsamkeiten und Gegensätzlichkeiten des Habitus und der Gepflogenheiten ausgelöst wird (Weber 1976, 235ff.). Als identitätsstiftende Faktoren kommen dabei hauptsächlich in Frage: Sprache, Kultur, Geschichte, Religion, Sitte, der Glaube an eine gemeinsame Abstammung und dergleichen (Lepsius 1990, 235; Estel 1994, 14).
In die verwirrende Vielfalt, die sich daraus ergibt, läßt sich am ehesten eine Ordnung bringen, wenn man sich an die reinen Positionen hält. Die Rolle der Sprache für die Herausbildung eines je spezifischen Nationalgeistes wurde bekanntlich zuerst von Herder herausgestellt und später weiter elaboriert, etwa von Jacob Grimm, der das Volk als den Inbegriff von Menschen definierte, welche dieselbe Sprache sprechen, oder von Richard Böckh, der in der Sprache, der ‘Gemeinsamkeit des Logos’, das einzige Merkmal für die Zugehörigkeit zu einer Nation sah – eine Ansicht, die Resonanz sowohl bei Liberalen wie Rudolf Haym als auch bei Staatssozialisten wie Adolph Wagner fand und durch den 1881 gegründeten Allgemeinen Deutschen Schulverein weite Verbreitung erfuhr.11 In engstem Zusammenhang damit steht die Überzeugung von der konstitutiven Bedeutung von Literatur und Kunst für den Volksgeist, die für Klassik und Romantik gleichermaßen typisch war und in der Reichsgründungsperiode wohl am vehementesten von Richard Wagner vertreten wurde, der namentlich im Theater Schillers und Goethes den „Keim und Kern aller national-poetischen und national-sittlichen Geistesbildung“ sehen wollte und emphatisch verkündete: „die Bildnerin des Volkes aber ist nur die Kunst“ (DS VIII, 280, 278; vgl. 260tt).
Zu Sprache und Kultur trat, ebenfalls schon sehr früh, die Geschichte: der Rekurs auf die germanische Wurzel und die Behauptung, daß die zu begründende nationale Gemeinsamkeit nichts anderes sei als die Wiederherstellung der ursprünglichen, germanisch-deutschen Freiheit. Diese Auffassung war zentral für den Frühliberalismus, der sich seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entfaltete (Echternkamp 1998, 306ff.), und trug den speziell im Nationalprotestantismus verbreiteten und mit aggressiver Spitze gegen alles Römische bzw. Katholische versehenen Germanenglauben der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Altgeld 1992, 125ff.). Sie gelangte vor allem im völkischen Nationalismus des Kaiserreichs (aber durchaus nicht nur dort) zu sattsam bekannter Prominenz (von See 1994). Die Beschwörung dieser historischen Gemeinsamkeit war 1871, zusammen mit derjenigen der Sprache, das Hauptargument derjenigen, die in der Elsaß-Lothringen-Frage verlangten, den Willen der Betroffenen als unerheblich anzusehen und, gestützt auf die objektive Nationszugehörigkeit, zur Annexion zu schreiten (Jeismann 1992, 258ff.). Auch die Politik der Dissimilation gegenüber den ethnischen Minderheiten, allen voran: den Polen, fand hier ihre energischsten Befürworter, desgleichen das Verlangen nach stärkerer Einbeziehung der außerhalb der Reichsgrenzen lebenden Deutschen.12
Nationalität über Religion zu definieren war zunächst nicht umstandslos möglich, da die hierfür in Frage kommende Religion – das Christentum – einen stark universalistischen Akzent aufwies. Wie es dennoch ging, exerzierte beispielgebend und wirkungsvoll Fichte vor, der Christentum und Deutschtum dadurch in ein Spezialverhältnis brachte, daß er beide als ‘gesteigertes Leben’ interpretierte. Als dasjenige unter den germanischen Völkern, das seiner ursprünglichen Sprache und seinen ursprünglichen Wohnsitzen am treuesten geblieben sei, sollte das deutsche Volk über eine besondere Nähe zu den Quellen aller Lebendigkeit, Natürlichkeit und Schöpferkraft verfügen. Vermöge dieser Nähe sollte es ‘das völkische Element zu den im Christentum gefundenen Prinzipien’ sein, der alleinige Ermöglichungsgrund für den ‘Durchbruch des Reiches Gottes’ in der Geschichte (Gehlen 1980, 262). Denselben Gedanken wiederholte zwei Generationen später Richard Wagner, wenn er die deutsche Sprache bis in das Urmenschentum selbst hinabreichen sah und der deutschen Musik einen besonderen Bezug zum Göttlichen attestierte. Von hier aus war es nicht mehr weit zur Vorstellung einer zugleich kulturellen und religiösen Mission der Deutschen, die die Völker zum ‘Rein-Menschlichen’ hin veredeln und erlösen sollten – allerdings, wie man sogleich hinzufügen muß, durch ihre bzw. Wagners Musik, nicht durch politisch-militärische Expansion; und dies war immerhin ein Angebot, das man auch ausschlagen konnte.13
Während Fichte und Wagner sich insofern noch ganz der Tradition der Aufklärungs- und Revolutionsepoche verpflichtet zeigten, als sie dem deutschen Volksgeist – einem Partikularen – eine universale Anlage bescheinigten und daraus Ansprüche auf Superiorität und Hegemonie ableiteten, wollte Lagarde von derartigen Bezügen nichts mehr wissen. Für ihn bestimmte sich Nationalität nicht durch Abstammung, Sprache, Kultur oder Bildung, sondern allein durch das Heilige. Dieses aber sei national begrenzt und nicht generalisierbar (SDV I, 144). Die auch für Deutschland anzustrebende Nationalreligion sei nicht mit irgendeiner historischen Religion identisch; sie knüpfe zwar an das Christentum an, aber nicht an seine Dogmen und Normen, sondern allein an seinen Geist. Nation werden heiße: religiös werden; religiös zu sein aber bedeute: „Leben mit Gott“, „Streben nach Gottähnlichkeit“ (152f.). Und dieses Streben zeigte sich vor allem in der Entschiedenheit, mit der die Gläubigen alles abstreiften, was irgendwie universal, transnational, kosmopolitisch oder einfach ‘fremder Plunder’ war: allen voran das Römisch-Katholische, die Prinzipien von 1789 und nicht zuletzt auch die Weltliteratur (58ff., 285, 276). Gesetzmacherei sei bis zum Überdruß getrieben worden. Was jetzt nottue, sei: „eine nationale Religion zu erringen (…), in welcher die Interessen der Religion und des Vaterlandes vermählt sind“ (156).
Eine Definition der Nation über die Sitte findet sich bei Lagardes Zeitgenossen Wilhelm Heinrich Riehl. Im Unterschied zum idealistischen Konzept der Sittlichkeit, das bspw. bei Fichte seinen Kern in der unveränderlichen allgemeinen Vernunft hat, erscheint hier die Sitte als eine von natürlichen Determinanten sowie von konkreten gesellschaftlichen ‘Organismen’ wie den Familien und Ständen geprägte Lebensform, die der ‘organischen Volkspersönlichkeit’ ihren unverwechselbaren Charakter verleiht (Riehl 1861, 14, 121, 149). Zu ihrer Erfassung schlägt Riehl eine stufenförmig aufsteigende Betrachtungsweise vor. Ausgangspunkt sollten die natürlichen und ethnographischen Faktoren sein (die allgemeine Landes- und Volkskunde). Von dort sei überzugehen zu den „durch die Bande der Natur und des häuslichen Lebens zusammengehaltenen kleinen Gruppen im Volke, welche den Staat noch nicht notwendig voraussehen“ (die Lehre von der Familie), um endlich zu den aus der Arbeit hervorwachsenden Unterschieden in Sitte, Siedlung und Lebensart zu gelangen: der Lehre von der Gesellschaft im Sinne einer national besonderten Einheit (1908, 41f.). Aus dieser Sicht erscheint die Familie als das Beharrende, Feste, „welches Geschlechter, Stämme, Nationen zusammenhält“, und die im Haus waltende Sitte als „das Allerheiligste des nationalen Geistes“, als „Urquell der ächten Loyalität“ (1861, 273, 276).
Die scharfe Kritik, die Treitschke an Riehl geübt hat (ARB II, 789ff.), hat die Nähe verdeckt, in der sich diese Auffassung allen Differenzen zum Trotz zu Treitschke befindet. Denn Riehl, der die Gegensätze von konservativ und liberal bereits lange vor dem Berliner Historiker für überholt erklärt hatte (1907, 11), verselbständigt zwar die Gesellschaftswissenschaft gegenüber der Staatswissenschaft, setzt sie aber nicht absolut. Neben dem Volk als natürlich-sozialer Einheit kennt er das Volk im Sinne des Staatsvolkes, als Rechtsbegriff (1908, 42), und vertritt damit dieselbe Auffassung wie Treitschke, für den sich das Volk ebenfalls in doppelter Gestalt darstellt – als bürgerliche Gesellschaft und als Staat. Riehl ist im übrigen auch nur dafür eingetreten, daß der Staat auf das natürlich-soziale Volk Rücksicht zu nehmen habe (in Form einer ‘sozialen Politik’). An seiner strukturellen wie organisatorischen Eigenständigkeit gegenüber der Gesellschaft wie gegenüber Familie und Sitte hat er nicht gerüttelt.
Bei den Definitionen, die die Nation als Abstammungsgemeinschaft verstehen, ist zwischen denjenigen zu unterscheiden, die die Abstammung rein formal-genealogisch (im Sinne des ius sanguinis) auffassen – hier wären vor allem Staatsrechtslehrer wie Maurenbrecher, Zachariä, Stahl, Frantz oder Bluntschli zu nennen (Ziegler 1931, 35f.; GG VII, 355f., 388) –, und denjenigen, die sie inhaltlich im Sinne einer Konsubstantialität begreifen: eine Wendung, die auf den zunehmenden Einfluß der Rassenlehren in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zurückgeht und tendenziell zur Sprengung der Nation führt. Dies läßt sich beispielhaft an Julius Langbehns Schrift Rembrandt als Erzieher zeigen. Langbehn betonte zunächst ganz auf der Linie Riehls den Zusammenhang von Land und Leuten, Volkstum und Bauerntum und postulierte einen engen Anschluß der Kultur des Geistes an die des Bodens. Der ‘irrenden Seele der Deutschen’ sollte wieder fester Halt gegeben werden durch eine neue Bindung an den heimatlichen Boden, an den „Geist der deutschen Erde“ (Langbehn 1943, 183, 185, 73, 129). Schon nicht mehr Riehl war dann jedoch die Empfehlung, den Nationalcharakter nicht nach den Sitten zu beurteilen, „sondern nach den mit- oder gegeneinander bewegten Blutströmungen“, den ‘Stammbäumen’, sei es doch die Abstammung, nicht der Wohnsitz oder der Geburtsort eines Menschen, der über seine Individualität entscheide (259, 154).
Noch weiter von Riehl entfernt war dann die in der Erstauflage noch nicht enthaltene Behauptung, nur eine bestimmte Stammlinie sei mit kultureller Produktivität verbunden – die arische Linie. Arisches Blut sei aristokratisches Blut, Träger des „sittlichen wie geistigen und in letzter Linie – körperlichen Aristokratismus“ (280). Zwar hätten die Arier sich über ganz Europa, ja über die Welt verstreut, doch hätten sie ein Kerngebiet besessen, in dem ihr Blut auch heute noch in besonders dichter Konzentration zu finden sei; und dieses liege glücklicherweise in Deutschland. „Die Wiege des Ariertums ist der gesamte germanische Nordwesten, das heißt Niederdeutschland; hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, daß eine Erneuerung des Deutschtums zunächst an Niederdeutschland anknüpfen muß; von da aus, wo ein Volk geboren ist, wird es auch wiedergeboren“ (ebd.).
Wie unverträglich diese Akzentuierung der Rasse mit der nationalstaatlichen Ordnung des späten 19. Jahrhunderts war, zeigt die Forderung Langbehns, den Schwerpunkt der inneren wie der äußeren Politik Deutschlands dorthin zu verlagern, „wo der Schwerpunkt des deutschen Volkscharakters liegt“, auf das Gebiet zwischen Rhein und Elbe (126). Von dieser „Achsenverschiebung“ erhoffte sich Langbehn eine Schwächung der undeutschen Elemente in Preußen, die infolge einer teils slawischen, teils jüdischen, teils französischen Blutsbeimischung entstanden seien und sich besonders im Kleinbürgertum und in der Fortschrittspartei manifestierten (281, 120f.). Gestärkt werden sollte dagegen das Streben nach einem künftigen „Großdeutschland“, worunter Langbehn jedoch vorrangig nicht den Anschluß Deutschösterreichs an das Zweite Kaiserreich verstand, sondern denjenigen Hollands und Dänemarks, die als niederdeutsche ‘Seestämme’ den ‘amphibischen Teil’ Deutschlands bildeten (213f.). Dies sei nicht nur zum Vorteil dieser Stämme, sondern auch zu demjenigen Deutschlands:
„Sie können geistige Befreier ihres Mutterlandes werden; ihre verwandte und doch fremde Bildung ist ein passendes Gegengewicht gegen jene drückende Last antiker Geistestradition, unter welcher die jetzigen Deutschen seufzen. Der Nordwesten kann den Südosten wohl aufwiegen. Die deutsche Geisteskraft muß sich, soweit sie von außen empfangen und nach außen hin geben will, dieser Himmelsrichtung zuwenden; hier findet sie ihre nordwestliche Durchfahrt! Germania hat alle ihre Kinder um sich zu sammeln; das ist die beste Staats- und Geistespolitik; es ist eine Familienpolitik“ (212).