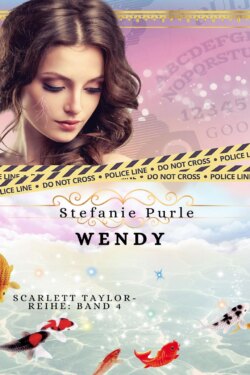Читать книгу Scarlett Taylor - Wendy - Stefanie Purle - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеAls ich wieder Zuhause ankomme, ist Chris schon unterwegs zu seinem Auftrag. Ich schleppe die Einkaufstüten mit den Zutaten für das Dinner heute Abend ins Haus, doch auf der Kücheninsel lasse ich sie uneingeräumt liegen und mache mich auf den Weg hinunter zum See.
Flink und behände, wie man es von einer Frau mit meiner Statur kaum erwarten würde, sprinte ich durch den Wald. Sommerlich warme Luft streift meine Haut und weht mein Haar hinter meine Schultern. Ich springe über herumliegende Baumstämme, ducke mich unter herabhängende Äste hindurch und weiche gekonnt Büschen und Fuchsbauten aus, bis ich endlich das flache Gras am Ufer des Sees erreiche.
Von Nahem sieht der See noch düsterer aus. Die Oberfläche ist still und pechschwarz, der blaue Sommerhimmel spiegelt sich nicht darin und es sind auch keine Libellen zu sehen oder Frösche zu hören. Alles, was ich gestern noch als normal und gegeben betrachtet habe, fehlt nun. Ich trete noch näher, bis meine Schuhspitzen das Schilf berühren, atme tief ein und rieche die stehende Luft um mich herum. Es riecht nach feuchter Erde, Gras und Moder. Kein Vogel zwitschert, keine Mücke summt um mich herum. Ich wittere Gefahr wie ein wildes Tier, dem sich etwas Böses nähert. Doch so sehr ich mich auch auf meine Sinne konzentriere, ich kann den Ursprung der Gefahr nicht lokalisieren.
Trotz der aufsteigenden Mittagshitze fröstelt es mich. Ich reibe mir die Gänsehaut von den Armen und blicke mich um. Niemand außer mir ist hier, und doch spüre ich die lauernde Gefahr im Nacken, als würde mich jemand beobachten. Die Stille beunruhigt mich, auch wenn sie doch sonst immer so friedlich auf mich gewirkt hat. Dieses Mal ist es eine andere Stille, eine melancholische, unheilvolle Stille.
Ich trete vom Schilf zurück und beginne am Ufer entlangzulaufen, wobei ich die schwarze Wasseroberfläche nicht aus den Augen lasse. Am hölzernen Bootssteg, dessen Latten verwittert und morsch sind, halte ich wieder an. Vorsichtig trete ich darauf und nähere mich Schritt für Schritt seinem Ende, das ungefähr fünf Meter aufs Wasser hinausragt. Das morsche Holz unter mir würde nachgeben, wäre ich nicht zur Hälfte Druidin. Ich kann fühlen, wie es die Fasern anspannt, beinahe wie Muskeln, um mich zu halten. Am Ende des Bootsteges lasse ich mich auf die Knie nieder und umfasse mit den Händen den allerletzten Balken. Glitschige Algenbeläge drücken kühl gegen meine Handflächen, als ich in das Dunkel des Wassers blicke. Wie durch einen Nebel hindurch sehe ich verschwommen mein eigenes Gesicht auf der Oberfläche. Die Narbe auf meiner Wange dominiert mein Spiegelbild und hebt sich schwarz-silber von meiner blassen Gesichtshaut ab. Einen kurzen Moment verirren sich meine Gedanken zu dem heutigen Abend. Wie wird Bill reagieren, wenn er diese Entstellung in meinem Gesicht sieht? Werde ich wieder die erfundene Geschichte von einem Autounfall erzählen müssen, oder hat Carmen das bereits für mich erledigt? Die betroffen dreinblickenden Gesichter derer, die mich nach dem Todesblitz meines Vaters ansahen, tauchen vor meinem inneren Auge auf. Mitleid, Schrecken und manchmal sogar Ekel war in ihren Mienen zu lesen. Und selbst jetzt, fast ein halbes Jahr später, begegne ich immer noch vielen fragenden oder ausweichenden Blicken. Das einzig Positive an dieser hässlichen Narbe ist die Tatsache, dass sie für Menschen einfach nur blassrosa aussieht, wie eine gewöhnliche Narbe. Nur magische Wesen sehen das Schwarz mit den silbernen Furchen darin.
„Zu spät“, höre ich plötzlich eine tiefe, grummelnde Stimme unter mir und ich zucke zusammen. Das Wasser bewegt sich und lässt mein Spiegelbild in Fetzen über den schwarzen See gleiten. Ich drehe mich zu allen Seiten um.
„Wer ist da?“, rufe ich und richte mich auf. „Hallo?“ Doch niemand antwortet. Stattdessen höre ich ein gurgelndes Lachen, das sich immer weiter über den See verzieht. „Hallo! Ist da jemand?“ Wieder keine Antwort, stattdessen legt sich wieder diese drückende Stille über den See.
Ich springe auf, plötzlich von Panik ergriffen, und verlasse fluchtartig den Bootssteg. Ohne meine Konzentration gehen zwei morsche Latten entzwei und ich komme ins Straucheln. Taumelnd trete ich ins knietiefe Wasser und falle vornüber ans Ufer.
Wieder ertönt dieses fiese Lachen. Es scheint, als käme es aus der Mitte des Sees, doch das kann nicht sein!
So schnell ich kann, krabble ich über das Ufer, so weit weg vom Wasser wie eben möglich, bis endlich das Lachen wieder verstummt. Tropfnass, von den Oberschenkeln abwärts, hocke ich da und blicke mich verängstigt um, während ich im Geiste all die Wesen durchgehe, die im Wasser leben könnten. Da wären Nixen, Sirenen und Meerwesen, doch sie alle bevorzugen Salzwasser. Dann gibt es noch die Wasserelfen, kleine tropfenförmige Geistwesen, ähnlich der oberirdischen Elfen, doch sie sind stumm und können es demnach nicht gewesen sein. Mir fallen noch weitere Wesen ein, doch die meisten davon leben im Meer oder in Lagunen, keines davon ist in Waldseen beheimatet.
Ratlos rapple ich mich wieder auf und versuche die Angst abzuschütteln. Sollte sich mir etwas Böses nähern, so habe ich immer noch meine Magie, um mich zu wehren. Außerdem habe ich schon wahrhaft Schlimmeres erlebt und gesehen als ein gruseliges Lachen, das über einen schwarzen See schwebt! Trotzdem läuft mir beim Gedanken an die Stimme, die nur zwei Worte sagte -„Zu spät“- wieder ein kalter Schauer über den Rücken.
Ich beginne weiter den See zu umrunden, die Hand kampfbereit ausgestreckt, um notfalls einen Blitz abzufeuern, falls es nötig ist. Als ich am hinteren Ende des ovalen Sees angekommen bin, entdecke ich Wachsspuren im niedergetretenen Gras. Ich hocke mich hin und hebe eines der Wachstropfen auf. Es ist grau und riecht leicht nach Weihrauch. Sofort denke ich an das Mädchen, das mir auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und von mir ein paar Spells wissen wollte. Ob sie hier eine Séance abgehalten hat? Oder waren es nur Angler, die des Nachts im Kerzenschein geangelt haben? Oder ein verliebtes Pärchen? Ich suche die Umgebung nach Anglerzubehör oder Resten vom romantischen Picknick ab, aber ich finde nichts. Doch als ich ein paar Meter weiterlaufe, entdecke ich etwas abgelegen vom Ufer eine Stelle zwischen ein paar Bäumen, wo das Gras niedergedrückt ist und in dessen Mitte ein paar verkohlte Holzscheite liegen. Als ich näherkomme, entdecke ich auch leere Bierdosen, die achtlos ins Gebüsch geworfen wurden, dazu die aufgerissene Verpackung von Schokoriegeln und einen leeren Pizzakarton. Verärgert hebe ich den Müll auf und klemme ihn mir unter den Arm. Dann hocke ich mich neben die Feuerstelle und halte die Hand darüber. Es ist noch warm, also wird es von vergangener Nacht stammen.
Ich lasse den Blick weiter suchend umherschweifen, als ich an einem Baum ein eingeritztes Pentagramm entdecke. Ein verärgertes Schnauben dringt durch meine Nasenlöcher. Nicht nur, dass der Künstler diesen Baum einfach als Leinwand missbraucht und ihn somit verletzt hat, es handelt sich auch noch um ein umgedrehtes Pentagramm, eines, das den Gehörnten symbolisiert, mit zwei Sternspitzen nach oben!
Ich lege den Müll für einen Moment beiseite und gehe zum Baum. Als ich meine Hand auf seine Wunde lege, kann ich seinen Schmerz spüren. Mit geschlossenen Augen fühle ich an dem Schmerz vorbei und suche nach der Intention, die hinter diesem Symbol steckt. Was wollte der Schnitzer erreichen? Schutz? Eine Opfergabe für den Gehörnten? Oder war es einfach nur eine dumme Spielerei, ohne wirklichen Hintergrund?
Bilder von Jugendlichen dringen in meinen Kopf. Der Baum lässt mich in kurzen, blitzartigen Bildern sehen, was er selbst gesehen hat: Vier Teenager, ein Feuer. Ein rostiges Taschenmesser, Kerzenschein, Gelächter, und dann die Schnitte durch die dicke Rinde hindurch.
Ich zucke zusammen beim Erleben des Schmerzes und öffne die Augen wieder. Der Junge, der das umgedrehte Pentagramm in die Rinde dieses Baumes geritzt hat, hatte kein größeres Ziel im Auge. Er tat es, um ein Mädchen zu beeindrucken, das mit dabei war.
Sanft fahre ich mit den Fingerspitzen über die Wunde. Ich konzentriere mich und schicke heilende Energie in die Schnitte. Voller Bewunderung sehe ich zu, wie unter meinen Fingerspitzen hölzernes Narbengewebe entsteht und die Schnitte verschließt. Innerhalb weniger Sekunden ist das Pentagramm verschwunden. Der Baum atmet erleichtert auf, seine Blätter rascheln und ein harziger Geruch steigt in meine Nase.
Ich wünschte, ich könnte dasselbe mit meiner Narbe machen.
Nachdem ich meinen Rundgang um den See beendet habe, ohne dabei wirklich eine Ursache für die seltsame Melancholie des Wassers oder der Herkunft der gruseligen Stimme zu finden, klemme ich mir den Müll unter den Arm und gehe wieder hoch zum Anwesen. Wenn ich mich vor meinem Rundgang auch noch davon hätte überzeugen lassen, dass ich mir die Trauer des Sees nur einbilde, so bin ich mir doch nach meinem Rundgang sicher, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich habe keine Menschenseele am Ufer oder im umliegenden Wald bemerkt, von der diese Stimme hätte kommen können. Selbst meine Hexen- und Druideninstinkte zeigten an, dass ich alleine war. Weder Mensch, noch Tier war mit mir zusammen am See, und das macht die ganze Sache noch seltsamer. Normalerweise bin ich dort unten nie alleine. Die Tiere des Waldes suchen meine Nähe, auch wenn sie immer gebührenden Abstand halten. Auch Queenie, mein Schutzgeist in Form eines Albino-Eichhörnchens, war nicht bei mir. Dabei hält sie sich immer in meiner näheren Umgebung auf, wenn ich draußen bin.
Erst, als ich schon fast wieder beim Haus bin, höre ich die Vögel in den Baumwipfeln zwitschern und ein leises Grillenzirpen aus einiger Entfernung. Ich gehe in die offenstehende Garage und sortiere den Müll in die Tonnen, als ich einen weißen Fleck im Augenwinkel bemerke. Es ist Queenie, die an dem Busch neben den Garagentor emporklettert und dann an den dünnen Birkenstamm daneben springt. Sie hält sich an der weißen Rinde fest und schaut mit ihren kleinen Knopfaugen zu mir herüber, während ihr Schwanz frech hin und her zuckt.
„Hey, Queenie, meine Süße“, begrüße ich das zierliche Tier, schließe die Mülltonnen und laufe auf sie zu. Ich strecke den Arm nach ihr aus und als meine Fingerspitzen sie fast berühren, schnuppert sie daran. „Hast du Hunger?“, frage ich, obwohl ich noch nie erlebt habe, dass dieses kleine, verfressene Tier mal nicht hungrig war.
Ich greife mit der freien Hand in meine Hosentasche und hole eine Nuss hervor. Queenie springt vom Birkenstamm auf meinen Arm, klettert auf meine Schulter und schlüpft unter meine Haare. Ihr borstiges Fell kitzelt mich im Nacken. Ich hebe die Nuss an ihr kleines Maul neben meinem Gesicht, sie nimmt es mit ihren zarten Fingern entgegen und beginnt daran zu nagen.
Nachdem Queenie auch die letzte Nuss aus meiner Hosentasche vertilgt hat, springt sie von meiner Schulter herunter, klettert am Efeu neben dem Garagentor empor und flitzt hoch bis auf das Hausdach. Ich gehe währenddessen hinein und beginne die Einkäufe wegzuräumen. Während ich das tue, nehme ich mein Handy und rufe Fletcher an, der auch im Wald wohnt. Er ist selbst eine Hexe und war einmal mein Mentor. Von ihm habe ich die Grundlagen der Magie gelernt. Er wohnt im Sommer in einem Wohnwagen auf einer kleinen Lichtung, gut fünfzehn Minuten Fußmarsch von Chris´ Anwesen entfernt. Ich bitte ihn, sich den See auch einmal anzuschauen und erkläre ihm mein seltsames Gefühl und die Melancholie, die in dem dunklen Wasser zu sein scheint. Von der unheimlichen Stimme erzähle ich nichts. Zum einen möchte ich ihn nicht ängstigen, obwohl er dem Ganzen wahrscheinlich sehr wohl gewachsen ist, zum anderen kommt es mir aber jetzt selbst ziemlich wirr und vage vor. Habe ich sie wirklich gehört, oder habe ich es mir nur eingebildet? Vielleicht war es auch nur ein Mensch, der sich einen Scherz erlaubt hat, und meine Sinne haben ihn aufgrund des Schreckens nur nicht wahrgenommen.
Fletcher verspricht mir, sich am Nachmittag zum See aufzumachen. Sobald er sich einen Eindruck verschafft hat, wird er sich bei mir melden. Das ist alles, was ich in diesem Moment tun kann. Ich kann nicht alle Termine absagen und das ganze Parapsychologen-Team herbeirufen, nur weil ich ein seltsames Gefühl habe. Also versuche ich mich stattdessen auf den heutigen Abend zu konzentrieren. Ich räume Küche, Esszimmer und Wohnzimmer auf, schüttle die Kissen vom Ledersofa aus und poliere den Mahagonietisch mit Möbelpolitur, während das Backofenspray im Ofen einweicht. Dann reiße ich alle Fenster auf und lüfte kräftig durch, schrubbe Ofen und Herd und gehe sogar nach draußen, um einen kleinen Blumenstrauß zu pflücken, den ich auf dem frisch polierten Tisch im Esszimmer platziere.
Eine Weile debattiere ich gedanklich darüber, wo wir Vier heute Abend essen werden: Im Wohnzimmer, Esszimmer oder an der Kücheninsel. Schließlich entscheide ich mich für das Esszimmer und decke dort den Tisch. Im Gästezimmer habe ich in einem Schrank Stoffservietten gefunden, die ich bügle und nach mehreren gescheiterten Faltversuchen einfach zusammengeklappt neben die Teller lege. Auf dem Tisch im Wohnzimmer verteile ich kristallene Weingläser auf Untersetzern und rücke ein paar Bilderrahmen und Deko-Objekte über dem Kamin zurecht. Zufrieden betrachte ich mein Werk.
Als ich mich daran mache die Lasagne vorzubereiten, frage ich mich, warum es mir überhaupt so wichtig ist, vor Carmen und ihrem Bill zu glänzen? Will ich sie irgendwie beeindrucken? Nein, stelle ich nach einiger Überlegung fest, es geht mir in Wahrheit nur darum, meiner besten Freundin zu zeigen, dass Chris und ich ein ganz normales Leben führen. Ich will ihr zeigen, dass, obwohl wir Mannwolf und Druidenhexe sind, man sich mit uns zu einem Pärchen-Dinner treffen kann.
Carmen hat mich noch nie hier besucht und ich befürchte insgeheim, dass sie vermutet, hier würden getrocknete Kräuter von der Decke baumeln, dubiose Tränke in bauchigen Flaschen die Regale füllen, Katzenschädel auf den Fensterbänken liegen und in der Luft würde immer der Geruch von Räucherstäbchen hängen. Quasi so, wie es bei meiner Tante Roberta oder Fletcher Zuhause aussieht.
Als mir Fletcher wieder in den Sinn kommt, ziehe ich mein Handy aus der Hosentasche, während ich das Hackfleisch anbrate. Noch keine Nachricht von ihm. Ich schaue durch die Fensterfront hinunter zum See. Er sieht noch immer so grau und matt aus, wie seit heute früh, obwohl der Himmel frei von Wolken und strahlend blau ist. Ich seufze ratlos und werfe kleingeschnittene Tomaten und Paprika zu dem Hackfleisch, während in dem Topf daneben die Butter für die Bechamelsauce zu brutzeln beginnt.
Nachdem ich die Lasagne in der Auflaufform geschichtet und mit reichlich Käse bestreut habe, stelle ich sie in den blitzblanken Backofen. Ich habe sie extra jetzt schon vorbereitet, damit ich, wenn unsere Gäste da sind, nicht in der Küche herumwerkeln muss. Der Backofen muss nun nur noch angestellt werden, nachdem Carmen und Bill eingetroffen sind. Und während die Lasagne im Ofen vor sich hinbrutzelt, kann ich mich mit ihnen unterhalten. Es ist schließlich ein ganz normaler Dienstagabend und die beiden müssen morgen früh wieder zeitig aufstehen, um zur Arbeit zu kommen. Da will ich die wenige Zeit, die wir miteinander haben, natürlich nicht allein in der Küche verbringen.
Aus dem Weinkühlschrank hole ich eine der guten Rotweinflaschen, öffne sie und gieße den Wein in eine schicke Glaskaraffe, damit er dekantieren kann. Mir persönlich liegt nicht viel an Wein, aber ich weiß, dass Carmen und Bill schön öfters bei Weinproben waren und er einen ganzen Keller für teure Weine hat. Wahrscheinlich wird ihn unser Zehn-Euro-Wein nicht sonderlich beeindrucken, aber das ist mir jetzt egal.
Nach einem Blick auf die Uhr renne ich nach oben und gehe rasch duschen. Chris müsste gleich von seinem Einsatz zurückkommen und ich bin mir sicher, dass er danach auch noch duschen möchte. Als ich fertig bin und in Unterwäsche im Schlafzimmer stehe, höre ich seine Schritte auf der Treppe und bin erleichtert, dass er es pünktlich geschafft hat.
Die Schlafzimmertür öffnet sich und ein blutverschmierter Chris kommt herein. Seine Schultern hängen matt herab und das, was von seinem Gesicht nicht mit Blut besprenkelt ist, sieht blass aus.
„Ach du meine Güte“, sage ich aufgebracht und gehe auf ihn zu, während mein Blick ihn automatisch nach Verletzungen absucht. „Ist alles okay? Hast du dich verletzt?“
Er schüttelt den Kopf und streckt die Hände nach mir aus, lässt sie aber wieder sinken, als ihm aufgeht, dass auch sie mit Blut verdreckt sind. „Nein, mit mir ist alles in Ordnung“, sagt er in rauem Ton und ich entnehme seiner kratzigen Stimme, dass er viel geschrien haben muss. „Es ist nicht mein Blut.“
Erleichtert lasse ich die Anspannung aus meinem Körper fließen und sehe zu, wie er sich die Haare aus der verklebten Stirn streicht. „Ich kann für heute Abend absagen, wenn du möchtest“, schlage ich vor, doch er schüttelt bereits mit dem Kopf.
„Nein, auf keinen Fall. Nach einer Dusche bin ich wieder wie neu.“
Er geht an mir vorbei (jedoch nicht ohne seine Augen einmal meinen halbnackten Körper hinab und wieder hinaufgleiten zu lassen) und verschwindet im Bad neben dem Schlafzimmer.
„Okay, wie du meinst“, antworte ich und hole mein schwarzes Seidenshirt vom Bett. „Waren es denn viele Werwölfe?“, rufe ich ihm zu, als das Rauschen der Dusche ertönt.
„Ja, sieben Stück“, antwortet er über das Plätschern hinweg.
In mir stellt sich das übliche schlechte Gewissen ein, das ich immer bekomme, wenn mein Gefährte einen von mir zugeteilten Auftrag übernimmt und dieser sich als besonders schwierig und riskant herausstellt. Aber er hat selbst darauf bestanden, sich eigenhändig um die Werwölfe zu kümmern. Schließlich sind sie irgendwie seine Artgenossen. Er hatte gehofft, dass er sie zur Vernunft bringen könnte, aber nach dem ganzen Blut auf seinen Klamotten zu urteilen, war es vergebens.
„Konntest du sie überzeugen, sich den Mannwölfen anzuschließen?“
Ich schlüpfe in das Shirt und setze mich auf die Bettkannte, um mir die schwarze Stoffhose anzuziehen, die ich mir bereitgelegt hatte.
„Nein, daran war nicht zu denken! Ein paar Mannwölfe von außerhalb kamen noch dazu. Wir konnten ein kleines Mädchen, das die Werwölfe sich für einen späteren Snack gefangen hielten, befreien. Aber für zwei junge Männer und eine Frau war es schon zu spät“, erzählt Chris aus der Dusche weiter. „Die Werwölfe waren total im Blutrausch, man konnte kein vernünftiges Wort mehr mit ihnen sprechen.“
„Und was habt ihr mit den Leichen gemacht?“, hake ich nach und ziehe meine Strümpfe über.
Chris schaltet die Dusche aus und ich höre das Schaben der Glastür auf den Fliesen, als er heraustritt. „Das hat der andere Mannwolf-Clan übernommen. Sie waren eh schon länger an dem Fall dran“, antwortet er und erscheint nackt und nass mit einem Handtuch in der Hand im Türrahmen. „Sie lassen es wie einen Autounfall aussehen“, erzählt er, während er sich die Haare trockenrubbelt. „Sie haben die Opfer und die Werwölfe in einen alten Bulli gesetzt, den sie vom Schrottplatz geklaut haben. Auf irgendeiner Landstraße werden sie ihn sich dann überschlagen lassen. Das wird zwar nicht ganz zu den Verletzungen passen, aber sie hoffen, dass es einige Zeit dauern wird bis man sie und den Bulli findet. Die Polizei wird denken, wilde Wölfe hätten diese Wunden an den Leichen verursacht. Und für pathologische Untersuchungen wird es dann hoffentlich schon zu spät sein.“
Trotz der Bilder von zerfetzten Leichen in meinem Kopf, kann ich nicht aufhören, den nackten Körper meines Gefährten zu betrachten. Eigentlich wollte ich auch noch nach dem kleinen Mädchen fragen, doch auch dieser Gedanke entgleitet mir.
In seiner ganzen Pracht und Anmut steht er vor mir und raubt mir damit allein schon fast den Atem. Dass er bemerkt, dass ich ihn anstarre, kann ich an der Reaktion zwischen seinen Schenkeln sehen. Es scheint ihm zu gefallen, dass ich mich kaum sattsehen kann.
Er lässt das Handtuch fallen und kommt langsam schleichend auf mich zu. Seine geschmeidigen Bewegungen erinnern an ein Raubtier, das sich seiner Beute nähert. Unter seinen linken Rippen hat sich ein dunkler Schatten gebildet, der in ein paar Tagen sicherlich zu einem blauen Fleck werden wird. Ich sitze noch immer auf der Bettkannte und lege die Ohrringe, die ich gerade anlegen wollte, zurück auf den Nachttisch. Als er direkt vor mir steht, sehe ich, dass sich der Schatten bis zu seinem Hüftknochen hinunterzieht und ich fahre mit meinen Fingern über die noch feuchte Haut.
„Du bist verletzt“, hauche ich gegen seinen Unterbauch, als seine Finger durch mein feuchtes Haar gleiten.
Sein Gemächt reckt sich mir entgegen und ich spüre ein verlangendes Ziehen in meinem Unterleib. Ich umfasse seine schmale Hüfte und lasse meine Daumen durch den Rand seiner Behaarung gleiten.
„Nichts Schlimmes“, raunt er und zieht scharf die Luft ein, als ich meine Hand von seinen Hüften hinab zu seinem pochenden Glied gleiten lasse.
Ich umfasse ihn mit der Faust und führe seine Spitze an meine Lippen. Sanft küsse ich das glatte, rosa Fleisch, bevor ich mit der Zungenspitze darüberfahre, als die Türklingel ertönt.