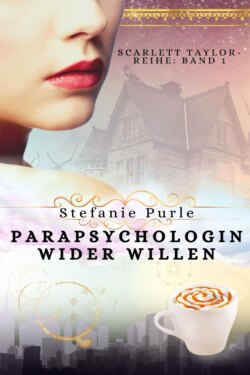Читать книгу Scarlett Taylor - Stefanie Purle - Страница 9
Kapitel 6
ОглавлениеEin weiterer Blitz durchzuckt den Himmel, als auch ich fluchtartig das Haus verlasse. Auf keinen Fall bleibe ich mit diesem Schattenwesen alleine zurück!
Ich werfe die Tür hinter mir zu und haste in mein Auto, während Zoe mit ihrem silbernen SUV an mir vorbeirast. Mit durchdrehenden Reifen manövriert sie diesen riesigen Wagen zwischen den Bäumen hindurch hinaus auf die Straße. Ich blicke ihr nach, bis sie hinter Regengüssen aus meiner Sicht verschwindet.
Mein keuchender Atem lässt rasch die Scheiben von innen beschlagen, meine Hände beben und mein Herz rast. Ich stelle den Scheibenwischer an, verriegle den Wagen von innen und blicke durch den Regen am Haus empor, als ich den Motor anlasse. Oben, an einem der Fenster, das wie ein finsteres Auge auf mich herabstarrt, huscht ein schwarzer Schatten entlang und die Gardine beginnt zu zittern.
Ich lege panisch den ersten Gang ein, schlage das Lenkrad herum und gebe Vollgas. Holpernd komme ich auf die Auffahrt und blicke in den Rückspiegel. Das Haus lacht. Es lacht mich eigenartigerweise aus und für den Bruchteil einer Sekunde höre ich das gurgelnde, knurrende Fauchen in meinem Nacken. Ich schreie und fahre ruckelnd vom Grundstück.
Auf der Straße zwinge ich mich dazu, die Panik zu vertreiben und konzentriere mich mehr auf das Schalten und angemessene Gas geben, während ich angestrengt durch den Regen blinzle. Erst, als ich das Haus nicht mehr im Rückspiegel sehen kann, fahre ich rechts ran. Meine Hände umklammern das Lenkrad, sodass meine Knöchel weiß hervortreten. Die Wassertropfen trommeln unaufhörlich auf das Dach und übertönen fast gänzlich meine Gedanken. Ich atme tief ein und reibe mir die Stirn.
Was habe ich dort im Haus gesehen, frage ich mich und schüttle mit dem Kopf. Es kann kein Geist gewesen sein, denn so etwas gibt es nicht.
Oder doch?
Mein Blick fällt auf den Stapel Sachen auf dem Beifahrersitz. Mit den Fingerspitzen fahre ich über das in Leder gebundene Buch. Was würde Elvira jetzt tun? Ich soll mich um ihre Kunden kümmern, und alles, was ich dazu wissen muss, hat sie in diesem Buch niedergeschrieben, hieß es in ihrer Nachricht.
Kopflos drücke ich die Stirn gegen das Lenkrad und seufze laut. Ich darf meine Tante nicht enttäuschen. Sie hat sich immer um mich gekümmert, vor allem nachdem meine Mutter es nicht mehr konnte. Elvira ist immer für mich da gewesen.
Andererseits wehrt sich alles in mir dagegen, wieder zu diesem Haus zu fahren. Was ich auch immer dort gesehen habe, es hat mir mächtig Angst eingejagt. Ich brauche erst mal ein bisschen Abstand, eine kurze Pause, um mir darüber klar zu werden, was ich nun als nächstes tun soll.
Also starte ich erneut den Motor und fahre zu meiner Mutter in die Klinik.
Ich stelle meinen schwarzen Panther auf meinem Stamm-Parkplatz ab, nehme das Buch und meine Handtasche und gehe am Pförtner vorbei durch den Klinikeingang.
„Hallo Scarlett!“, begrüßt mich Henry, der Pförtner, freundlich und lächelt breit, während er seinen prallen Weihnachtsmannbauch vorstreckt. „Herrliches Wetter heute, oder?“
Ich blicke zum Himmel, an dem nur ein paar vereinzelte Wattebauschwolken zu sehen sind. „Hallo Henry, ja, es ist wirklich ein schöner, sonniger Tag“, antworte ich und blinzle ein bisschen konfus in die Sonne.
„Grüß‘ deine Mutter von mir“, ruft er mir nach, als ich durch die Glastür husche, schlägt die Hacken zusammen und tippt sich an die Mütze.
„Werde ich machen!“
Ich gehe den langen Gang entlang, vorbei am Schwesternzimmer, wo ich das Gemurmel und Gelächter der Schwestern höre, die sich dort zur Mittagspause versammelt haben. Normalerweise würde ich sie begrüßen, aber ich möchte sie in ihrer kurzen Pause nicht stören.
Die Tür zum Zimmer meiner Mutter steht wie immer einen Spalt offen. Ich klopfe an und trete sofort darauf ein. Mutter sitzt an einem kleinen Klapptisch vorm Fenster. Auf dem Tisch steht das Mittagessen, unangetastet. Die Sonne strahlt durch das Blätterdach eines Baumes und hinterlässt wild tanzende Tupfen von Sonnenlicht im ganzen Raum.
„Hallo Mama“, sage ich, lege meine Sachen auf ihr Bett und hänge meinen nassen Mantel an den Haken hinter der Zimmertür. „Jetzt, wo ich zu dir komme, scheint die Sonne, dabei hat es den halben Vormittag geregnet.“
Ich gehe zu ihr, lege meine Hand auf ihre Schulter und drücke ihr einen Kuss auf die Wange. Ihr langes, graues Haar wirkt struppig, obwohl die Schwestern es gebürstet haben, soweit ich erkennen kann. Ich nehme eine Strähne und streiche sie über ihre Schulter.
„Elvira ist weg“, sage ich. „Sie ist einfach verschwunden und ich weiß nicht, wo sie ist“, beginne ich zu erzählen und gehe um meine Mutter herum. Ihre fliederfarbene Strickjacke ist ihr von der Schulter gerutscht. Ich ziehe sie wieder hoch und schließe die obersten Knöpfe. „Aber sie hat mir eine Nachricht hinterlassen. Sie schreibt, ich soll mir keine Sorgen machen, aber natürlich mache ich mir Sorgen.“
Ich seufze, nehme ihre unbenutzte Gabel und stochere im noch heißen Kartoffelbrei herum. Eine kleine Menge nehme ich auf, gerade so viel, dass es für einen Spatz reichen würde, und halte ihr die Gabel vor den Mund. Mechanisch öffnet sie ihn ein kleines Stück. Ihre trockenen Lippen umschließen die Gabel und ich ziehe sie sanft wieder heraus, während die Augen meiner Mutter weiter ins Nichts starren. Ich hole einen Hocker herbei und setze mich.
„Ich soll mich um ihre Kunden kümmern, hat sie geschrieben.“ Umständlich pikse ich ein paar Erbsen auf, ziehe sie durch die braune Soße und führe die Gabel wieder vor ihren Mund. „Aber, weißt du was?“, frage ich leise und verschwörerisch, wobei ich mich umsehe, um sicher zu gehen, dass uns keiner belauscht. „Elvira hat gar kein Reisebüro.“
Mit dem Messer schneide ich ein kleines bisschen von der dünnen Scheibe Schweinebraten ab und ziehe es durch Kartoffelbrei und Soße. „Das Reisebüro war nur eine Tarnung. In Wirklichkeit arbeitet sie als Parapsychologin“, flüstere ich und sehe Mutter lange in die Augen.
Sie blinzelt. Ihre Augen sind feucht, aber nicht so, als ob sie weinen müsste. Wieder blinzelt sie und starrt auf einen Punkt am Fenster, den nur sie sehen kann.
Während ich ihr das restliche Essen anreiche, rede ich weiter. Ich erzähle ihr alles, von dem geheimen Büro, dem handgeschriebenen Buch, den Pulvern und Tinkturen in den ominösen Fläschchen und den Amuletten. Von meinem neuen Auto, von Zoe und Julie, ihrem Haus und dem Schatten darin. Von Blitz, Donner, heißem Fauchen, Knurren und gruseligem Lachen.
„Was erzählst du deiner Mutter denn für Gruselgeschichten?“, fragt eine heitere Stimme, als die Tür aufschwingt. Es ist Schwester Tanya, sie lächelt und läuft auf mich und Mutter zu.
„Ach, ich habe ihr nur erzählt, was ich gestern im Fernsehen gesehen habe“, lüge ich und lächle zurück.
Tanya beugt sich zu meiner Mutter vor und streicht ihr über den Unterarm. „Na, Hauptsache, Sie können gleich noch gut schlafen, Frau Schneider“, sagt sie und zwinkert mir zu. Als sie den leeren Teller auf dem Tisch sieht, nickt sie anerkennend. „Sie haben ja alles aufgegessen! Sehr gut!“ Sie nimmt das Tablett hoch und macht sich zum Gehen auf. Bevor sie durch die Tür in den Flur tritt, wendet sie sich an mich. „Du klingelst, wie immer, wenn du gehst, ja? Dann legen wir sie zum Mittagsschlaf hin.“
Ich nicke und bedanke mich. Mutter blinzelt.
Nach ein paar stillen Minuten, in denen ich sie dabei beobachtet habe wie sie ins Nichts blickt, nehme ich ihre Hand und streiche über ihre pergamentartige Haut.
Sie anzuflehen, damit sie zurückkommt, zu jammern und zu weinen, damit sie auch nur eine kleine Regung von sich gibt, habe ich vor Jahren aufgegeben. Ich weiß, sie würde wieder zurückkommen, wenn sie könnte. Aber sie kann nicht. Aus irgendeinem Grund ist sie seit über neun Jahren in dieser Situation gefangen.
Ziemlich oft denke ich an den Tag zurück, an dem es passiert ist, an dem sie zwar wach wurde, aber nicht mehr aufwachte. In meinen Gedanken habe ich diesen Tag Millionen Male Revue passieren lassen. Es war der Tag vor meinem achtzehnten Geburtstag. Mutter, Elvira, ein paar Freundinnen und ich hatten die Tage zuvor mit der Planung der Feier verbracht. Da mein Vater uns noch vor meiner Geburt verlassen hatte, waren unsere finanziellen Mittel begrenzt, aber das hat Mama mich nie spüren lassen. Sie machte alles möglich, und dieser Geburtstag sollte etwas ganz Besonderes werden.
An dem besagten Tag war ich schon früh wach. Mama hatte die halbe Nacht damit verbracht, aus einem zerbrochenen Spiegel, einem alten Ball und einer Heißklebepistole eine Discokugel für die Party zu basteln. Das Ding lag fertig auf dem Küchentisch, glitzernd, rund und perfekt. Ich konnte nicht glauben, dass sie es noch in der Nacht fertiggestellt hatte und hüpfte aufgeregt in ihr Zimmer, um mich zu bedanken. Sie schlief noch, also sprang ich auf ihr Bett. Ich sang ein dämliches Lied, um sie zu ärgern und wach zu kriegen, während ich auf und ab sprang. Aber sie reagierte nicht.
Selbst wenn ich heute daran denke, wird mir noch flau im Magen.
Der Moment, als ich dachte, sie sei tot.
Als ich mich herunterbeugte, ihr Gesicht in beide Hände nahm, ihren wirren Blick sah.
Die Minuten, in denen ich vergeblich versuchte einen Puls zu fühlen, ich aber nicht wusste wie es richtig geht und schließlich mein Ohr auf ihre Brust presste.
Die Verwirrung, als ich zwar ein Herz schlagen hörte, meine Mutter aber trotzdem wie tot dalag...
Ich hatte ihr schon kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt, geschrien, ihr eine Ohrfeige verpasst und verzweifelt auf dem Boden vor ihrem Bett geweint, bis ich endlich auf die Idee kam, Elvira anzurufen.
Danach verblasst meine Erinnerung. Alles ist in grauen Nebel gehüllt.
Ich musste unsere Wohnung verlassen und kam im Wohnheim unter. Mehrmals pro Woche war ich bei Elvira, und genauso oft ging ich meine Mutter in der Klinik besuchen.
In den ersten Jahren habe ich sie angefleht zu mir zurückzukommen, etwas zu sagen, wieder zu reagieren. Doch irgendwann hörte ich damit auf. Was, wenn sie zurückkommen will, aber es nicht kann? Wie muss sie sich fühlen, wenn ihre Tochter sie um etwas anfleht, das sie ihr nicht geben kann? Also hörte ich auf zu betteln und arrangierte mich mit allem.
Aber in Momenten wie diesen, könnte ich wirklich ihren Rat gebrauchen. Ich wünschte, sie würde plötzlich wieder erwachen und mir sagen, was ich zu tun habe. Aber das tut sie nicht. Stattdessen schaut sie aus dem Fenster.
Ich lege ihre Hand in ihren Schoß, löse die Handbremse vom Rollstuhl und schiebe sie hinaus auf die Terrasse in die Sonne. Ich fahre sie in den Halbschatten, wo die warme Sonne auf ihre Beine strahlt, sie aber nicht blendet. Dann hole ich eine kleine Decke und mein Buch von Elvira, setze mich neben meine Mutter und lese dort weiter. Irgendwo, zwischen all diesen wirren Notizen muss stehen, wie ich Zoe und Julie helfen kann. Ich blättere vor und zurück, suche nach Schlagworten wie „Schattenwesen“, „Geist“ oder etwas in der Art, als ich schließlich über eine nachträglich hineingeklebte Zeichnung stolpere. Meine Finger zittern leicht, als sie über das grausige Bild fahren. Darauf ist eine Gestalt aus Schatten zu sehen, mit breiten Schultern, schmalem Kopf, krummen Beinen und langen Armen. Das Schlimmste aber ist das Grinsen. Diese Zeichnung grinst genauso, wie das Ding in Zoes Haus. Sein Kopf wirkt wie horizontal zu einem fiesen Lachen gespalten.
Ich bedecke die Zeichnung mit der flachen Hand, weil ich es nicht länger ertragen kann sie zu betrachten. Auch wenn es nur eine Zeichnung ist, so sitzt der Schock noch zu tief. Ich frage mich, ob diese Zeichnung der Beweis dafür ist, dass das, was ich gesehen habe, echt war.
Neben dem eingeklebten Bild steht etwas vertikal geschrieben. Ich drehe das Buch und lese es.
„Dämon!!! Nichts auf eigene Faust unternehmen! Chris anrufen! Nummer im Handy!!!“