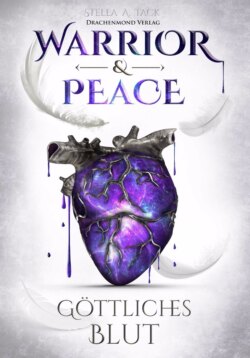Читать книгу Warrior & Peace - Stella A. Tack - Страница 11
Ich bin nicht im Himmel? Ich will mein Geld zuruck!
Оглавление»Warrior, wach auf!«
»Mhhpffff!«
»Warrior!«
»Mhpff … lass mich, ich bin tot.«
Ein Seufzen. »Nein, bist du nicht! Du liegst auf der Couch.«
»Ich … was?« Verblüfft blinzelte ich. Das Licht, das ich fälschlicherweise für das am Ende eines langen Tunnels mit den glücklichen Familienmitgliedern auf der anderen Seite gehalten hatte, entpuppte sich als ein … staubiger Kronleuchter? Mein Blick war noch ein wenig verschwommen, also blinzelte ich ein paarmal und ja … da! Kronleuchter, Spinnen, Staub in meiner Nase, also doch nicht der Himmel. Schleppend hob ich eine Hand und wischte mir über die salzig verklebte Wange. Ich musste geweint haben, denn meine Augen waren rot verquollen, genauso wie meine Nase, aus der supersexy der Rotz floss. Aber warum tat mein Hals so weh, da war … »Huuu… Huuuu… Huuuund!« Erschrocken setzte ich mich auf und griff mir reflexartig an die Kehle. O Gott! Der verdammte Höllenhund! Er hatte mir seine Zähne in die Kehle geschlagen. Ich hatte das Brechen meines Genicks gehört, als die Zähne meine Luftröhre zerfetzt und die Knochen zertrümmert hatten. Ich schmeckte immer noch mein eigenes Blut auf den Lippen, das mir schwallartig aus dem Mund geschossen war. Ich hatte bereits von meinem enttäuschend unerfüllten Leben Abschied genommen. Hatte meinen Vater und meine Mutter für die misslungene Erziehung verflucht, aber wo zum Teufel war ich denn jetzt?
»Ich bin nicht im Himmel? Ich will mein Geld zurück!«, blubberte es aus mir heraus. Mein Hirn fühlte sich wie Matsch an. Ein kleiner Teil von mir hatte sich an die Vorstellung von Wölkchen und Engelchen nach dem Tod geklammert.
Ein weiteres Seufzen drang an mein Ohr. »Tochter, du gehst mir auf die Nerven!«
»Was …?« So sprach nur einer mit mir.
»Daddy? Bist du auch im Himmel?« Der Gott der Unterwelt warf mir einen entnervten Blick zu. Er hatte es sich in einem großen Ohrensessel neben mir bequem gemacht. Die Beine hatte er übereinandergeschlagen, während er ein iPad auf dem rechten Knie abstützte. Sein dunkles Haar war halblang geschnitten und perfekt nach hinten frisiert und die violetten Augen sahen mich missbilligend über den Rand des Tablets hinweg an. Sein Körper steckte in einem dunklen Anzug mit passender roter Krawatte. Die Haut war ungewöhnlich blass. Der Tod war eine eindrucksvolle Erscheinung. Bei jeder Bewegung seines Körpers tropfte schwarzer Rauch zu Boden, der sich wie eine unheilvolle Gewitterwolke zu seinen Füßen sammelte. Dabei schmiegten sich lange samtschwarze Flügel an seinen Rücken. Der Totengott beziehungsweise seine Söhne waren die Einzigen in der Unterwelt, die solche Flügel besaßen. Jeder, der sie sah, wusste, dass man einem Mitglied des Hauses Hades gegenüberstand. Na ja, von mir einmal abgesehen.
»Warrior. Wenn du deine unpassenden Scherze beendet hast, würde ich gerne mit dir reden.«
Mühsam setzte ich mich auf und dehnte vorsichtig den Hals. Er schien noch heil zu sein. Wirklich eigenartig. Ich meine … Gott sei Dank! Aber ich verstand da grundsätzlich etwas nicht. Ich hatte meine Kehle eindeutig in den Fängen des Hundes hängen sehen. Von dem Gedanken wurde mir augenblicklich schlecht.
»Wie … wie … bin ich hier hochgekommen, Daddy? Eben war ich noch auf Ebene 144!« Ich sagte absichtlich Daddy zu ihm, weil ich wusste, dass es ihn maßlos ärgerte. Gleichzeitig gefiel es ihm aber auch. Nur würde er das niemals zugeben.
Der Herr der Unterwelt verzog missbilligend die Mundwinkel und legte das Tablet vorsichtig zur Seite.
»Was … ist das etwa eine Brille?«, fragte ich und war ein wenig perplex von dem unscheinbaren silbernen Gestell auf seiner Nase.
Hades erstarrte kurz. Seine Nasenflügel bebten, bevor er die Brille blitzschnell zusammenklappte und in seine Jackentasche steckte. »Nein, ist es nicht, Tochter. Wir müssen reden. Ich bin äußerst verärgert über dich.«
»Oh!«, sagte ich schwach und wollte die Kapuze tiefer ins Gesicht ziehen. Doch … da war keine Kapuze. Panisch tastete ich weiter nach hinten und förderte ein paar vollkommen zerfetzte Stoffreste zutage. »O Scheiße!«
»Keine Sorge. Niemand hat dich gesehen. Abgesehen von dem Höllenhund. Er war es auch, der dich zu mir gebracht hat.«
»Hades, bitte, du …«
»Unterschätze mich nicht, Warrior! Ich bin ein Gott und dein Vater!«, unterbrach er mich scharf. Ruckartig stand er auf, sodass der Nebel zu seinen Füßen aufgewirbelt wurde. Seine Flügel zitterten. Eine lange Feder segelte zu Boden. »Sei nicht so arrogant, dich für mächtiger als die Götter selbst zu halten. Dein Aussehen hat keinerlei Einfluss auf mich, was ich jedoch nicht vom Rest meiner Leute behaupten kann. Also, was in aller Götter Namen hast du hier unten zu suchen?«, brüllte er mir immer lauter werdend ins Gesicht. Seine lilafarbenen Augen, die er an mich weitervererbt hatte, glühten vor Zorn. Ängstlich presste ich die Lippen aufeinander und senkte den Kopf, sodass ein Vorhang goldfarbenen Haares meine aufsteigenden Tränen verdeckte. Ich wurde nicht oft von Hades angeschrien. Vater hin oder her. In solchen Momenten hatte ich eine Heidenangst vor ihm. »Daddy, ich …«
»Du hast es deiner Mutter und mir versprochen!«, blaffte er weiter, ohne auf meinen zaghaften Einwurf einzugehen. »Was glaubst du, wer wir sind, Warrior? Wir sind Götter! Das solltest du für keinen Augenblick vergessen. Du hast uns versprochen, kein Aufsehen zu erregen. Du bist gefährlich und schädigst unseren Ruf im Olymp. Wir können dir nicht vorwerfen, mit welchem Makel du geboren wurdest, aber du kannst zumindest den Anstand zeigen, uns keine Schande zu machen!« Sein Brüllen erschütterte den Raum und brachte den Lüster an der Decke zum Klirren. Der Rauch zu seinen Füßen erfüllte inzwischen den gesamten Raum und dimmte das Licht, sodass es plötzlich unangenehm dunkel wurde. Dennoch war der Gott problemlos zu sehen. Als würde seine Haut von innen heraus leuchten.
»Du hattest für heute Nachmittag nur eine Aufgabe, Warrior! Du solltest zu deiner monatlichen Überprüfung in den Olymp gehen. Aber was muss ich erfahren? Ich bekomme einen Anruf, dass meine Tochter meine Angestellten beleidigt und in den Kerker geworfen wurde. Das ist kein Verhalten, das ich bei meinen Kindern billige.«
Ich könnte jetzt einwerfen, dass meine Brüder weit mehr Mist bauten als ich. Sich nur nicht so oft erwischen ließen. In weiser Voraussicht hielt ich aber den Mund und verkniff mir angestrengt die Tränen.
»Du magst vielleicht meine Tochter sein«, knurrte Hades. »Glaube jedoch nicht, ich würde dich weiterhin mit Samthandschuhen anfassen. Du bist die Tochter zweier Götter. Ich erwarte mehr von dir als das!« Abfällig zeigte er auf meine zusammengekauerte Gestalt. »Bei einer weiteren Verfehlung werde ich dich auspeitschen lassen! Glaubst du etwa, ich weiß nichts von deinem kleinen Versteck bei Sokrates? Dass du deine Zeit mit Fernsehen und dummen Videospielen verplemperst? Ich habe es dir durchgehen lassen, doch damit ist ab sofort Schluss. Du hast offensichtlich vergessen, was wir sind! Wegen deiner Dummheit musste heute einer meiner besten Hunde sterben.«
»Vater, ich … er ist tot?«, fragte ich erschrocken. O nein, nicht schon wieder.
»Ich musste ihn töten, sonst hätte er jeden in deiner Nähe in Stücke gerissen. Ein Blick in dein Gesicht und er war nicht mehr zu gebrauchen. Ich musste dich persönlich aus seinen Klauen reißen!«
Ich fuhr zusammen und spürte nun doch, wie die Tränen hochkamen. »Das … das wollte ich nicht«, flüsterte ich mit rauer Stimme und schluckte angestrengt den Kloß im Hals hinunter.
»Bitte! Ich wollte mit einem der Taxis fahren. Aber die Ebenen waren gesperrt, sodass ich zu Fuß weitermusste. Da war …« Die Erinnerung an schneeblasse Haut und leuchtend blaues Haar schob sich in mein Blickfeld. Mit einem Mal stellten sich mir sämtliche Nackenhaare auf. Mein Kopf tat weh. »Da war dieser Junge … er … er hat mich den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Ich konnte nichts tun!«
Hades’ Augen verengten sich zu kleinen Schlitzen, während seine Flügel unruhig zuckten. »Mir sind die Details dieses Unfalls bekannt. Du kannst dem Schicksal danken, dass deine Kapuze heruntergerutscht war, ansonsten hätte der Hund dich zerfetzt.« Seine Stimme wurde ein wenig milder. Der Rauch zog sich langsam an seine Füße zurück und ließ sanftes Licht in den Raum strahlen. »Dieser Junge, dieser Abschaum, an den du unglücklicherweise geraten bist, ist aus dem Tartaros geflüchtet. In den letzten Stunden seiner Flucht hat er drei Abaddoner getötet und dabei beinahe auch dich!«
Mit großen Augen sah ich zu meinem Vater auf. Der Junge war also aus dem Tartaros geflüchtet? Ich hatte nicht einmal gewusst, dass das überhaupt möglich war. Schaudernd griff ich mir an die Kehle. Viel zu deutlich spürte ich noch die Zähne des Hundes, wie sie mir die Haut zerrissen. Meine Kapuze war heruntergerutscht? Daran konnte ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Dennoch saß ich hier. Unverletzt. Meine Stimme brach. »Es tut mir leid, Vater«, presste ich mühsam hervor. Was hätte ich auch anderes sagen sollen? Der Schaden war angerichtet. Hades starrte mich weiterhin wütend an, doch die Schatten zogen sich endgültig zurück. Erleichtert atmete ich auf, während er mit raschelnden Flügeln zur Tür ans andere Ende des Wohnzimmers ging.
»Also gut, Warrior. Vielleicht freut es dich, jetzt zu hören, dass wir den Abschaum einfangen konnten. Er sitzt im Tartaros und dort wird er auch bleiben.«
»Was? Wie?« Erstaunt sprang ich auf die Füße und wäre beinahe wieder nach hinten umgekippt. Aua! Mein ganzer Körper fühlte sich zerschlagen an. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rieb ich mir den Nacken. »Wie konntet ihr ihn fangen?«
Hades schnaubte. »Sei nicht naiv, Warrior, niemand entkommt seinem Schicksal. Schon gar nicht Monster wie er. Geh jetzt in dein Zimmer. Ich bringe dich morgen nach London zurück und vergiss nicht, etwas anzu…«
Die Tür schloss sich bereits hinter dem Gott, bevor er den Satz zu Ende gesprochen hatte. Mit wackeligen Knien setzte ich mich wieder hin und massierte mir meinen steifen Nacken. Die Kopfschmerzen hatten sich inzwischen in glühende Eisennägel verwandelt, die mir unaufhörlich in die Schädeldecke bohrten. Der Fremde war also festgenommen worden? Wie hatte er sich überhaupt ganze zwei Tage vor den Hunden und meinem Vater verstecken können? Beinahe bewunderte ich diese Gerissenheit und Kühnheit, die solch einer Tat vorausgegangen sein mussten. Dieser Junge … dieser Mann saß offensichtlich nicht ohne Grund im sichersten Gefängnis der unsterblichen Welt. Wer wusste schon, welchem irren Monster ich gerade noch entkommen war. Sofort kroch mir wieder die Gänsehaut über den Rücken. Seine eisgrauen Augen, waren so leer gewesen, als hätte jede Spur von Lebendigkeit in ihnen gefehlt. Ich war froh, dass die Hunde es geschafft hatten, ihn einzufangen. Er hatte mir einen Heidenschreck eingejagt. Das Bild seiner funkensprühenden Haare würde ich nie mehr aus dem Kopf bekommen. Jetzt konnte er zumindest niemanden mehr verletzten. Es war gut, dass er im Tartaros festsaß. Auch wenn ich fürchterliche Dinge über diesen Ort gehört hatte. Nicht viel. Mehr Gerüchte als Fakten. Aber das hatte gereicht, um mir ein Leben lang Albträume zu bescheren. Nur die gefährlichsten Monster, Riesen, Walküren und Götter, wie die ehemaligen Titanen, wurden in den Tartaros gesperrt. Es galt als das Hochsicherheitsgefängnis der übernatürlichen Welt. Niemand entkam von dort. Theoretisch. Offensichtlich gab es dann doch blauhaarige Ausnahmen.
Mit einem mulmigen Gefühl im Magen stand ich auf und verließ das Wohnzimmer. Im Aufstehen schnappte ich mir noch ein Kissen von dem alten und vor allem klapprigen Sofa, auf dem ich gelegen hatte, und hielt es mir schützend vor das Gesicht. Von meiner Kapuze war schließlich nicht mehr als ein kläglicher Haufen zerfetzten Stoffs übrig geblieben. Zu wenig, um mein Gesicht anständig zu bedecken. Und das Risiko, heute noch jemanden in den Wahnsinn zu treiben, war damit definitiv zu groß.
Wenn mir jemand über den Weg lief, konnte ich ihn somit schnell genug vorwarnen, rechtzeitig wegzusehen. Oder es als Waffe benutzen. Je nachdem, wem ich über den Weg lief. Knarrend schwang die schwere Tür des Wohnzimmers auf und ich begann meinen Weg durch Hades’ monströses Anwesen, das das Zentrum von Ebene 146 bildete. Der Bau war beinahe vollkommen aus dunklem Stein und Marmor errichtet, wobei das Gebäude in all den vergangenen Jahrhunderten ein verwirrender Mix aus mittelalterlichen Gemäuern, barocken Dächern, Designermöbeln aus den Zwanziger- bis Vierzigerjahren und modernen Fensterfronten geworden war. Altgriechische Säulen stemmten sich meterweit in die Höhe und trugen eine kuppelartige Decke, die mit kunstvollen Malereien aus der Renaissance bedeckt war. Die Farbe war bereits verblichen und bröckelte stellenweise ab, sodass nur noch vereinzelte Fetzen von kämpfenden Männern, die sich gegenseitig zu Boden rangen, übrig blieben. Die einzige Figur, die noch annähernd gut zu erkennen war, stand ein wenig abseits des Kampfgeschehens und blickte mit blutigen Tränen auf das Schlachtfeld herab. Seine dunklen Haare sahen bläulich aus. Ich blieb stehen, legte den Kopf in den Nacken und starrte amüsiert nach oben. Einer meiner Brüder musste vor Kurzem seine kreative Ader gefunden haben. Zumindest hatte die Zeichnung das letzte Mal, als ich hier gewesen war, noch keine Harry Potter-Narbe und kein Hitler-Bärtchen unter der Nase gehabt.
Augenrollend ging ich weiter, wobei meine Schritte laut von den nackten Wänden hallten. Hier und dort kreuzte eine Fackel moderne Lampen oder eine rostige Ritterrüstung lehnte an einem verstaubten Picasso. Vor den Fenstern wogten ein paar rote Lavalampen. Der Boden wechselte von Beton zu marmoriert oder schwarz-weiß gefliest, bis ich die große Halle erreichte, deren Wände von großen, nach oben hin spitz zulaufenden Fenstern gesäumt waren, die einen herrlichen Blick auf die nächtliche Skyline von Uptown preisgaben. Da wir uns unter der Erde befanden, schien zwar kein Mond, doch der Strom war wohl in den letzten Stunden wieder eingeschaltet worden, sodass die Stadt in einem hellen Lichtermeer erstrahlte. Anders als auf Ebene 144, die hauptsächlich aus alten und stinkenden Baracken bestand, war Ebene 146 eine hochkultivierte Stadt. Abaddon war nicht nur als Hölle im klassischen Sinne anzusehen, in der die bösen Buben bestraft wurden, sondern es war eine vollkommen eigenständige Metropole. Eine dunkle Welt, die sich über viertausend Jahre lang entwickelt hatte. Zugegeben, die ethischen Ansichten waren hier unten ein wenig … gewöhnungsbedürftig und in manchen Ebenen schien die Zeit im Mittelalter festgefroren zu sein, dennoch war Abaddon eine blühende, sich stetig weiterentwickelnde Zivilisation. Ich war gerne ein Teil davon. Zumindest manchmal.
»Hey, Prinzessin, hab gehört, du hast unseren alten Herren ganz schön auf die Palme gebracht.«
Erschrocken zuckte ich zusammen und fuhr, das Kissen schützend vors Gesicht gepresst, um die eigene Achse.
»Madox! Nicht hinsehen!«, fauchte ich, doch der idiotische Junge lachte nur verschmitzt und kam mit geschlossenen Augen auf mich zugewankt.
»Kein Grund zur Panik, Warrior, Schatz. Man kann dich zehn Kilometer gegen den Wind riechen. Gibt es einen besonderen Grund, warum du nach Fäkalien und Müll stinkst? Habe ich den internationalen Stinktiertag verpasst? Wenn ja, rolle ich mich schnell im Biomüll.«
Mein Gesicht lief puterrot an, als ich an mir herabsah. Oh, verdammt! Ich hatte immer noch den Schlamm von Ebene 144 auf mir kleben. »Bei den Göttern, ist das peinlich«, winselte ich, was Madox nur noch lauter lachen ließ. Finster starrte ich ihn an, freute mich jedoch gleichzeitig, ihn zu sehen. Mein Halbbruder war ein groß gewachsener junger Mann. Anders als meine anderen Brüder bestand dieser aber nicht nur aus Muskeln und sadistischen Gesichtszügen. Zwar hatte auch er beides geerbt – und das manchmal nicht zu knapp –, sein Gesamtbild und seine Persönlichkeit waren im Allgemeinen allerdings etwas geschmeidiger. Ähnlich einer verspielten Raubkatze. Dichtes dunkles Haar stand in alle Richtungen ab und seine Haut leuchtete in einem warmen Hellbraun, während seine Flügel die Farbe von Schokolade hatten. Wie immer schien er sein Hemd verlegt zu haben und stakste mit nicht mehr als einer zerfetzten Jeans durch die Gegend. Daher war auch die um seinen Bauchnabel tätowierte Sonne zu sehen. Wenn man ihn nach der Bedeutung der Tätowierung frage, tischte er einem – meistens den Frauen – eine rührselige Geschichte über die Reinheit der Seele und Ehrerbietung der Götter auf. In Wirklichkeit war er einfach stockbesoffen gewesen und hatte Glück gehabt, nicht auf das Bild eines Schmetterlings, gleich neben der Sonne, gezeigt zu haben. Ich war auch die Einzige, die wusste, dass er während der gesamten zwei Stunden wie ein kleines Mädchen geflennt und sich dabei auch noch versehentlich selbst angekotzt hatte. Man konnte wohl behaupten, dass Madox und ich seit jeher beste Freunde waren. Mit nur knapp zwei Jahren Altersunterschied waren wir die Jüngsten im Hause Hades. Etwa ein bis dreißig Jahre trennten uns von den restlichen fünf Söhnen des Hades, die – insbesondere früher – allesamt stärker waren und einen Hang zu wahnhaftem Narzissmus besaßen. Infolgedessen hatte uns das Leben zusammengeschweißt.
»Kannst du bitte aufhören zu schnüffeln! Ich hatte keine andere Wahl!«, motzte ich Madox an und versuchte, ihm gegen das Schienbein zu treten. Trotz geschlossener Augen wich er meinem PseudoNinja-Angriff geschickt aus.
»Welche Wahl? Zwischen Hund oder Müllkippe?«, wieherte er und wischte sich die Lachtränen über seinen eigenen Witz aus dem Gesicht. Hahaha. Dieser Witzbold.
»Halt einfach die Klappe! Ich muss mich umziehen, bevor mich noch jemand sieht«, fuhr ich ihn mürrisch an, musste mir das Lachen aber ebenfalls verkneifen.
»Du bist aber nicht nackt, oder?«, fragte Madox interessiert.
Prompt knallte ich ihm das Kissen gegen den Kopf. »Nein! Spinnst du? Nur mein Gesicht ist frei«, erwiderte ich und hechtete zur großen Treppe, die nach oben in den zweiten Stock führte.
Madox folgte mir gut gelaunt. Die Augen hielt er dabei immer noch artig geschlossen. »Nur dein Gesicht? Was soll dann der Aufstand? Vater erzählte etwas über deine Klamotten, die vollkommen zerfetzt worden wären.« Seine sorglosen Worte ließen mich abrupt stehen bleiben. Madox rannte ungebremst in mich hinein. »Uff, was zum … Warrior?«
»Er … ein … ein Höllenhund musste heute wegen meinem Gesicht sterben.« Ich klang verdächtig tonlos.
Madox versteifte sich. Tastend hob er eine Hand und strich mir unendlich liebevoll über die Wange. »Das tut mir leid, Warrior. Vater hatte gerade erst zu erzählen angefangen. Ich bin gleich losgerannt, um dich zu suchen, und habe die Geschichte nicht zu Ende angehört. Wenn du willst, hau mir eine rein! Komm schon. Ich bin ein Arschloch. Ich hab es nicht anders verdient.« Ohne es zu wollen, musste ich kichern, als mir Madox mit verzerrter Märtyrer-Miene sein Gesicht entgegenstreckte und nach meinen Händen angelte. »Komm! Heb deine kleinen Fäustchen und schlag zu.«
»Blödmann!« Lachend wuschelte ich ihm durch das ohnehin schon zerzauste Haar und drückte ihm einen kleinen Kuss auf die Nasenspitze.
Madox schenkte mir ein spitzbübisches Grinsen, bei dem es verräterisch silbern aufblitzte.
»Was? Mad… hast du dir die Zunge piercen lassen? Reichen die Ohren und Augenbrauen nicht? Willst du aussehen wie ein Nadelkissen?«, fragte ich irritiert, während wir ein weiteres Stockwerk nach oben wankten. Es war ein Wunder, dass er dabei nicht auf die Schnauze fiel. Vorsichtshalber pikte ich ihm mit dem Zeigefinger in den Rücken und lotste ihn über alle Hindernisse hinweg. Der marmorne Boden war hier oben gemütlich beheizt und alte weinrote Liegesofas aus altrömischer Zeit drängten sich in staubigen Nischen. Uralte Büsten und Gemälde von Göttern und anderen Sagengestalten hingen an den Wänden, zusammen mit kunstvollen Blumenarrangements, die in all dem alten Müll ein wenig deplatziert und zu frisch wirkten.
»Freesien?«, fragte ich Madox ein wenig gequält, als wir an einem Blumenstrauß vorbeigingen, der im Helm einer Ritterrüstung steckte.
Madox verzog mitleidig das Gesicht. »Mutter ist hier, tut mir leid, Prinzessin!«
Ich stöhnte. Heute war wirklich nicht mein Tag. »Also? Was ist das jetzt mit dem Metall in deiner Zunge?« Mit zusammengekniffenen Augen versuchte ich, einen weiteren Blick auf das Ding in seinem Mund zu erhaschen. Aha! Da! Eindeutig. Madox’ breites Grinsen zeigte einen gebogenen Ring mit roten Glitzersteinchen.
»Ach, dieser Stecker? War eine Wette mit Bright. Du musst nichts sagen, ich weiß, wie bescheuert das ist, glaub mir, ich wurde bereits ordentlich dafür verprügelt.«
In schmerzlicher Erinnerung rieb er sich das störrische Kinn, dabei linste er zu mir hinüber. Seine grünen Augen wurden eine Spur dunkler. Als ich ihm einen warnenden Klaps gab, seufzte er genervt, schloss jedoch wieder artig die Augen. Ein kurzer Blick würde ihn nicht umbringen. Vermutlich. Aber sicher war sicher.
»Ich dachte, Vater reißt mir das Ding mitsamt Zunge heraus.« Mitleidig verzog ich das Gesicht und nahm seine Hand in meine. Unsere Finger verflochten sich langsam ineinander, wie sie es seit Kindertagen taten.
»Was sagt Persephone dazu?«
»Soll das ein Witz sein? Mum war diejenige, die mich dafür verprügelt hat!«
»Autsch!« So ganz konnte ich mir bei dem Gedanken das Lächeln nicht verkneifen. Dennoch litt ich mit ihm. Persephone war Madox’ und Brights Mutter und Hades’ Frau seit … na ja, seit Urzeiten eben. Meine restlichen Brüder hatten jeweils andere Mütter – allesamt unbekannter Identität. Götter hatten es nicht unbedingt so mit dem Konzept der Treue. Zumindest, wenn man den Fluten an Frauen nachging, die hier regelmäßig aus dem Schlafzimmer meines Vaters wankten. Oder den Männern und Frauen aus Persephones. Als geborene Olympierin war es ihr allerdings auch nur wenige Monate im Jahr erlaubt, in der Hölle bei ihren Söhnen zu leben. Als Tochter der Demeter war Persephone, wie ihre Mutter zuvor, die Göttin der Fruchtbarkeit und des Frühlings. Der Grund, warum sie ausgerechnet Hades, den so ziemlich unblumigsten Typen, den ich kannte, hatte heiraten müssen, war mir bis heute unverständlich. Die beiden schienen sich nicht einmal wirklich zu mögen. Trotzdem behauptete Hades steif und fest, dass er Persephone ab dem ersten Augenblick ihrer Erschaffung hatte besitzen müssen. Als er jedoch bei meinem Onkel Zeus um Erlaubnis der Heirat bat, hatte dieser weder die Eier, dem zuzustimmen, noch hatte er den Mut, diese Bitte abzulehnen. Hades fasste das natürlich prompt als Zustimmung auf und nahm sie mit in die Unterwelt. Ihre Mutter Demeter war daraufhin so wütend, dass sie sämtliche Pflanzen eingehen ließ, sodass die Menschen elendig verhungerten. Schließlich musste Hades Persephone wieder aus der Unterwelt entlassen. Doch da diese bereits mit Hades verheiratet war – und hochschwanger noch dazu –, stimmte Demeter zu, Persephone vier Monate im Jahr in die Unterwelt zu lassen. Allerdings verweigerte die Göttin es bis heute, in dieser Zeit etwas wachsen zu lassen, sodass die Menschen wegen der verklemmten alten Schachtel den Winter ertragen mussten.
Diese Geschichten und weitere hatte ich mir als Kind zusammen mit Madox zuhauf anhören müssen. Ob diese nun wirklich stimmten oder mein Vater Persephone einfach nur in einer Bar abgeschleppt hatte, würde wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Die Götter liebten es, sich mit ihren alten Geschichten und Heldentaten zu rühmen. Da war Persephone keine Ausnahme, die in etwa den charmanten Charakter eines Drachens geerbt hatte, was man insbesondere an ihrem fiesen rechten Haken zu spüren bekam. Ihre Ohrfeigen waren auch nicht von schlechten Eltern. Ich zumindest versuchte, in den vier Monaten ihres Besuches so wenig Zeit wie möglich in der Unterwelt zu verbringen.
»Ich freu mich schon darauf, sie wiederzusehen«, brummte ich leise und stand endlich vor der Tür meines Zimmers. Da ich nur sehr unregelmäßig Zeit in der Unterwelt verbrachte, war es wesentlich kleiner als die Gemächer meiner Brüder. Dennoch konnte ich getrost auf eine eigene Waffenkammer und einen Sportraum verzichten. Dafür hatte Hades das Bedürfnis, mich mit Unmengen an Kleidern überhäufen zu müssen, die ich niemals würde anziehen können. Die große rosarot gestrichene Tür, auf die Madox und ich kitschige Regenbogen-Einhörner gemalt hatten, erkannte mich sofort und schwang mit einem einladenden Quietschen auf.
»Setz dich!«, wies ich Madox an und zog ihn in Richtung Bett. »Ich zieh mir nur schnell was anderes an.«
Sofort ließ sich Madox auf das blaue Himmelbett plumpsen, dabei flatterten ein paar seiner Federn in alle Richtungen.
»Alles klar! Sag mal, möchtest du über heute reden?«, fragte er mich und wühlte sich wie ein großer Hundewelpe durch meine Kissen. Na toll! Morgen würde ich mit Sicherheit ein paar Dutzend ausgefallene Federn aus meinen Haaren fischen dürfen.
»Sicher«, antwortete ich seufzend und begann damit, ihm die schreckliche Auseinandersetzung mit Gladis von heute Nachmittag zu erzählen. Währenddessen angelte ich mir eine schwarze Jeans und einen passenden roten Kapuzenpulli aus dem Kleiderschrank. Meine verdreckten Stiefel kickte ich achtlos von den Füßen und warf die durchweichten Socken in den Müll. Sie stanken entsetzlich nach Jauche.
»Und dann kam dieser Vampir«, erzählte ich auf dem Weg ins Badezimmer. »Der Idiot hat meine Fährte aufgenommen, sodass ich mich im Müll verstecken musste!« Schnell zog ich mich aus und stellte mich unter die Dusche. Beiläufig schamponierte ich mir die Haare und schrubbte über meine blasse Haut, auf der überall blaue Flecken und Schürfwunden zu sehen waren.
»Und dann?« Madox’ Stimme drang durch den Dampf des Badezimmers hindurch.
»Was? Hau ab, du perverser Spanner! Ich erzähl gleich weiter«, schimpfte ich und spuckte ein wenig Wasser aus.
Madox hatte sich inzwischen eine meiner Schlafmasken über die Augen gezogen. »Pff, krieg dich wieder ein. Ich schau schon nicht hin. Es ist gerade spannend, also erzähl weiter.« Kurz zögerte ich, vergewisserte mich, dass Madox, der sich gerade auf den zugeklappten Toilettensitz fallen ließ, wirklich nichts sehen konnte und begann die Geschichte weiterzuerzählen, während ich mich beeilte, die Dusche zu beenden.
In ein flauschiges Handtuch gewickelt, tapste ich zu dem marmornen Waschbecken und kramte einen Föhn hervor. Langsam wischte ich über den beschlagenen Spiegel und musterte mein Gesicht, ohne in der Geschichte innezuhalten.
»Und dann war da dieser Junge. Er … er war eigenartig, ich …« Murmelnd blickte ich in den Spiegel und spürte, wie sich meine Gesichtszüge verhärteten. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel blickte, hatte ich das Gefühl, eine Fremde anzustarren. Vielleicht lag es auch an meinen angespannten Nerven oder dem fürchterlichen Tag, der hinter mir lag, allerdings war ich mir nie so extrem erschienen. Ohne Klamotten, die mich versteckten, war ich ein vollkommen anderes Wesen. Mein Körper war zierlich, mit einer schmalen Taille, die in eine geschwungene Hüfte mündete. Goldenes Haar lockte sich in Wellen über meinen Körper, wo es beinahe meine Kniekehlen kitzelte. Ich hatte es bereits mehrere Male abzuschneiden versucht, leider wuchsen sie genauso schnell wieder nach, wie ich sie kürzte. Das Einzige, was ein wenig aus dem Rahmen der perfekten goldenen Jungfrau fiel, waren meine katzenhaften violetten Augen, die denen meines Vaters ähnelten. Groß blickten sie unter einem Vorhang aus pechschwarzen Wimpern hervor. Mein Gesicht war ausnahmslos perfekt. Kein Pickel, kein Muttermal, keine Falte. Alles an mir war schön. Dabei wirkte ich auch noch zerbrechlich … wie Glas. Mein Spiegelbild zeigte mir einen verfluchten goldhaarigen Engel! Die schönste Tochter der Aphrodite seit Jahrtausenden, wie meine Mutter gerne verächtlich hervorspie. Mit dem einen Makel, dass meine Schönheit so ziemlich jeden zerstörte, der einen Blick darauf riskierte.
Mein Anblick rief Obsession hervor.
Ein Fleck freier Haut genügte. Ein unbedachter Augenblick, und ich ließ jeden wahnsinnig vor Verlangen werden.
Hingabe wurde zu zerstörerischem Kontrollzwang.
Beschützerinstinkt zur rasenden Eifersucht.
Selbst mein Geruch machte süchtig wie eine süße Droge.
Die Götter nennen es das Medusa-Syndrom. Umgangssprachlich war es allerdings eher als der Medusa-Effekt bekannt.
Es handelte sich um einen Gendefekt. Eine Überzüchtung von zu viel magischem Blut in meinem Körper, der dafür zu schwach war.
Die traurige Wahrheit: Ich bin ein Monster mit dem Gesicht eines Engels. Angeekelt wandte ich mich von mir selbst ab und unterdrückte den aufsteigenden Selbsthass.
»Lass es, Warrior. Du kannst nicht ändern, was du bist oder wie du aussiehst«, unterbrach Madox mein Trübsalblasen. Erstaunt blickte ich zu meinem Bruder, der immer noch mit der lächerlichen Nachtmaske über den Augen auf der Kloschüssel saß. Mit einem wehmütigen Lächeln sah er in meine Richtung. Nicht zum ersten Mal kam es mir so vor, als könnte er meine Gedanken lesen. »Du kannst nichts dagegen tun, Warrior, und selbst wenn, ich würde nichts an dir ändern wollen«, flüsterte er.
Traurig lächelte ich ihm zu. Madox’ Vertrauen in mich war unerschütterlich. Schon seit Jahren, besser gesagt, mit dem Einsetzen der Pubertät hatte er mein Gesicht nicht mehr gesehen oder sonst ein Fleckchen freier Haut. Auch wenn er steif und fest behauptete, die Kontrolle behalten zu können. Trotz dieser Aussage würde es für immer Theorie bleiben. Ich könnte es nicht ertragen, sein Leben wegen eines einzigen unbedachten Augenblicks zu zerstören.
»Danke«, seufzte ich leise und begann meine Haare zu föhnen, die sich augenblicklich in perfekte Locken auf meinen Rücken schmiegten. Danach schlüpfte ich in meine neuen Sachen. »Jedenfalls …«, nahm ich den Faden meiner Erzählung wieder auf und flocht mir mit schnellen Bewegungen einen straffen Zopf. » … schmiss mich dieser Idiot vor die Hunde!« Achtlos stopfte ich ihn in den Pulli und zog die Kapuze über den Kopf.
»Was? Einfach so?«, fragte Madox stirnrunzelnd.
»Hä? Ähm. Nein! Ich denke, sie sollten so lange damit beschäftigt sein, mich zu fressen, damit er in Ruhe die Kurve kratzen konnte.«
Mads Stirnrunzeln wich einem wütenden Zähnefletschen. »Dieser dreckige kleine Mistkerl. Schlau, schmutzig und gewissenlos, der Typ kommt definitiv aus einem der finstersten Löcher der Hölle. Aber wie konntest du das überleben?« Madox’ Flügel zitterten vor unterdrückter Wut.
Hilflos zuckte ich mit den Schultern. »Das ist ja das Seltsame. Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, ich sei bereits tot … aber nein, mir ist nichts passiert. Meine Kapuze ist nur heruntergerutscht, bevor es wirklich hässlich werden konnte. Der Hund hat mein Gesicht gesehen und den Rest kannst du dir denken!« Nervös knabberte ich an meiner Unterlippe und nahm mir eine der Sonnenbrillen aus dem Kästchen unter der Spüle. Es handelte sich um ein modisches Designerstück, das mit seinen dunklen Gläsern mehr als die Hälfte meines Gesichtes bedeckte. Die Brille hüllte meine Welt in permanente Dunkelheit. Ich hasste sie. Trotzdem setzte ich sie auf und schlüpfte schlussendlich in neue Handschuhe und Schuhe. »Tja, das war’s. Scheißtag! Du kannst diese rosa Tussimaske jetzt runternehmen, Mad, ich bin fertig.«
Sofort riss sich Madox das Stück von seinem Gesicht und stürmte quer durch das Bad auf mich zu. Überrascht quiekte ich auf, als er mich stürmisch an sich drückte. Dabei raschelten seine dunklen Flügel leise, als er diese wie einen schützenden Kokon um uns beide legte. Kurz wehrte ich mich gegen diesen heftigen Gefühlsausbruch, doch als ich Madox’ Schultern beben spürte, legte ich meinen Kopf an seine Brust und tätschelte beruhigend seinen angespannten Bizeps.
»Keine Sorge. Mir gehts gut, Mad. Es ist nichts Schlimmes passiert.«
»Ich werde diesen Mistkerl umbringen«, knurrte er in den Stoff meiner Kapuze und atmete scharf aus. »Ich werde diesen mit Syphilis überwucherten Arsch finden, seinen schleimigen Kopf abschneiden und ihn dann an die Hunde verfüttern.«
Ich lachte leise und streichelte weiter beruhigend seinen Arm, dessen Muskeln sich fester anspannten.
»Alles klar, großer Krieger. Erstens war sein Kopf nicht schleimig und zweitens sitzt der Mistkerl wieder im Tartaros fest, also kannst du aufhören, blutige Rache zu schwören, ja?«
Abrupt senkte Madox seine Flügel. Finster starrte er auf mich herab und kniff die Lippen zusammen. »Was soll das heißen, er ist nicht schleimig? Natürlich ist er das! Er hat dich angefasst und dir Angst eingejagt und dich beinahe an die Hunde verfüttert. Für mich macht ihn das zu einer schleimigen, dreckigen Ratte mit Pestbeulen an den Eiern.«
Genervt verdrehte ich die Augen und ging ins Schlafzimmer. »Lass es, Mad! Ich will über den Typen nicht mehr reden.«
»Hast du ihn etwa genauer gesehen?«, fragte mich mein Bruder misstrauisch. Seine Augen leuchteten raubtierhaft im Dämmerlicht der Deckenlampe.
»Herrgott noch mal! Natürlich habe ich ihn gesehen! Er hat mich wie einen Teddybären an sich gedrückt.«
Madox’ Nasenflügel bebten. »Du hast ihm erlaubt, dich zu berühren?«
»Was …?« Fassungslos darüber, in welche Richtung sich dieses absolut lächerliche Gespräch entwickelte, blieb ich stehen und stemmte die Hände in die Hüfte. »Nein, du Holzkopf! Ich habe ihm natürlich nicht erlaubt, mich anzufassen. Stell dir vor, dass es nicht ganz so freiwillig gewesen ist, sich von einem bekloppten, muskulösen Typen in den Schlamm drücken zu lassen, während er mir droht, die Kehle aufzuschlitzen!«
Madox starrte mich an.
Lange.
»Er war muskulös?«
»Ahh!« Lachend warf ich Madox ein Kissen von meinem Bett gegen den Kopf.
Armselig sanft klatschte es gegen sein Gesicht und landete wie ein flacher Pfannkuchen am Boden. Madox hob eine Augenbraue. »Das ist häusliche Gewalt, Frau! Aber lenk nicht ab. War er muskulöser als ich?«
»Halt einfach die Klappe, Mad! Ich wollte nicht gekidnappt werden, ich wollte nicht angefasst werden, nur leider konnte ich nichts dagegen tun und jetzt Schluss damit. Wir sehen ihn nie wieder!« Wütend stapfte ich an Madox vorbei zur Tür.
»Warrior«, hielt er mich mit weicher Stimme auf.
»Was?« Genervt drehte ich mich um. Ein Polsterkissen knallte mir hart ins Gesicht.
»Du musst nicht immer das letzte Wort haben«, schniefte er und stakste mit hocherhobener Nase an mir vorbei und in den Flur hinaus.