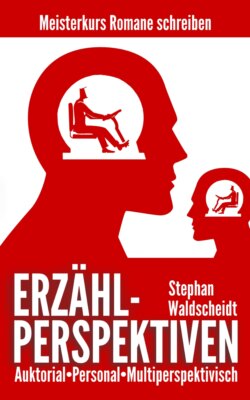Читать книгу ERZÄHLPERSPEKTIVEN: Auktorial, personal, multiperspektivisch - Stephan Waldscheidt - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
So stellen Sie Nähe oder Distanz her
ОглавлениеNähe zwischen Leser und Figur stellen Sie mit erzählerischen Mitteln am leichtesten und effektivsten genau in dem Moment her, in dem Sie eine Figur einführen. Fast immer funktioniert es, den Lesern einen Charakter vorzustellen, der ihnen in wichtigen Aspekten ähnelt oder Erfahrungen mit ihnen teilt.
Ähnlichkeiten können sich in der Persönlichkeit finden, in den Lebensumständen oder in Situationen, die dem Leser vertraut sind, wie eine Unterhaltung am Küchentisch, das Stehen im Stau, die unglaubliche Verbohrtheit der Eltern beim Thema Musik und deren Lautstärke.
Am meisten Leser erreichen Sie, klar, mit sehr allgemeinen Dingen wie dem Geschlecht oder der Herkunft. Bei den Erfahrungen sorgen Banalitäten (Klischeewarnung!) wie das verstörende Klingeln des Telefons mitten in der Nacht für Nähe: Ein Anruf um diese Zeit bedeutet nichts Gutes! Auch hier entscheidend: Wer ist Ihre Zielgruppe?
Besonders nahe heran holen Sie Leser mit tief in ihrer Psyche verankerten Dingen. So kennen die meisten das Gefühl, jemanden nicht wert oder für etwas nicht gut genug zu sein – mangelnder Selbstwert oder das Gefühl, nicht dazuzugehören. Sobald Sie diese universellen Emotionen angraben, sind die Leser bei Ihren Figuren. Wie das im Folgenden Joe Hill tut. Seine Protagonistin Vic denkt:
»…
Sie wünschte, sie wäre sich der großen Kluft zwischen dem Wert, den die Männer in ihrem Leben ihr zuschrieben, und ihrem tatsächlichen Wert nicht dermaßen bewusst. Sie hatte, so schien es ihr, immer zu viel verlangt und erwartet und zu wenig gegeben. Beinahe schien sie einen perversen Drang zu haben, es jeden bedauern zu lassen, der sich um sie sorgte, und genau die eine Sache zu finden, die diese Menschen am meisten abschrecken würde – und das dann so lange zu tun, bis diese Menschen aus purer Selbsterhaltung weglaufen mussten.
…«
(Joe Hill, »N0S4A2«, Gollancz 2013, eigene Übersetzung)
Haben Sie in einem ersten Schritt Sympathie für den Charakter erzeugt, können Sie in einem nächsten spezifischer werden und sich damit von den Lesern wegbewegen.
Nehmen wir an, Sie haben eine weibliche Hauptfigur aus Deutschland vorgestellt. Auf diese Weise liefern Sie der Mehrzahl der Leser Vertrautes. Sofern die Erzählstimme ebenfalls ankommt, stehen die Chancen auf eine Grundsympathie bestens. Als Nächstes enthüllen Sie die Leidenschaft des POV-Charakters für texanische Bluegrass-Musik, für viele Leser etwas Fremdes. Aber, und hier hilft Ihnen die Psychologie, weil die Romanfigur der deutschen Leserin da schon sympathisch ist, wirkt auch der eigentlich fremde Musikgeschmack sympathischer. Der umgekehrte Weg – erst die Musikvorliebe, dann die passende Demografie – würde weniger gut funktionieren.
Nicht zuletzt sind es solche Ähnlichkeiten, die sich das Buchmarketing zunutze macht und die mit entscheiden, ob man Ihren Roman veröffentlicht: So bevorzugt man in den Verlagen Protagonistinnen für ein vorwiegend weibliches Genre-Publikum. Auch Regiokrimis stellen auf vergleichbare Weise Nähe her: Indem sie ihren Lesern eine vertraute Umgebung zeigen, gleichen sie die Lebensumstände des Protagonisten denen ihrer angestrebten Leserschaft an.
Die Ich-Erzählerin im nächsten Beispiel beschreibt das Gefühl von Musik aus Kopfhörern, das sich für jeden aus der Zielgruppe dieses Jugendbuchs sattsam bekannt anfühlt – und für Nähe sorgt:
»…
Die großen Kopfhörer liegen weich auf meinen Ohren und verschlucken die Außenwelt. Sie sind wie ein Verstärker, ein Mikroskop für mein Innenleben. Ich höre nur noch meinen rasenden Puls und meinen flachen Atem, die sich mit dem Klang der Musik vermischen. Das bin nicht ich. Dieses starrende Wesen, das die Augen nicht von ihm losreißen kann. Die mit den zitternden Fingern und den weichen Knien. Meine Hände umklammern noch immer das Buch, in dem ich vor ein paar Sekunden gelesen habe – als ich noch ich war und die Geschichte fesselnd. Hör endlich auf, ihn anzustarren. Komm schon, Tessa, schau weg. Aber ich kann nicht. Weder wegsehen noch denken. Als wäre mein Verstand zu Boden gegangen und ich gefangen in einem fremden Körper, der herrlich seltsame Dinge tut. Meine Fingerkuppen sind taub, meine Hände eiskalt und mein Magen fährt Karussell.
…«
(Anne Freytag, »Mein bester letzter Sommer«, Heyne fliegt 2016)
Schreibtipp »Body-Horror«
Körperliche Erfahrungen von Emotionen sind ein wichtiges Mittel zur Annäherung an einen Charakter. Doch diese schlagen schnell um in unfreiwillige Komik oder … Grauen. Bei Anne Freytags Protagonistin haben wir auf engstem Raum: rasender Puls, flacher Atem, starren und umklammern, zitternde Finger, weiche Knie, Verstand zu Boden gegangen, gefangen in einem fremden Körper, taube Fingerkuppen, eiskalte Hände, Karussell fahrender Magen.
Damit handeln Sie sich weitere Probleme ein: Wie wollen Sie diese Sache noch steigern? Soll der Magen Achterbahn fahren, dann Interkontinentalrakete? Werden die Knie erst weich, dann flüssig, dann gasförmig? Und wie oft in Ihrem Roman können Sie das den Lesern anbieten? Auf jeder Seite? Wie viele Körperteile und Organe hat Ihre Protagonistin?
Ihnen gefällt das so? Dann sollten Sie unbedingt darüber nachdenken, einen Roman über einen Tausendfüßler zu schreiben.
Der umgekehrte Weg, vom Fremden zum Vertrauten, ist schwieriger und langwieriger. Denn dann müssen Sie den Ersteindruck, der im Roman wie im Leben ein hartnäckiger ist, revidieren.
Die Entfernung zu etwas Unbekanntem können Sie graduell überbrücken, um mehr Nähe herzustellen. Wie hier in diesem Science-Fiction-Text:
Du kennst das, wenn dein Flieger von Turbulenzen durchgeschüttelt wird und du sicher bist, in den nächsten Minuten tot zu sein. Du weißt vielleicht auch, wie es sich anfühlt, nach zu vielen Cocktails und Zigaretten und nur drei Stunden Schlaf am Morgen in einem fremden Bett aufzuwachen und keine Ahnung zu haben, wo du bist. Stell dir die Turbulenzen statt in deinem Magen in deinem Hirn vor und den Kater statt in deinem Kopf in deinem Unterleib. Multipliziere das und die Verwirrung und die Sicherheit, sterben zu müssen, mit zehn, und du weißt, wie es sich anfühlt, dreitausend Lichtjahre weit gebeamt worden zu sein.
Mich haben sie drei Millionen Lichtjahre weit gebeamt.
Ein andere SciFi-Text, Blake Crouchs Roman »Dark Matter. Der Zeitenläufer«, hat hingegen ein Problem damit, Nähe herzustellen. Obwohl vieles darin funktioniert und die Story fesselt, kommen die Leser den Charakteren nicht nahe. Seine Leser gefunden hat der Roman dennoch. Eben die Art Leser, denen eine flotte Handlung wichtiger ist als Identifikation mit den Protagonisten.
Beispielhaft zeigt der Roman, womit Sie Distanz aufbauen können: indem Sie das funktionale Muster einer Szene zerstören.
Bau einer Szene
Eine vollständige[Fußnote 17] Szene besteht im Wesentlichen aus sieben Bestandteilen. Der erste Teil, der auf die Außenwelt gerichtete Aktionsteil (scene), beginnt mit dem Ziel des Protagonisten, das er dann in Handlung, in Aktion umsetzt. Der Handlung aber kommt ein Widerstand in die Quere, was einen Konflikt auslöst. Und dieser verhindert, dass der Held sein Szenenziel erreicht, für ihn eine Katastrophe.
Der zweite Teil (sequel) ist eine, in der Innenwelt des Protagonisten stattfindende, Reaktion auf die Katastrophe des ersten Teils. Die Reaktion kann emotionaler und/oder rationaler Natur sein, in jedem Fall sorgt sie für einen Stillstand, ein Dilemma, denn der Protagonist hat sein Ziel nicht erreicht, er muss sich neu sortieren und nach einer anderen Lösung suchen. Hat er die gefunden, trifft er eine Entscheidung, wie er weiter vorgeht. Sucht er ein anderes Ziel? Engagiert er Verbündete? Beschafft er sich Waffen? Oder bessere Argumente? Mit diesem neuen Ziel stürzt er sich in die nächste Szene …
Crouch beschränkt sich an zu vielen Stellen seines Romans nur auf den Aktionsteil einer Szene und unterschlägt den Lesern den Reaktionsteil und damit Gedanken und Gefühle, Dilemmas und Entscheidungsprozesse. Dieser Reaktionsteil aber, diese Innensicht ist das, womit Sie die Nähe der Leser zu den Charakteren auf besonders effektive Weise herstellen.
Meisterliche Autoren können den Reaktionsteil zwischen den Zeilen verstecken, wie das Yves Ravey in seinem Krimi »Bruderliebe« gelingt, den wir uns unten noch genauer ansehen. Für die meisten unter Ihnen dürfte ein Reaktionsteil in den Zeilen das probatere Mittel sein, Nähe zwischen Lesern und Romanfiguren herzustellen.
Crouchs Roman zeigt einen weiteren Knackpunkt auf, der Nähe erschwert oder verhindert: Der Protagonist versteht zu häufig selbst Offensichtliches nicht, etwa Hinweise auf die wahren Hintergründe, die den Lesern sofort klar sind.
Dabei fühlen sich die Leser gern schlauer als der Protagonist. Bis zu einer gewissen Grenze kann ein solches Überlegenheitsgefühl mehr Nähe erzeugen. Das aber funktioniert nicht länger, wenn der Protagonist sich als zu dämlich entpuppt oder weit unter seinen Möglichkeiten agiert. Niemand will sich mit einem Dummkopf identifizieren – und sich cleverer fühlen zu dürfen als ein Schwachstecker, ist nur eingeschränkt erhebend. Einem doofen Protagonisten fühlt sich kein Leser nahe.
Anders sieht es aus, wenn der Protagonist schlicht langsamer als der Durchschnitt ist oder ein Mensch mit Behinderung, wenn er hilfsbedürftig ist oder ein Kind, wenn er Schutz braucht oder in einer Notlage steckt. Dann weicht das Gefühl der Überlegenheit im Leser einem Beschützerinstinkt und Mitgefühl. Was ebenfalls Nähe erleichtert.
Faszination hingegen – eine zentrale Eigenschaft vieler Antagonisten – distanziert grundsätzlich. Denn was die Leser fasziniert, ist in aller Regel gerade das ihnen Fremde, das Andersartige. Von jemandem, der so ist wie der Leser, geht nichts Faszinierendes aus.
Distanz können Sie auch darin bemessen, ob Ihr Erzähler eher erzählt, im Sinne einer narrativen Darlegung der Ereignisse, oder ob er die Ereignisse zeigt, sie also direkt und szenisch darbietet.
Etwas zu erzählen schiebt eine spürbare Distanz zwischen Leser und Story: den sichtbaren Erzähler. Beim Zeigen hingegen wird der Erzähler für die Leser unsichtbar und die Distanz zur Story unmerklich.
Die Empfehlung des »Show, don’t tell!« könnten Sie, auf die Erzählperspektive bezogen, so übersetzen: »Hole die Leser lieber nahe an die Ereignisse deines Romans heran, als sie auf Distanz zu halten.« Doch auch diese Empfehlung ist, wie das »Show, don’t tell!«, lediglich in vielen Fällen gültig, aber längst nicht in allen.
Beispiel:
Ich schwitzte.
Hier erzählt uns der Ich-Erzähler, dass er schwitzt …
Schweiß brach mir aus allen Poren und tränkte mein T-Shirt, ein Tropfen lief mir, unangenehm kitzelnd, über die Stirn.
… und hier zeigt er es uns. Wir sind näher bei ihm. Der erste Satz transportiert die Information des Schwitzens zu den Lesern, während der zweite Satz die Leser in den Charakter transportiert.
Ähnliches gilt für Emotionen:
Tom fühlte sich so nervös wie seit seiner mündlichen Master-Prüfung nicht mehr.
… ist ein Erzählen.
Tom wurde der Kragen zu eng, seine Hände kribbelten und seine Beine wollten in vier Richtungen zugleich losrennen.
… nimmt die Leser mit hinein in Tom und zeigt seine Nervosität.
Die Filmtechnik, von der Sie sich oben haben inspirieren lassen, hilft uns, im Zusammenhang mit Nähe und Distanz, bei der Beurteilung von Zeigen und Erzählen. Stellen Sie sich vor, wie Sie Tom mit der Kamera zu den Lesern heranzoomen. Sie beginnen aus großer Entfernung mit einer Supertotalen und zeigen das Viertel in Berlin, wo Tom wohnt, aus der Vogelperspektive. Dann nähern Sie sich ihm mit einer Totalen, nehmen Tom dabei ganz ins Bild, wie er in seinem Wohnzimmer sitzt und auf dem Smartphone herumwischt. In der Halbtotalen (und auch im etwas näheren Full-Shot) verschwindet der Rest des Wohnzimmers aus dem Blick der Leser, sie sehen nur noch Tom.
Jetzt lassen Sie die Totaleinstellungen hinter sich und fahren näher an Tom heran, zeigen ihn erst im Medium-Shot, dann halbnah vom Kopf bis zur Hüfte. Anschließend bewegen Sie sich über die Nahaufnahme zur Großaufnahme, auf der gerade noch sein Kopf und ein Teil der Schultern zu sehen ist. Ist das Zeigen oder Erzählen? In diesem Stadium macht das keinen Unterschied mehr.
Der Unterschied kommt erst zum Tragen, wenn Sie mit Ihrer speziellen Autorenkamera in Tom hineinzoomen. Zunächst erreichen Sie die äußere Schicht seiner Gedanken und Gefühle, die Erzählschicht. Gehen Sie noch tiefer, kommen Sie zur inneren, der Zeigeschicht. Dort erleben die Leser mit, was Tom denkt und fühlt.
Toms Gedanken zeigen können Sie tatsächlich: mit dem Bewusstseins- oder Gedankenstrom (Stream of Consciousness). Diese Technik rückt die Leser maximal nahe an Ihren POV-Charakter. Zu große Nähe aber wird irgendwann sinnlos. Statt den Lesern ein intensiveres Erlebnis zu bescheren, was ja der Zweck Ihrer Annäherung an Tom ist, verwirrt die Hypernähe. Den Lesern Toms Synapsen zu zeigen, bringt ihnen Tom nicht näher.
Finden Sie jedoch das rechte Maß, so sind Gedanken und Gefühle mit die stärksten Instrumente, mit denen Sie Leser an Ihre Figuren heranholen. Wann immer Sie die Leser an deren Innenleben teilhaben lassen, erzählen Sie von innen nach außen: Das Innenleben bestimmt, wie die Umwelt wahrgenommen und erlebt wird.
Der Roman ist dem Film darin weit überlegen. Diese Stärke des Mediums – Ihres Mediums – sollten Sie nutzen, wann immer es Ihr Roman und die gewählten Perspektiven zulassen. Nur weil die Romane in den letzten Jahrzehnten viele Stärken und Instrumente des filmischen Erzählens übernommen haben, müssen Sie nicht das aufgeben, was Romane besser können.
Nehmen Sie »Raum« (Buch 2010, Film 2015) von Emma Donoghue. Darin wird die Welt aus der Sicht eines kleinen Jungen beschrieben. Diese ganze Welt ist der Raum, in dem man seine Mutter eingesperrt hat. Er wurde dort geboren und hat nie etwas anderes gesehen.
Die Erzählperspektive eines Fünfjährigen und seine massiv eingeschränkte Sicht kann nicht auf gangbare Weise ins Filmische übertragen werden. Im Film sehen wir den Jungen von außen und wir erkennen den Himmel als solchen, wenn wir ihn sehen, auch wenn der Junge das nicht tut. Mehr noch: Mit der Kamera ist ein weiterer Beobachter und damit auch der Zuschauer mit im »Raum«, was die Dynamik komplett verändert – ähnlich wie es im Buch ein sichtbarer auktorialer Erzähler getan hätte.
Die personalen Erzählperspektiven scheinen besser geeignet für das Heranholen der Leser an die Romanfiguren. Aus dieser Idee aber wird erst umgekehrt ein Schuh: Die personalen Perspektiven werden häufiger für ein nahes Erzählen genutzt – intuitiv. Insbesondere die Ich-Perspektive tut sich hervor.
»…
Als sie mich darum bat, war ich sofort für sie da. Mir gefiel die Vorstellung, meine Wohnung mit ihr zu teilen, und ich wusste, dass es ihr helfen würde. Meine Rolle als guter Freund, als netter Kerl, gefällt mir. Ich bin mein ganzes Leben lang der nette Junge von nebenan gewesen, und damit fühle ich mich am wohlsten. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Erst vor Kurzem ist mir klar geworden, dass ich mir sogar große Mühe gebe, Situationen zu vermeiden, in denen ich im Mittelpunkt stehen könnte. Ich bin dafür bekannt, die Nebenrolle zu spielen, den hilfsbereiten Kumpel oder Freund – und das ist völlig okay für mich. Als in Michigan alles den Bach runterging, habe ich meinen Kummer mit mir selbst ausgemacht. Ich wollte nicht, dass jemand mit mir litt, vor allem nicht Dakota.
Ihr Schmerz war unvermeidlich, und egal, was ich tat, ich konnte ihn ihr nicht abnehmen. Tatenlos musste ich mit ansehen, wie sie litt, als ihr Leben von einer Tragödie in Stücke gerissen wurde, die ich verzweifelt zu verhindern versuchte. Sie war mein Verband, ich war ihr Sicherheitsnetz. Ich fing sie auf, wenn sie stolperte, und dieser Schmerz, den wir gemeinsam durchlebt haben, wird uns immer miteinander verbinden, bis ans Ende der Zeit. Egal, ob wir nun Freunde sind oder mehr.
…«
(Anna Todd, »Nothing more«, Heyne 2016)
Zwar ist personales Erzählen meist näher, auktoriales meist distanzierter. Doch ein auktorialer Erzähler kann die Leser mal näher zu den Charakteren lassen, mal auf Distanz bleiben (wie wir es eingangs beim Vergleich Tolstoi und Mann gesehen haben) oder sich ganz unsichtbar machen.
Umgekehrt ist auch ein personaler Erzähler durchaus flexibel in seiner Distanz. Denken Sie an einen Ich-Erzähler, der über etwas berichtet, was er selbst nur gehört hat oder was ihn nicht weiter interessiert. Denken Sie an einen Erzähler, der die Leser nicht an sich heranlässt, weil er seine Gedanken und Gefühle für sich behält.
Irgendwann verschwimmen die Grenzen zwischen personalem und auktorialem Erzählen. Dazu später noch mehr.
Die größte Nähe erreichen Sie mit einem Ich-Erzähler, die größte Distanz mit einem allwissenden, objektiven und unsichtbaren Erzähler. Zumindest grundsätzlich. Entscheidend ist, was Sie aus der Perspektive machen und welche anderen Nähe-Distanz-Faktoren Sie einsetzen.
Innerhalb der personalen Perspektiven ist der Ich-Erzähler nicht automatisch Garant für maximale Nähe. Ein Erzähler in der dritten Person kann den Lesern näherkommen, etwa wenn der Ich-Erzähler auf die Leser unsympathisch wirkt oder sie mit einer schwer zugänglichen Sprache oder Wortwahl auf Distanz hält.
Das heißt: Einfach einen Ich-Erzähler zu beschäftigen und dann auf größtmögliche Nähe zum Leser zu hoffen, funktioniert nicht. Sicher kennen Sie Ich-Erzähler aus eigener Lese-Erfahrung, mit denen Sie nicht warm geworden sind – und entsprechend drittpersonales (und auktoriales) Erzählen, das Sie zu Tränen gerührt hat.
Der grundsätzliche Nähe-Vorteil der personalen Perspektiven resultiert nicht zuletzt aus ihrer Nähe zum Zeigen (statt zum Erzählen): Die Instanz eines Erzählers fällt eher weg, sodass die Leser die Ereignisse direkt und szenisch miterleben, statt sie nur berichtet zu bekommen und aus zweiter Hand zu erfahren.
Nähe erzeugen Sie zudem, wenn Ihr personaler Erzähler Gedanken, Gefühle, Informationen an den Stellen erzählt, an denen sie tatsächlich, natürlicherweise oder logischerweise vorkommen. Das Gleiche gilt für Ereignisse und Handlungen. Selbst Nuancen machen einen Unterschied. Was meinen wir damit?
»…
Nachdem Max das Haupthaus verlassen hatte, ging Sofie langsam von Zimmer zu Zimmer. Jeder Schritt weckte Erinnerungen. Die Inventarliste in ihrer Hand half ihr, nicht vollständig in der Vergangenheit zu versinken. Sie setzte ein Häkchen unter das andere und stellte zufrieden fest: Nichts fehlte.
…«
(Charlotte Jacobi, »Sehnsucht nach der Villa am Elbstrand«, Piper 2019)
Nach dem Satz »Jeder Schritt weckte Erinnerungen« wäre eine natürliche Stelle, die geweckten Erinnerungen zu benennen. Dass es nicht geschieht, hält die Leser auf Abstand. In diesem Moment wissen sie nicht, woran sich POV-Charakter Sofie erinnert, was sie denkt.
»…
Plötzlich hatte sie das Gefühl, nicht allein im Salon zu sein. Sie wurde beobachtet. Jemand war hier! Sofie erschauderte, als dieses Gefühl durch ein Knarzen auf dem Holzboden hinter ihr bestätigt wurde. Sie fuhr herum.
»Ist da wer?«, rief sie. »Max?«
Als keine Antwort kam, flog ihr Blick zur Remise hinüber, wo sie durch das erleuchtete Dachfenster ihren Mann erkennen konnte. Das bedeutete zweierlei: Er konnte es nicht sein, der sich mit ihr im Raum befand. Und er war außer Rufweite, würde ihr nicht helfen können.
Sie griff nach dem Schürhaken am Kamin.
…«
(Charlotte Jacobi, »Sehnsucht nach der Villa am Elbstrand«, Piper 2019)
Auch die natürliche Abfolge von Gedanken oder Handlungen sorgt, sofern eingehalten, für größere Nähe. Das geschieht oben in den ersten Sätzen: Das Gefühl, nicht allein zu sein, kommt als Erstes. Danach, ganz natürlich, die Folgerung: Sie wird beobachtet, dann die natürliche Folgerung daraus: Jemand ist bei ihr im Raum. Damit nimmt das Autorenduo Charlotte Jacobi die Leser nahe an Sofie heran.
Das ist weniger banal, als es zunächst erscheint. Sehen wir mal davon ab, dass leider nicht jeder Autor mit einem Sinn für Logik gesegnet ist[Fußnote 18], so kann bei Ergänzungen und vor allem bei der Überarbeitung solcher Abfolgen leicht etwas unter den Tisch fallen oder durcheinandergeraten.
Im Beispiel folgen, nach Sofies vergeblichen Rufen, sehr viele vernünftige Erwägungen. Vielleicht zu viele. Obwohl die logische und natürliche Reihenfolge beibehalten wird – die Folgerungen sind schlüssig –, wirken die Gedanken auf manchen Leser möglicherweise zu sehr vernunftgesteuert, dauert es zu lange, bis Sofie zum Schürhaken greift. Grundkenntnisse in Wahrnehmungspsychologie helfen mit, solche Szenen den Lesern so nahe wie möglich zu bringen, Gefühle sind schneller als rationale Gedanken.
Urteilen Sie selbst: Wirkt die originale Szene oben näher oder die gekürzte unten?
Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass sie beobachtet wurde. Jemand war hier! Sofie erschauderte. Ein Knarzen auf dem Holzboden hinter ihr bestätigte das Gefühl. Sie fuhr herum.
»Ist da wer?«, rief sie. »Max?«
Keine Antwort. Ihr Blick flog zur Remise, wo ihr Mann an seinem Landauer werkelte. Außer Rufweite. Er konnte ihr nicht helfen.
Sie griff nach dem Schürhaken am Kamin.
Gerade in handlungsreichen, flotten Szenen hält umständliche Prosa mit überflüssigen Wiederholungen die Leser auf Abstand. Für die Leser fühlt es sich an, als müssten sie sich erst durch die Sätze kämpfen, bevor sie in die Situation hineindürfen.
Wieso aber funktioniert eine Dehnung der Zeit so gut, wenn Sie in einer Szene wie oben Spannung erzeugen möchten? Das klappt, sofern der Text möglichst konkret bleibt, natürliche/logische Abfolgen einhält, auf Redundanzen verzichtet und sich reibungslos liest.
Dass Ihnen mit einem personalen Erzähler Nähe leichter und natürlicher gelingt, liegt auch daran, dass ein solcher Erzähler zuvörderst eine Person Ihres Roman-Ensembles ist und erst danach ein Erzähler[Fußnote 19]. Möchten Sie die Leser eng bei diesem Charakter halten, so stellen Sie dieses Personale immer wieder klar heraus.
Eine von unzähligen Möglichkeiten dazu zeigt uns Stefan Kiesbye mit einer Stelle, die wir schon kennengelernt haben:
»…
Das Gebäude war größer als unsere Schule, größer noch als unsere Kirche, und die Ziegel waren gelb gestrichen. Und ganz so, als ob wir hohe Herren wären, wurden wir zum Vordereingang hinaufgefahren. Der Fahrer stieg aus und öffnete uns die Türen.
An der Treppe wurden wir von einer alten Frau in einer Dienstmädchenuniform begrüßt, die uns versicherte, dass unsere Gastgeber sich bald zu uns gesellen würden. Sie führte uns die Stufen zum Eingang hinauf, dessen Flügeltüren höher als das Haus meiner Eltern schienen. Von der Eingangshalle geleitete sie uns in einen Raum, der wohl als Wartezimmer diente. Meine drei Brüder hätten einander auf die Schultern klettern können, ohne die Decke zu berühren, und das Zimmer war vier- oder fünfmal so groß wie die gute Stube meiner Eltern.
…«
(Stefan Kiesbye, »Hemmersmoor«, Tropen 2011)
An mehreren Stellen bezieht Kiesbyes personaler Erzähler das Beschriebene auf sich und das, was er kennt: »größer als unsere Schule, größer noch als unsere Kirche«, »Flügeltüren höher als das Haus meiner Eltern«, »Meine drei Brüder hätten einander auf die Schultern klettern können, ohne die Decke zu berühren, und das Zimmer war vier- oder fünfmal so groß wie die gute Stube meiner Eltern.«
Diese Sicht ist so persönlich, dass sie die Leser näher an den Text heranholt und das Gesagte glaubhafter macht.
Ein Mittel zum Variieren der Distanz ist die Erzählzeit, das Tempus. Je aktueller die geschilderten Ereignisse sind, sprich: je näher am Präsens sie erzählt werden, desto näher sind ihnen die Leser.
Das Präsens ist das Tempus, mit dem sich grundsätzlich die größte Nähe, weil größte Unmittelbarkeit, dar- und herstellen lässt. Der Erzähler berichtet, was er just im Augenblick erlebt oder was gerade im Roman vor sich geht. Siehe das Beispiel oben aus Anna Todds Roman. Oder dieses hier:
»…
Auf einmal höre ich hinter mir ein zittriges Einatmen und merke, dass ich nicht allein bin. Ich drehe mich um. Ich sehe nackte Haut und dunkles, graugesprenkeltes Haar. Ein Mann. Sein linker Arm liegt auf der Decke, und am Ringfinger der Hand steckt ein goldener Ring. Ich unterdrücke ein Stöhnen. Der Typ ist also nicht nur alt und grau, denke ich, sondern auch noch verheiratet. Ich habe nicht nur mit einem verheirateten Mann gevögelt, sondern vermutlich noch dazu bei ihm zu Hause, in dem Bett, das er normalerweise mit seiner Frau teilt. Ich sinke zurück, um mich zu sammeln. Ich sollte mich schämen.
Ich frage mich, wo die Ehefrau ist. Muss ich befürchten, dass sie jeden Augenblick hereingeschneit kommt? Ich stelle mir vor, wie sie am anderen Ende des Zimmers steht, kreischt, mich als Schlampe beschimpft. Eine Medusa. Ein Schlangenhaupt. Ich überlege, wie ich mich verteidigen soll, falls sie tatsächlich auftaucht, und ob ich dazu überhaupt imstande bin. Der Typ im Bett wirkt jedoch völlig unbesorgt. Er hat sich auf die andere Seite gerollt und schnarcht weiter.
Ich versuche, ganz still zu liegen. Normalerweise kann ich mich erinnern, wie ich in eine derartige Situation geraten bin, aber heute nicht. Ich muss auf einer Party gewesen sein, in einer Bar oder einem Club. Ich muss ganz schön betrunken gewesen sein. So betrunken, dass ich mich an gar nichts erinnere.
…«
(S. J. Watson, »Ich. Darf. Nicht. Schlafen.«, Scherz 2011)
Der Text zieht die Leser sofort hinein, eine Distanz zwischen ihnen und der Erzählerin scheint nicht zu bestehen – die Kombination der Ich-Perspektive mit dem Präsens sorgt dafür. Je weiter Sie sich vom Präsens entfernen, desto distanzierter wirkt der Text auf die Leser. Grundsätzlich, aber längst nicht immer. Vergleichen Sie:
Lordie zieht ihre Pistole und legt in aller Ruhe an, während um sie die Geschosse einschlagen.
Lordie zog ihre Pistole und legte in aller Ruhe an, während um sie die Geschosse einschlugen.
Welches der Beispiele wirkt auf Sie näher, unmittelbarer? Ohne Kontext (!) wahrscheinlich der Text im Präsens.
Doch auch Rückblenden einer schon im Präteritum erzählten Geschichte entfernen die Leser weiter vom Geschehen. Vergleichen Sie:
Lordie zog ihre Pistole und legte in aller Ruhe an, während um sie die Geschosse einschlugen.
Lordie hatte ihre Pistole gezogen und in aller Ruhe angelegt, während um sie die Geschosse eingeschlagen waren.
Das Entsprechende gilt für Texte im Futur I oder Futur II. Dafür verantwortlich dürfte jedoch nicht allein die Erzählzeit an sich sein, sondern die umständliche Konstruktion über Hilfsverben, die ein Tempus wie das Plusquamperfekt oder das Futur II erfordert.
Distanzierend wirkt zumal ein unklarer Umgang mit der Erzählzeit, also wenn die Leser den Überblick verlieren, ob sie gerade gegenwärtigen, vergangenen oder vorvergangenen Ereignissen beiwohnen.
Faustregel
Das Einfache ist dem Leser näher als das Komplizierte.
Wie nahe ein Text von den Lesern empfunden wird, hängt darüber hinaus von der Gängigkeit des Tempus ab, etwa dem, was im Genre üblich ist. Auch Gewöhnung und Vorlieben spielen eine Rolle. Leser, die mit im Präteritum erzählten Geschichten aufgewachsen sind, kommen bei diesem Tempus womöglich näher an die Charaktere als bei dem für sie unvertrauten Präsens, das die aktuelle Jugend- und Young-Adult-Literatur zu beherrschen scheint.
Literaturagent und Schreibguru Donald Maass nennt das den »immersiven POV« und erkennt einen Trend[Fußnote 20], zunehmend dichter am Charakter zu erzählen. Dazu gehöre mehr als Nähe, vielmehr werde das Verwischen der Grenzen zwischen Erzähler/POV-Charakter und Leser angestrebt – die totale Versenkung.
Das Intime daran sollte nie Selbstzweck sein. Wie alles im Roman hat es eine Aufgabe zu erfüllen: Vertiefung des Charakters, Fortführung der Story, Suspense, das Streuen falscher Fährten, Vorausdeutungen und, und, und.
Manchmal kann es zielführend sein, die Leser zu überwältigen: mit massiven Eindrücken, innersten Gedanken und intimsten Gefühlen – ein probates Stilmittel. Der Roman aber ist es ja gar nicht, der den Lesern ihre intensiven Erlebnisse beim Lesen verschafft. Sondern sie selbst und das, was sie aus dem Roman für sich herausziehen, die Beziehung, in die sie sich – dank Ihrer fachkundigen Hilfe – zum Gelesenen setzen.
Faustregel
Das Präsens an sich stellt keine Nähe her. Aber es ist ein wirkungsvolles Mittel dazu.
Entsprechend distanzieren Sie die Leser, wann immer Sie aus der Erzählzeit herausfallen. Etwa über einen Vorgriff, den die gewählte Perspektive nicht gestattet:
»…
Amelia Sachs wusste, sie würde sterben.
…«
(Jeffery Deaver, »Der Todbringer«, Blanvalet 2019)
Dies verdeutlicht, dass Sie beim Schreiben Vorteile selten geschenkt bekommen, sondern sie mit Nachteilen an anderer Stelle bezahlen. Im Beispiel sorgt der Vorgriff zwar für mehr Suspense, dafür büßt die Handlung an Unmittelbarkeit und Nähe ein.
Auch der Stil, wie überhaupt jedes sprachliche und rhetorische Mittel, wirkt sich auf Nähe und Distanz aus.[Fußnote 21] Denken Sie insbesondere bei etwas ausgefalleneren Stil- oder Sprachmitteln daran.
Je näher das von Ihrem Erzähler verwendete Vokabular dem Vokabular des Protagonisten kommt, desto näher kommen die Leser diesem Protagonisten.
Distanz variieren Sie auch mit diesen sprachlichen Maßnahmen:
• Manierismen (Beispiel: POV-Charakter beginnt viele Sätze mit »Ich weiß ja«)
• dauerhafte Fehler (Beispiel: POV-Charakter benutzt ein Fremdwort stets falsch)
• auffällige Lieblingswörter
Warum näher? Der Charakter wirkt authentischer, lebensechter, trennschärfer.
Warum distanzierter? Der Charakter wirkt unsympathischer (etwa wenn er dauernd vulgär flucht oder hochgestochene Wörter verwendet).
Dementsprechend sorgen emotionale Wörter für mehr Nähe als eine sachliche Sprache. Es sei denn, der Charakter würde genau diese sachliche Sprache selbst verwenden.
Grundsätzlich schafft eine aktive Sprache mehr Nähe, während eine passive Sprache die Leser von der Story und ihren Charakteren distanziert.
Eine aktive Sprache zieht den aktiven Fall dem passiven vor, sie zeichnet sich durch dynamische, kraftvolle und spezifische Verben aus, überhaupt durch die Bevorzugung von Verben (Tu-Wörtern!) gegenüber Adjektiven (Zustandswörtern). Wenn Sie schon Adjektive verwenden, dann die treffenden und besonderen, während Sie Adverbien am besten nur punktuell einsetzen.
Spezifische Substantive sind nicht allein beim Erzeugen von Nähe der Kombination Adjektiv + unspezifisches Substantiv überlegen. So sorgt nicht nur bei Sportwagenfans das Substantiv »Ferrari« für mehr Emotionen und holt die Leser näher heran als das Wort »schnelles Auto«, eine »Pochette« schlägt das »modische Accessoire«, der »Rioja« den »spanischen Rotwein«.
Vergleichen Sie die folgenden Versionen des gleichen Romananfangs im Hinblick darauf, wie nahe sie die Leser heranholen:
»…
Die Pferde gingen langsam zum Tal hinunter. In den Schwaden grauen Regens wurden die Tiere unter ihrer Last geschaukelt. An ihrer Spitze ging eine große Gestalt, als wollte sie die Pferde von dem dunklen Dorf weiter oben fortziehen. Ein Mann, der neben der Holzbrücke unten im Tal stand, schaute unter seinem Hut hervor und verzog das Gesicht.
Wasser sickerte durch die Stiefel des Ersteren. Der Regen durchweichte seine Kleidung. Zu seinen Füßen befand sich die Fracht, zu dessen Ablieferung man ihn verpflichtet hatte. Eine ganze Weile schon war er unterwegs. Vorhin hatte sich noch die ganze Landschaft unter ihm befunden. Und dann hatte er die Pferde gesehen.
…«
»…
Die Packpferde stapften langsam zum Tal hinunter. In den Schwaden grauen Nieselregens schaukelten die Tiere unter der Last von Kisten und Säcken. An ihrer Spitze kämpfte eine große Gestalt gegen den Regen an, als wollte sie die Pferde von dem dunklen Dorf weiter oben fortziehen. Ein junger Mann mit schmalem Gesicht, der neben der Holzbrücke unten im Tal stand, spähte unter seiner tropfnassen Hutkrempe hervor und rang sich ein Grinsen ab.
Wasser sickerte durch die Nähte von Benjamin Martins Stiefeln. Der Regen durchweichte seinen Umhang. In dem Bündel zu seinen Füßen befand sich die Fracht, die im Gutshaus abzuliefern er sich verpflichtet hatte. Seit fast einer Woche war er unterwegs. An diesem Morgen hatte noch das ganze Tal vor seinen wundgelaufenen Füßen gelegen. Und dann hatte er die Packpferde entdeckt.
…«
(Lawrence Norfolk, »Das Festmahl des John Saturnall«, Knaus 2012)
»…
Die Packpferde stapften zum Tal hinunter. In den Schwaden des Nieselregens schaukelten die Tiere unter der Last von Kisten und vollgesogenen Säcken. An ihrer Spitze kämpfte ein Bär von einem Mann gegen den Regen an, als wollte er die Pferde von dem unheilvollen Dorf oben fortziehen. Ein Jüngling mit schmalen Zügen, der neben der Holzbrücke unten im Tal wartete, spähte unter seiner tropfnassen Hutkrempe hervor und rang sich ein Grinsen ab.
Wasser sickerte durch die Nähte von Benjamin Martins Stiefeln. Der Regen durchweichte seinen Wollumhang. In dem Bündel zu seinen Füßen verbarg sich die Fracht. Er hatte sich verpflichtet, sie im Gutshaus abzuliefern. Seit einer Woche quälte er sich über schlammige Wege, umging unpassierbare Furten und träumte von trockenem Unterzeug und einem prasselnden Feuer im Kamin. An diesem Morgen hatte sich noch das ganze Tal vor seinen wundgelaufenen Füßen erstreckt. Und dann, zu seinem Entsetzen, hatte er die Packpferde entdeckt.
…«
So beginnt Lawrence Norfolks historischer Roman, hier in unterschiedlich aktiver Sprache. Spüren Sie, wie Sie der Szene als Leser mit jedem Mal, mit jeder Steigerung in der Aktivität, näherkommen? Die mittlere Variante ist die Übersetzung des Verlags. Sie ist keiner der anderen überlegen oder unterlegen. Entscheidend ist, dass Sie in Ihrem Text mit dem Justieren von Nähe und Distanz das erreichen, was Sie erreichen wollen.
Distanz hat den Vorteil, dass Sie leichter zwischen Erzähl- oder Handlungssträngen wechseln können, ohne die Leser aus dem Fluss des Geschehens zu reißen. Stellen Sie sich das vor wie einen Staffellauf – die Übergabe des Staffelstabs im Laufen und von Hand zu Hand fällt leichter und erfolgt in einem natürlichen Schwung von Läufer zu Läufer. Doch wenn die Athleten den Stab jedes Mal einbuddeln würden und die nächsten den Stab ausbuddeln müssten, käme der Fluss gewaltig ins Stocken.
Ein weiterer Zweck distanzierten Erzählens kann es sein, Ihrem Text den Anschein von mehr Objektivität zu verleihen. Etwa wenn Sie ein Geschehen so beschreiben wollen, als wäre es ein offizieller, also automatisch wahrer und nicht-tendenziöser Bericht. Insbesondere phantastischen oder schwer fassbaren Geschehnissen verleihen Sie damit die notwendige Glaubwürdigkeit. Ironischerweise sorgt dann das Reportagehafte dafür, dass die Leser dem Geschilderten gegenüber eben nicht neutral bleiben. Stattdessen löst ausgerechnet die empfundene Objektivität und Wahrheit die Emotionen aus.
»…
Die zwei Erzieherinnen erreichten die Stadt am Nachmittag des 25. Juni 2007. Sie kamen mit dem Regionalzug aus Brescia, der um Punkt 17.45 Uhr in den Bahnhof von Bergamo einfuhr.
Später gab es Leute, die behaupteten, ihnen seien die beiden Frauen von Anfang an nicht geheuer gewesen. Altersmäßig trennten sie Jahre, siebenundzwanzig die Jüngere, eben erst geworden, fünfzig die Ältere, und obwohl sie nicht miteinander verwandt waren, nahmen sie sich zusammen eine Wohnung, noch dazu in einem ziemlich verrufenen Viertel.
(…)
Später, als die Anwesenheit der Erzieherinnen schon genug Aufsehen in der Stadt erregt hatte, fand sich eine zweite Zeugin, die Signora Lorenzis Version bestätigen konnte, ja, die sogar willens war, noch eins draufzusetzen.
(…)
Beide Zeugenaussagen können, auch wenn sie in etlichen Punkten übereinstimmen und vermutlich in gutem Glauben abgelegt wurden, als unwahr betrachtet werden.
…«
(Antonio Scurati, »Das Kind, das vom Ende der Welt träumte«, Rowohlt 2010)
Der nüchterne Tonfall wird unter anderem dadurch erreicht, dass (für den Plot unnötig) genaue Orts- und Zeitangaben gemacht werden, zudem findet sich kein Erzähler, also kein Verantwortlicher – typisch für offizielle Dokumente von Beamten.
Zahlen sind objektive Angaben und halten die Leser tendenziell mehr auf Distanz. Ein Ich-Erzähler, der die Leser nahe heranholen will, würde also bei der Beschreibung einer neuen Figur nicht schreiben »Sie war einsdreiundsiebzig«, sondern »Sie war so groß, dass ich zum Medaillon an ihrem Hals sprach wie in ein Mikrofon«.
Faustregel
Relationen zum Erzähler sind nah, Absolutes ist fern.
Je konkreter die Relation, desto näher: »Sie war größer als ich« ist distanzierter als der Satz mit dem Medaillon.
Eine Erzählerin, die von einer »nahen Verwandten der Heldin« spricht, hält die Leser auf mehr Abstand, als wenn sie schriebe: »die Mutter der Heldin«. Auch hier wächst die Nähe mit dem Grad an Konkretheit: »Mutter« ist näher als »Verwandte«, »Verwandte« ist näher als »Frau«, »Frau« ist näher als »Mensch«.
Besonders konkret sind sehr spezifische Dinge, die in den Lesern etwas auslösen, am besten eine körperliche Reaktion, etwa der Satz »Henriette presste die Zitrone direkt auf ihrer Zunge aus, jeder Tropfen eine süßsaure Explosion, die ihr die Tränen in die Augen trieb«. Szenen und alles Dynamische sorgen in den Lesern eher für innere Bilder: »Lou rannte, seine Ledersohlen klatschten auf den Asphalt« ist dynamischer als »Bella saß auf dem Sofa«.
Faustregel
Konkretes ist nah, Abstraktes ist fern.
Sie sehen, auch beim distanzierten Erzählen kommt es auf Nuancen an. Weniger gut nämlich funktioniert das Reportagehafte dann, wenn Sie es nicht konsequent betreiben und den Reportage-Stil mit Emotionen oder gar Melodrama aufpeppen wollen. Wie das Marc Ritter tut:
»…
Eine Viertelstunde später war die Nachricht durch die schier endlose Schlange der Wartenden gedrungen und kam auch auf dem Platt im SonnAlpin an. Daraufhin wussten die Menschen, dass es eine lange Zeit dauern würde, bis sie wieder vom Berg hinunterkämen. Allen war bekannt, dass der Tunnel der Zahnradbahn eingebrochen war, und nun war auch die österreichische Seilbahn zerstört worden. Vergeblich versuchten die Wartenden, über ihre Handys und Smartphones weitere Informationen zu erhalten. (…)
Wellen der Angst schwappten durch die Menge. Was würden die Terroristen als Nächstes tun?
…«
(Marc Ritter, »Kreuzzug«, Droemer-Knaur 2014)
Durch emotionale Einsprengsel wie »die schier endlose Schlange der Wartenden« oder »Wellen der Angst« gibt der Text ausgerechnet das auf, was ihn (besser) funktionieren lassen würde. Das Reportagehafte wird so immer wieder vom Autor selbst unterwandert und ein Satz wie »Wellen der Angst schwappten durch die Menge« wirkt dann lediglich behauptet. Mit der Folge, dass gerade diese auf Emotionen zielenden Teile dafür sorgen, dass die Leser nichts empfinden.
(Unberührt bleibt hier, dass dieser Mix aus Fakten und Emotionen womöglich modernem Reportagestil entspricht. Sie sehen: Auch hier gibt es kein absolutes Richtig oder Falsch.)
Erschwerend kommt hinzu, dass weite Teile des Romans von Ritter aus einer (gewollt, aber nicht realisiert) näheren personalen Perspektive geschildert werden als der Auszug oben. Ein solches Hin und Her zwischen nahe und distanziert gehen viele Leser nicht mit, sodass ihnen der Text mal als zu nüchtern, mal als zu emotional erscheint – und beides als künstlich. Im Ergebnis siegt bei Durcheinander und häufigen Distanzwechseln immer die Distanz.
Die indirekte Rede des Konjunktiv I fungiert ebenfalls als Distanzierungsmittel, indem sie die Leser über eine Instanz von der Geschichte wegrückt. Die erzählten Ereignisse werden nur indirekt erlebt. Ihr Wahrheitsgehalt hängt davon ab, als wie vertrauenswürdig und zuverlässig der Erzähler eingestuft wird.
»…
An dieser Stelle nun gebe es in seinen Ausführungen eine kleine Lücke. Er, Kron, könne sich nämlich an keine Einzelheiten des gemeinsamen Weges zum Parkhaus erinnern, woraus er jedoch schließe, dass dieser ereignislos verlaufen sei. Woran er sich hingegen wieder ganz genau erinnere, sei die Uhrzeit, die der Automat beim Einschieben seines Parkscheins angezeigt habe. 16 Uhr 53 habe dort in grünen Leuchtziffern gestanden, auch dies ein Beleg dafür, dass man den Weg vom Krokodil zum Parkhaus zügig zurückgelegt habe. Gemeinsam sei man nun aufs erste Oberdeck gegangen, wo er nach einigem Suchen seinen Wagen in der hinteren rechten Ecke gefunden habe. Auf dem Weg dorthin habe sich allerdings ein Zwischenfall ereignet. Man könne gewiss unterschiedliche Formulierungen dafür finden, aber im Grunde genommen laufe es wohl darauf hinaus: Der Mann habe fliehen wollen.
…«
(Martin Gülich, »Septemberleuchten«, Nagel & Kimche 2009)
Die indirekte Rede erzeugt deshalb Distanz, weil darin über einen Charakter gesprochen wird und nicht der Charakter selbst zu Wort kommt. Ein Erzähler schiebt sich als Instanz zwischen Leser und Charakter. Das gilt unabhängig von der Erzählperspektive, also auch bei der »nahen« Ich-Perspektive. Im direkten Vergleich wird es deutlich:
»Vom Hühnerklauen«, sagte Karin zu mir, »weißt du so wenig wie vom Pferdestehlen.«
Ich grinste.
Karin sagte, ich hätte vom Hühnerklauen so wenig Ahnung wie vom Pferdestehlen. Was ich mit einem Grinsen quittierte.
Distanz erzeugen Sie auch, wenn Sie Funktionswörter zwischen Leser und Ereignisse schieben.
»Das wird schon«, sagte Tanja und rieb sanft über Sonjas Arm.
Wenn Tanja wüsste, was ich und Ben getan haben, dachte Sonja, würde sie ihre Hand da wegreißen wie von einer heißen Herdplatte.
Zu den Übeltätern – nennen wir sie Funktionswörter[Fußnote 22], weil sie zwar eine Funktion im Text erfüllen, inhaltlich aber nicht von Belang sind – zählen etwa sagte und dachte in Begleitsätzen von Dialogen. Obwohl die Leser sie überlesen, legen sie sich wie ein Puffer zwischen Story und Leser, allein durch ihre Sichtbarkeit auf der Seite und ihre Hörbarkeit durch die innere Stimme des Lesers.
Vergleichen Sie:
»Das wird schon.« Sanft strich Tanja über Sonjas Arm.
Wenn Tanja wüsste, was ich und Ben getan haben, würde sie ihre Hand da wegreißen wie von einer heißen Herdplatte.
Der Text wird ohne die Funktionswörter zu purem, relevantem Inhalt und schmiegt sich dem Lesenden näher an.
Das gilt auch für Formatierungen.
»Das wird schon.« Sanft strich Tanja über Sonjas Arm.
Wenn Tanja wüsste, was ich und Ben getan haben, würde sie ihre Hand da wegreißen wie von einer heißen Herdplatte.
Schon der Kursivsatz lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und zieht sie vom Inhalt ab. Auch das ein, für sich genommen, kleiner Punkt, der aber umso gravierender wird, je häufiger Sie sich dieses Mittels bedienen.
Überhaupt tendieren alle vom Fließtext abweichenden Formatierungen in Romanen[Fußnote 23] dazu, die Distanz zu vergrößern. Lediglich minimalinvasive Maßnahmen, wie Kursivsetzen zur Betonung eines einzelnen Wortes, bewahren die Nähe. Doch Einklammerungen oder gar Fußnoten und Endnoten, die den Blick von der Stelle im Text wegzwingen, schieben die Leser weg von der Story.[Fußnote 24]
In humorvollen Texten wie etwa den Per-Anhalter-Romanen von Douglas Adams oder Terry Pratchetts Geschichten von der Scheibenwelt, die exzessiv Fußnoten verwenden, geschieht dies auch, jedoch zur Freude der Leser, die eher Witziges suchen als emotionale Nähe: Die Leser lachen über die Charaktere und nicht mit ihnen. (Zur Rolle des Humors als Mittel der Distanzierung gleich noch mehr.)
Ein Aspekt, an dem sich für die Leser die Nähe zum Erzähler ablesen lässt, ist die Verwendung von Namen oder Personalpronomen. Wenn Sie – aus Bettinas personaler Perspektive – schreiben »Bettina ging ins Bett«, halten Sie die Leser weiter von ihr entfernt, als wenn Sie schrieben »Sie ging ins Bett«. Denn Bettina denkt ja von sich nicht als »Bettina«, also mit Namen. Die Namensnennung verdeutlicht dem Leser, dass Erzähler und POV-Charakter eben nicht ein und derselbe sind. Die Folge: mehr Distanz zwischen Leser und Figur.
Deutlicher wird das, wenn Sie einen längeren Abschnitt nahe in der dritten Person lesen – und auf einmal taucht der Name auf, wo die ganze Zeit nur das Personalpronomen »sie« stand.
Horst Eckert beginnt seinen Roman »Der Preis des Todes« so:
»…
Sie war gekommen, um Gewissheit zu erlangen – sechseinhalbtausend Kilometer von ihrem gewohnten Leben entfernt.
Nachdem sie mehr als eine Stunde lang über nichts als Sand und Dornbüsche geflogen waren, hielt sie die Stadt beim ersten Anblick für eine Fata Morgana. Am Horizont zeichnete sie sich als großes Rechteck ab. Im Näherkommen zerfiel es in unzählige weiße Punkte – Zelte, endlose Reihen von Zelten, die in der Mittagssonne leuchteten.
Sie erkannte eine unbefestigte Straße und einen Lkw-Konvoi an der Spitze einer langen Staubfahne – er hielt auf eine zweite, noch größere Zeltansammlung zu.
Dann überflogen sie das Hauptlager.
Behelfshütten unter hellgrauen Schutzplanen bildeten eine Siedlung gewaltiger Ausdehnung und Eintönigkeit, durchzogen vom gleichmäßigen Karomuster brauner Straßen. Größere Zelte und Baracken bildeten so etwas wie Stadtteilzentren: Verwaltung, Schulen, Ladenzeilen. Ein abgetrennter Bezirk gemauerter Häuser. Und dort drüben – war das die Klinik?
Endlich zog der Pilot die Propellermaschine tiefer. Er machte eine Bemerkung, die im Lärm unterging. Das Flugzeug schreckte eine Ziegenherde auf. Unter ihnen gab es etwas Grün entlang eines Bachlaufs, der vermutlich Wasser führte, wenn es mal etwas ausgiebiger regnete. Aber wann gab es hier überhaupt Regen?
Jetzt erblickte sie Menschen. Kinder, die auf harter Erde Fußball spielten, innehielten und zu ihr hochwinkten.
…«
(Horst Eckert, »Der Preis des Todes«, Wunderlich 2018)
Kein Name. Lesen Sie den Abschnitt noch mal und tauschen Sie dabei jedes »sie« gegen »Bettina« aus. Mit dem »sie« gleiten die Leser schneller in den Kopf des Charakters. Auch die Identifikation fällt logischerweise leichter, zumindest allen Leserinnen und Lesern, die nicht Bettina heißen.[Fußnote 25]
Im Auszug aus Eckerts Roman finden wir einen weiteren Aspekt, der die Leser auf Distanz hält. Sätze wie »Sie erkannte eine unbefestigte Straße« oder »Jetzt erblickte sie Menschen« sorgen wegen ihrer Verben der Wahrnehmung für eine vergrößerte Distanz. Eckert schreibt ja auch nicht »Sie fühlte, wie der Pilot die Propellermaschine tiefer zog«. Und ebenfalls nicht »Sie sah, wie das Flugzeug eine Ziegenherde aufschreckte«. Aus gutem Grund, den er sich wohl leider nicht bewusst gemacht hat. Sind die Leser nämlich im Kopf der Figur, nehmen sie wahr, was die Figur wahrnimmt, ohne Umwege, ohne Umschweife. Die Identifikation fällt leichter, zudem liest sich der Text reibungsloser und schneller, weil Sie Wörter sparen oder Platz, den Sie für Wichtiges verwenden können.
Diesen Fehler begehen leider viele Autoren, auch sehr erfolgreiche. Für Sie eröffnet sich damit ein einfacher und effektiver Weg, Ihren Roman abzuheben. Wollen Sie Nähe herstellen, verzichten Sie aufs Erzählen (»er sah, wie …«) und schreiben Sie direkt, was Ihre POV-Charaktere wahrnehmen und empfinden.
Übrigens …
… haben Sie recht: Wie vieles bei der Arbeit mit Erzählperspektiven ist die Sache mit den Verben der Wahrnehmung und des Empfindens im Einzelfall eine Kleinigkeit. Doch Kleinigkeiten summieren sich im Lauf der Seiten auf und sorgen für mindestens den Tick zusätzliche Nähe, der Ihren Roman für die Leser von einem gelungenen zu einem intensiven Roman erhebt. Eine Autorin oder ein Autor, der die Kleinigkeiten aus dem Blick verliert, wird nie einen besonderen Roman schreiben. Denn was ist jedes einzelne Wort, wenn nicht eine Kleinigkeit?
Natürlich können Sie beim Überarbeiten und erst recht beim Schreiben nicht permanent an so etwas relativ (!) Unwichtiges denken. Aber einen Roman zu schreiben, ist nun mal eine hochkomplexe Sache mit Tausenden von Stellschrauben. Und warum etwas schlechter schreiben, wenn man es auch besser schreiben kann? Zudem sind es oft die Nuancen, die einen guten von einem herausragenden Roman unterscheiden. Einen von den Lesern vergessenen von einem heißgeliebten. Oder einen vom Verlag abgelehnten von einem angenommenen. Zu welcher Gruppe soll Ihr Roman gehören?
Solche Verben der Wahrnehmung und des Empfindens können Sie als »Erzählen statt zeigen« begreifen, also eine (für dramatische Storys meist nicht angeratene) Umkehrung der Empfehlung des »Show, don’t tell!«.
Weil es so wichtig ist und so oft falsch gemacht wird, sehen wir es uns noch mal an.
Erzählen:
Peterchen sah, wie seine Mutter mit Melkschemel und Eimer zu den Ziegen hinaufstieg.
Zeigen:
Peterchens Mutter stieg mit Melkschemel und Eimer zu den Ziegen hinauf.
In diesem Beispiel wird das besonders deutlich: Entweder sehen die Leser der Mutter beim Hinaufsteigen zu. Oder sie tun es über den Umweg von Peterchens Erzählung, er habe die Mutter hinaufsteigen sehen.
Dabei kommt es darauf an, worauf Sie die Aufmerksamkeit der Leser lenken wollen. Nur wenn das Wahrnehmen das Entscheidende ist, sollten Sie es hinschreiben.
So wird es klarer:
Peterchen sah seiner Mutter dabei zu, wie sie mit Melkschemel und Eimer zu den Ziegen hinaufstieg.
Der Fokus liegt hier eben nicht bei dem, was die Mutter tut, sondern bei dem, was Peterchen tut. In diesem Fall zeigen Sie Peterchen beim Zusehen. Das vermeintliche Erzählen ist hier tatsächlich ein Zeigen.
Zu den Wahrnehmungen gehören körperliche Empfindungen.
Distanziert mit Verb der Empfindung und dem Namen der Figur:
Das blöde Heu! Peterchen spürte ein Jucken in der Nase.
Nahe ohne Verb der Wahrnehmung und ohne Namen:
Das blöde Heu! Seine Nase juckte.
Fragen Sie sich stets: Was will ich meinen Lesern zeigen? Sollen Sie in der Figur drinsitzen und wahrnehmen, empfinden, fühlen, was sie wahrnimmt, empfindet, fühlt? Oder möchten Sie, dass sie die Figur von außen betrachten, die sinnlichen Wahrnehmungen und Gefühle also nur indirekt erkennen?
Der Hahn pickte Peterchen in den großen Zeh. Wütend warf Peterchen ihm die ganze Handvoll Körner über.
Hier erzählen Sie den Lesern von Peterchens Gefühlen: seiner Wut auf den ungezogenen Hahn.
Der Hahn pickte Peterchen in den großen Zeh. Peterchen schrie auf und schmiss dem Mistvieh die ganze Handvoll Körner über.
Hier zeigen Sie den Lesern Peterchens Wut. Sein Aufschrei und die Wortwahl – »Mistvieh« – nehmen die Leser mit hinein in Peterchens Gefühlswelt. Damit präsentieren Sie seine Gefühle direkter und holen die Leser näher an Peterchen heran.
Wenn Sie Zeigen und Erzählen unter dem Aspekt Nähe und Distanz betrachten, erkennen Sie auch, dass das eine nicht per se besser ist als das andere: Das Zeigen ist in den meisten Fällen ein Mittel zur Herstellung größerer Nähe zwischen Leser und Figur. Das Erzählen hingegen können Sie wählen, um bewusst größere Distanz herzustellen.
Je näher Sie die Leser an den Charakter heranholen, desto störender wirken Erklärungen oder allgemein Informationen, die dem Charakter bekannt sind, die Sie also in erster Linie für die Leser schreiben und die damit außerhalb der Story liegen.
Das können offensichtliche Dinge sein, etwa hier:
Karin, meine dreiundsiebzigjährige Mutter, hatte nicht geahnt, dass wir sie an diesem Tag noch sehen würden.
Die Protagonistin, in dessen Perspektive die Leser hier stecken, weiß natürlich, wer Karin ist, und kennt selbstverständlich auch ihr Alter.
Weniger offensichtlich hier in diesem Ausschnitt:
»…
Marieka seufzt leise, sie scheint nicht sehr überzeugt, aber von meinem Platz aus kann ich ihr Gesicht nicht sehen. Was ist mit Mila?, sagt sie.
Ein paar Dinge weiß ich: Es sind Osterferien, ich muss nicht in die Schule. Meine Mutter arbeitet die ganze Woche in Holland, und allein kann ich nicht zu Hause bleiben. Mein Vater lebt in seiner eigenen Welt, darum ist es besser für ihn, wenn er beim Reisen jemanden bei sich hat, der auf ihn aufpasst. Die Flugtickets wurden schon vor zwei Monaten gekauft.
Wir werden also beide fahren.
…«
(Meg Rosoff, »Was weiß ich von dir«, Fischer KJB 2014)
Alles, was der Ich-Erzähler hier unter »Ein paar Dinge weiß ich« fasst, sind streng genommen Erklärungen für die Leser. Der Ich-Erzähler weiß das ja alles, würde also bei einem sehr nahen POV nicht auf diese Weise und mit diesen Worten daran denken.
Schon der unverdächtige Satz »von meinem Platz aus kann ich ihr Gesicht nicht sehen« ist eine Erklärung (samt der Instanz des Sehens), die den Lesern gegeben wird, gegeben werden muss, weil die Leser dem Ich-Erzähler eben nicht sehr nahe sind.
Dichter dran wäre etwa diese abgewandelte Fassung:
Marieka seufzt leise, sie scheint nicht sehr überzeugt, aber hinter Gil ist ihr Gesicht nicht zu sehen.
Hier spielt noch ein Faktor hinein: das Tempus. Wählt ein Autor eine Ich-Erzählerin und lässt sie im Präsens erzählen, will er damit bei den Lesern ja den Eindruck erwecken, die Ich-Erzählerin würde gerade in der Situation stecken. Und zwar just in dem Moment, in dem die Leser den Roman lesen. Eine solche Erzählerin aber würde eben nicht erzählen, sondern erleben – und die Leser miterleben lassen.
Das Erzählen (als Gegenpol zum Zeigen) passt, von der Erzählzeit her, besser zum Präteritum. Denn hier sagt schon das Tempus, dass die Ereignisse vergangen sind.
Merke
Zeigen heißt, die Leser miterleben zu lassen.
Auch die anderen Erklärungen aus Meg Rosoffs Romanauszug können wir näher heranholen. Etwa so:
Besser, jemand passt auf Papa auf, damit er in seiner eigenen Welt nicht verlorengeht, gerade auf Reisen ist das sicherer.
Das Erzählen – genauer: der Erzähler – ist, ebenso wie das Tempus und Verben der Wahrnehmung und Empfindung, eine Instanz[Fußnote 26], die Sie zwischen Leser und Charakter oder zwischen Leser und Story schalten.
Faustregel
Jede Instanz vergrößert die Distanz.
Indem Sie die Zahl der Instanzen zwischen Leser und Romanfigur verringern, rücken Sie die Leser dichter an Ihren Protagonisten heran.
Während bei einer nahen Erzählweise Gedanken und Erzählen eins werden, bedeutet die Kennzeichnung von Gedanken als solche eine weitere Instanz.
»…
Elisabeth saß auf dem Rand ihres Bettes. Um des lieben Friedens willen hatte sie noch die Schwarzwurzeln geputzt. Sie schaute auf ihre Hände, die klebrig waren und voller Flecken. Mein Leben steht still, dachte sie. Seit diesem Tag. Sie konnte sich mühelos an den Geruch des Büros erinnern: Bohnerwachs und gestärkte Röcke.
…«
(Kris van Steenberge, »Verlangen«, Klett-Cotta 2016)
Protagonistin Elisabeths Gedanken werden klar als Gedanken gekennzeichnet. Doch wer erzählt dieses »dachte sie«? Ein Erzähler, der nicht mit Elisabeth identisch ist, und damit eine zwischengeschaltete Instanz, die für Distanz sorgt.
Gedanken wirken beim distanzierteren Erzählen eher wie etwas lautlos Gesagtes, wie ein stiller Dialog der Figur mit sich selbst – den der Erzähler mitschreibt.
Anders gesagt: Beim nahen Erzählen erlebt der Charakter die Gedanken, beim distanzierten Erzählen werden die Gedanken vom Erzähler bloß zitiert.
Lesen wir den Abschnitt noch einmal, dieses Mal aus einer näheren Erzählperspektive geschildert:
Elisabeth saß auf dem Rand ihres Bettes. Um des lieben Friedens willen hatte sie noch die Schwarzwurzeln geputzt. Sie schaute auf ihre Hände, die klebrig waren und voller Flecken. Mein Leben steht still. Seit diesem Tag. Sie konnte sich mühelos an den Geruch des Büros erinnern: Bohnerwachs und gestärkte Röcke.
Da die Leser die ganze Zeit schon bei dieser Romanfigur sind, wissen sie, dass der Gedanke »Mein Leben steht still« von Elisabeth kommt und nicht von einem Erzähler. Was aber ist das »dachte sie« anders als Erzählen? Eben.
Achten Sie auf das Tempus der Gedanken. Sie werden hier im Präsens wiedergegeben, was die Leser ebenfalls näher an den Charakter heranholt (siehe oben).
Eine weitere Instanz lässt die Autorin bereits weg: die optische Kennzeichnung des Gedankens als solchen. Sie hätte die Gedanken kursiv oder gar in Anführungszeichen setzen können und hätte Elisabeth damit ein weiteres Stück vom Leser entfernt. Jede Abweichung im Schriftbild, allgemein im Layout, zieht die Aufmerksamkeit auf sich, umgekehrt erleichtert ein gleichmäßiger visueller Eindruck des Textes das Versinken der Leser in der Geschichte.
Das sehen wir uns genauer an:
»…
Als er seinen Namen nannte, Rudolf Born, musste ich sofort an den Dichter denken. Irgendeine Verwandtschaft mit Bertran?, fragte ich.
Ah, erwiderte er, der arme Kerl, der seinen Kopf verloren hat. Möglich, aber wohl leider nicht wahrscheinlich. Mir fehlt das de. Dazu muss man von Adel sein, und die traurige Wahrheit ist, dass ich alles andere als ein Adliger bin.
…«
(Paul Auster, »Unsichtbar«, Rowohlt 2010)
Falls die Leser tief im Charakter stecken, wird die optische Kennzeichnung überflüssig: Sie wissen genau, was der Charakter laut ausspricht, was er denkt oder was er nur erzählt.
Theoretisch. Denn in vielen Fällen verhindert dieses Vorgehen, dass die Leser schnell in den Text und damit in den Charakter, Protagonisten oder Erzähler finden. Das Weglassen wird zur Stolperfalle, die die Leser wieder und wieder aus der Geschichte reißt. Was wurde nun gesagt, was gedacht, was getan? Und von wem?
Im Ausschnitt oben könnte der Satz »Ah, erwiderte er, der arme Kerl, der seinen Kopf verloren hat« auf zweierlei Art gelesen werden:
1. »Ah«, erwiderte er, »der arme Kerl, der seinen Kopf verloren hat.«
2. »Ah«, erwiderte er, der arme Kerl, der seinen Kopf verloren hat.
Wahrscheinlich ist es 1., dennoch dürfte es bei manchen Lesern für einen Stolperer sorgen. Den Kopf verlieren, das kann auch im übertragenen Sinne gemeint sein.
Noch kitzliger wird es beim letzten Satz: »Dazu muss man von Adel sein, und die traurige Wahrheit ist, dass ich alles andere als ein Adliger bin.«
Auch den sagt, vermutlich, Rudolf Born. Doch da wir einen Ich-Erzähler haben, wird das »ich« ebenfalls so manchen Leser verwirren, vielleicht nur kurz, aber schon das ist zu lange.
Sie aber bleiben der Meister Ihres Texts. Falls Sie also dennoch die Verwendung von Anführungszeichen als überflüssig erachten oder als einen persönlichen Affront verstehen, könnten Sie es halten wie Auster im selben Buch:
»…
Born sagte, er und Margot hätten gerade gehen wollen, aber dann hätten sie mich allein in der Ecke stehen sehen, und da ich so unglücklich gewirkt habe, seien sie gekommen, um mich aufzuheitern – nur um sicherzugehen, dass ich mir nicht vor dem Ende des Abends die Kehle aufschlitzte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Bemerkung deuten sollte. Wollte dieser Mann mich beleidigen, fragte ich mich, oder versuchte er wirklich, einem einsamen jungen Fremden eine Freundlichkeit zu erweisen?
…«
(Paul Auster, »Unsichtbar«, Rowohlt 2010)
Hier verwendet Auster die indirekte Rede und stellt auf diese Weise klar, wer was sagte.
Wir propagieren hier weder den grundsätzlichen Verzicht noch das Setzen von Anführungszeichen oder Absätzen. Fakt ist: Das Erscheinungsbild des Textes, seine visuelle Anmutung kann das Lesen erleichtern und Verwirrung vermeiden.
Wenn Sie zum Beispiel die Handlungen und Dialoge eines Charakters jeweils in einen eigenen Absatz setzen, sehen die Leser schneller, dass nun jemand anderes handelt oder spricht.
Nur in seltenen Fällen erfordern es ein Erzähler und das Erzielen eines besonderen Sounds seiner Stimme, auf visuelle Unterbrechungen zu verzichten.
Wer Anführungszeichen komplett weglässt, hofft in vielen Fällen bloß, »irgendwie literarischer« zu wirken – und entlarvt die eigene Manieriertheit. Nur die wahren Meister des Romaneschreibens drücken sich so klar und präzise aus und entwickeln in ihrer Geschichte einen solchen Sog, dass Anführungszeichen stören.
Bis Sie so meisterlich schreiben, belassen Sie es bitte bei grammatisch korrekten Anführungszeichen. Ihre Leser (und Lektoren) werden es Ihnen danken.
Das Erzählen dicht am Charakter unter Verzicht auf Instanzen kann die Wörterzahl spürbar reduzieren. Der Roman liest sich schneller und wirkt auf die Leser so unterhaltsamer und/oder intensiver. Möchten Sie die eingesparten Wörter gleich wieder ausgeben, erlaubt Ihnen die Instanzvermeidung, den gewonnenen Raum mit Story zu füllen, mit neuen Informationen oder Details, mit einer Vertiefung Ihrer Charaktere und des Themas.
Natürlich können Sie Instanzen mal verwenden, mal weglassen. Doch wenn Roman oder Handlungsstrang keine klare Präferenz für Nähe oder Distanz erkennen lassen, machen Sie es dem Leser schwerer. Stellen Sie sich das so vor: Sie halten ihm die Geschichte vors Gesicht, jetzt einen Meter weg, dann nur wenige Zentimeter. Das Lesen fällt da nicht gerade leichter.
Im folgenden Romanausschnitt nimmt die Autorin zwar die Instanzen Anführungszeichen bei wörtlicher Rede oder Kursivsatz bei Gedanken weg, schaltet dann aber wieder eine andere ein:
»…
Morgen wird alles anders wirken, denkt er, als sich der Aufzug ruckartig in Bewegung setzt, morgen wird alles freundlich sein. Vierzig Jahre, flüstert er, als er das Baujahr des Aufzugs liest, in diesem Jahr war er mit Susanne in das Haus gezogen. Nein, jetzt nicht Susanne. Karl versucht sich zu erinnern, wie die Aussicht auf den See gewesen war, als er mit Margit auf der Terrasse saß, waren da Berge gewesen, oder nur Hügel?
…«
(Anna Weidenholzer, »Weshalb die Herren Seesterne tragen«, Matthes & Seitz 2016)
Insbesondere der Wechsel vom Personalpronomen (zurück) zum Namen irritiert. Zu viele davon, und die Leser werden unsanft aus dem Roman bugsiert.
Wie immer beim Schreiben gilt es abzuwägen. Das »denkt er« ist zwar eine Instanz, gibt dem Satz jedoch einen eigenen Rhythmus. Man hätte es auch so schreiben können, ohne Instanz:
Morgen wird alles anders wirken, morgen wird alles freundlich sein. Der Aufzug setzt sich ruckartig in Bewegung.
Schreibtipp
Eine Erweiterung des Leser-Horizonts durch Herauszoomen aus der eingeschränkten Perspektive kann die Leser befreien oder ihnen neue, unverzichtbare Einblicke in Ihren Roman, die Story und ihre Charaktere gewähren.
Wie lange solche Ausflüge in den Kopf und das Herz Ihrer Protagonisten sein sollten, hängt stark vom Genre und damit von den Erwartungen Ihrer Leser ab. Aber auch von der Platzierung dieser Nabelschau[Fußnote 27] im Plot – im Finale beispielsweise stören zu viele Gedanken die Action und die Auflösung des zentralen Konflikts.
Um das rechte Maß zu ermitteln, fragen Sie sich stets[Fußnote 28]:
• Werden die Leser durch die Gedanken- und Gefühlsgänge (zu lange) aus der Handlung gerissen?
• Erweitert die Innensicht die Handlung und ergänzt sie um für den Roman bedeutsame (!) innere Reaktionen auf die äußeren Ereignisse?
• Wissen die Leser nach der Rückkehr aus dem Kopf der Figur, was zuvor passiert war?
Hier hilft Rekapitulation. Leider schafft diese Distanz und macht, in vielen Fällen, den Erzähler (besser) sichtbar. Die Leser werden sich bewusst, eine Geschichte erzählt zu bekommen, statt sie aus nächster Nähe mitzuerleben.
Wie wir gesehen haben, kann zu große Distanz dafür sorgen, dass die Leser den emotionalen Bezug zur Geschichte und zu den Charakteren verlieren.
Um das rechte Maß zu ermitteln, stellen Sie sich diese Fragen:
• Kennen die Leser die wichtigsten und entscheidenden Emotionen der Figuren an den wichtigen und entscheidenden Stellen des Romans?
Echte Emotionen sind komplex. »Kennen« heißt hier also durchaus, sie in ihrer Komplexität zu erkennen. Sie oder die Leser müssen sie keineswegs mit einem eindeutigen und simplen Label benennen können.
• Folgen aus der Distanz erzählter Aktion ausreichend (emotionale und rationale) Reaktionen?
• Würde ein kurzes Unterbrechen der Handlung, zugunsten einer Annäherung an den Protagonisten, den Lesern eine willkommene Atempause gewähren?
• Würde ein kurzes Verringern der Distanz die Handlung plastischer wirken lassen?
Beispielsweise mithilfe von überblickartigem Einzoomen, einer Rekapitulation, einer Vorausschau.
Viele der genannten Punkte zur Nähe durch Sprache und Stil funktionieren bei klugen und erfahrenen Lesern, die Ihrem Roman ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Der Lesealltag sieht anders aus. Da können viele Leser gar nicht genug geschmacksverstärkende Adjektive und künstlich aromatisierende Adverbien verschlingen, Klischees haben sie am liebsten in der Großfamilien-Klan-Packung und Melodrama mit seinen behaupteten oder aufgeblasenen Emotionen wird gefuttert wie Chio-Chips: Man kann einfach nicht mehr damit aufhören.
Menschen, die man mit McDonald’s großzieht, wissen gutes Essen, von Könnern aus hochwertigen Zutaten bereitet, nicht zu schätzen. Es wird dann als »gewöhnungsbedürftig« oder »nicht so mein Fall« abgekanzelt. Oder, wie hier in einer Rezension von Lovin-books.de zu Tamara Bachs (meiner Meinung nach erfrischend gut geschriebenem) Roman »Mausmeer«:
»…
Abgehackte, kurze Sätze aneinander gereiht. Kaum Erklärungen. Es wirkt alles wie steif, hektisch und es kamen für mich keine Gefühle auf. [Und im nächsten Satz dann das Thema dieses Kapitels …] Die Charaktere waren für mich dadurch so weit entfernt wie noch nie zuvor in einem Buch.
…«
Eine Meinung, die der große Teil der Rezensenten teilt.
Das heißt für Sie: Überlegen Sie, was Ihnen wichtig ist. Was ist für Sie ein gut(geschrieben)er Roman? Was ist für Sie Erfolg? Wer sind Ihre Leser und was gefällt ihnen, auch sprachlich? Wollen Sie Leser erreichen, die einen anderen Geschmack haben als Sie, oder auf Ihrer Vorstellung von einem guten Text beharren? Wo sind Sie bereit, Kompromisse einzugehen, und wo nicht? Fragen, die Sie sich sowieso immer mal wieder stellen sollten.
Und weil es sein muss, lasse ich noch eine andere Rezensentin, Damaris, zu Wort kommen:
»…
Tamara Bachs wunderbarer Stil ist genau meiner, ihr Buch für mich so besonders, dass es zu meinen literarischen Schätzen zählt. Es ist ruhig, es ist sehr dicht und es ist unmissverständlich bildgewaltig.
…«
Diese Rezension ist, übrigens, besser geschrieben als die andere …
Allen können Sie es nicht recht machen. Das Schielen nach dem Markt schadet fast immer sowohl dem Roman als auch, ironischerweise, seinem Verkaufserfolg.
Mein persönlicher Tipp
Schreiben Sie in erster Linie für sich und für Ihren idealen Leser, Ihre perfekte Leserin. Alles andere verursacht nur Magengeschwüre. Und zu diesen sollten Sie in jedem Fall auf größtmögliche Distanz gehen.
Das Erzeugen von Nähe oder Distanz ist das eine. Doch wie kommen Sie von der Distanz zur Nähe? Wie gelingt der Übergang?
Vorab: Leser vertragen hier eine Menge. An scharfe Schnitte sind sie ebenso gewöhnt wie an sanftere Überleitungen durch ein Ein- oder Auszoomen.
Am einfachsten aber machen Sie es ihnen, wenn Sie die Distanz langsam verkleinern. Wie das aussehen könnte, haben wir oben gesehen.
Sanft und dennoch schnell kann das beispielsweise so geschehen:
Die Stadt lag schlafend, Mondlicht funkelte in den Pfützen der letzten nassen Wochen. Es schien, dass von allen hunderttausend Menschen allein Petra nicht schlafen konnte. Sie saß am Rand ihres Betts und starrte den Kamm an, in dem noch Peters Haare steckten. Peter. Wohin war er verschwunden? Er würde nicht einfach losziehen und sie verlassen, nicht er, niemals.
Wir haben im ersten Satz eine große Distanz zur Hauptfigur Petra. Schon im zweiten Satz wird die Distanz überbrückt und im dritten ist Nähe hergestellt. Diese Nähe intensiviert sich in den folgenden Sätzen, indem der Erzähler in Petra hineinzoomt und ihre Gedanken schildert.
Dass die Leser vom Überblick weg- und im Charakter angekommen sind, belegen Sie mit möglichst konkreten und körperlichen Wahrnehmungen: Sie zeigen ihnen, dass sie physisch, ganz handfest in der Person drin sind, und erden sie in der Realität Ihrer Story. Dann könnte die Szene so erzählt sein:
Die Stadt lag schlafend, Mondlicht funkelte in den Pfützen der letzten nassen Wochen. Es schien, dass von allen hunderttausend Menschen allein Petra nicht schlafen konnte. Sie saß am Rand ihres Betts, die Satinwäsche unter ihren Beinen feucht und kühl, und starrte den Kamm an, in dem noch Peters Haare steckten. Peter. Sie zupfte ein Haar heraus und fuhr sich damit über die Wange, spürte ein fernes Kitzeln, so fern wie er. Wohin war er verschwunden? Er würde nicht einfach losziehen und sie verlassen, nicht er, niemals.
Auch mit Emotionen erden Sie die Leser in Ihren Figuren – nicht von ungefähr am einfachsten, wenn Sie die Emotionen über körperliche Empfindungen schildern.
Die Stadt lag schlafend, Mondlicht funkelte in den Pfützen der letzten nassen Wochen. Es schien, dass von allen hunderttausend Menschen allein Petra nicht schlafen konnte. Sie saß am Rand ihres Betts, die Satinwäsche unter ihren Beinen feucht und kühl, und starrte den Kamm an, in dem noch Peters Haare steckten. Peter. Sie zupfte ein Haar heraus und fuhr sich damit über die Wange, spürte ein fernes Kitzeln, so fern wie er. Ihre Brust wurde ihr eng, als würde jeder Kilometer zwischen Peter und ihr, jede Stunde ohne ihn darauf lasten. Wohin war er verschwunden? Er würde nicht einfach losziehen und sie verlassen, nicht er, niemals.
Wie könnte das umgekehrt gehen, wie kommen Sie von der geerdeten Nähe zu einer abstrakteren Distanz? Dieser Weg ist für die Leser sehr viel leichter, da sie sich nicht erst in einer Person und ihren Sinnesempfindungen, ihren Gedanken und Gefühlen einfinden müssen. Daher können Sie schneller zoomen und, mit einem Absatz, die Änderung in der Distanz den Lesern schon anhand des Layouts zeigen.
Die Stadt lag schlafend, Mondlicht funkelte in den Pfützen der letzten nassen Wochen. Es schien, dass von allen hunderttausend Menschen allein Petra nicht schlafen konnte. Sie saß am Rand ihres Betts, die Satinwäsche unter ihren Beinen feucht und kühl, und starrte den Kamm an, in dem noch Peters Haare steckten. Peter. Sie zupfte ein Haar heraus und fuhr sich damit über die Wange, spürte ein fernes Kitzeln, so fern wie er. Ihre Brust wurde ihr eng, als würde jeder Kilometer zwischen Peter und ihr, jede Stunde ohne ihn darauf lasten. Wohin war er verschwunden? Er würde nicht einfach losziehen und sie verlassen, nicht er, niemals.
Ihr Blick ging zum Fenster und hinauf zum halbvollen, nicht zum halbleeren, Mond. Auch der Erdtrabant verrät die Optimisten oder Miesepeter. Ein halbvoller Mond verhieß Peters Rückkehr. Die Stadt drehte sich noch einmal auf die andere Seite, ein paar Stunden bis zum Sonnenaufgang, zu einem ganz vollen Morgen.
Auch beim Wechsel der Distanz sind Ihrem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Es gibt viele Wege, Ihre Leser zu führen. So könnte es beispielsweise an einer Stelle in Ihrer Story effektiv sein, einen jähen Übergang zu wählen.
Achtung!
Distanzänderungen sind potenzielle Bruchstellen in Ihrem Roman und erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Insbesondere bei der Überarbeitung.
Nähe und Distanz geschickt variieren können Sie, indem Sie im selben Erzählstrang auktoriale und personale Erzählweise einsetzen, ohne dass sie einander oder die Leser stören: etwa beim Hereinzoomen am Anfang einer Szene oder beim Kommentieren oder Vorausdeuten an deren Ende.
Damit das funktioniert, sollte Ihr auktorialer Erzähler weitgehend unsichtbar bleiben, sich also Haltungen und Kommentare verkneifen. Die Perspektivwechsel sollten unmerklich geschehen, wie im ersten Petra-Beispiel oben.
Dort zoomt der Autor mittels eines auktorialen POV in die Szene hinein. Der Erzähler wird nur dadurch sichtbar, dass er beschreibt, was kein Charakter des Romans wahrnehmen könnte. Dann wechselt die Perspektive nahtlos zu Petras naher personaler Sicht.
Ähnlich im folgenden Beispiel, wo der Autor seinen Erzähler etwas hinterherschieben lässt, was Suspense erzeugt und die Leser gespannt umblättern lässt:
Petra starrte auf ihren blutverschmierten Finger. Wie kam das Blut unter den Rand des Waschbeckens? Sie hockte sich hin und fand rote Streifen unter dem Becken. Jemand hatte Blut ins Becken getropft, viel Blut, aber nicht alles abgewischt. Peters Blut? Sie versuchte, eine rationale Erklärung zu finden, eine, bei der Peter nichts passiert war, eine, bei deren Erinnerung sie in ein paar Tagen schon gemeinsam lachen würden.
Petra war so in ihre Gedanken vertieft, dass sie nicht hörte, wie die Schlafzimmertür geöffnet wurde.
Der Wechsel vom personalen POV Petras zu dem des auktorialen Erzählers stört an dieser Stelle nicht; auch deshalb nicht, weil den Lesern subtile Wechsel an solchen herausgehobenen Stellen einer Szene vertraut sind.
Auktorial zu erzählen heißt gerade nicht, dass Ihr Erzähler sämtliche Perspektiven einnehmen kann. Selbst der mächtigste auktoriale Erzähler hat nur eine Perspektive, seine eigene – und er erzählt nur mit einer Stimme. Mehr dazu später.