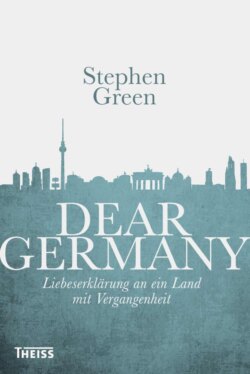Читать книгу Dear Germany - Stephen Green - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Springtime in Berlin
ОглавлениеEs ist Ostern. Berlin, eine Weltstadt in voller Blüte, in lebendiger Entwicklung.
Die Spatzen hier sind berühmt-berüchtigt für ihre Angriffslust. Sie sind bereit, sich auf das Stück Kuchen zu stürzen, das man in der Hand hält, wenn man in einem der zahllosen Straßencafés sitzt.
Der Tiergarten glänzt in frischem Grün. Es ist jener 200 Hektar große, dicht mit Bäumen bestandene Park im Herzen der Stadt, der vormals das Jagdreservat der Königsfamilie war (daher auch der Name). Später dann, in den scheinbar so selbstbewussten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, machten die Bürger dort ihren Sonntagnachmittagsspaziergang, um zu sehen und gesehen zu werden, und nach dem Zweiten Weltkrieg plünderten die Berliner den Baumbestand, damit sie etwas zum Anheizen für ihre Öfen hatten. Jetzt kann man dort unter Bäumen flanieren und an Kanälen entlangwandern und vergessen, dass man sich in Europas drittgrößter Stadt befindet.
Die Sonne bringt den schlanken Fernsehturm auf dem Alexanderplatz zum Glitzern (er ist eines der wenigen attraktiven Bauwerke aus der DDR-Zeit). Die silbergraue Turmkugel unter dem Sendemast, die hoch über der Stadt die Besucherebenen beherbergt, spiegelt das Licht in Gestalt eines gleißenden Kreuzes – das war zu Zeiten der alten Atheisten, die vor mehr als einem Vierteljahrhundert die DDR regierten, eine Quelle für manch trockenen Kommentar.
Und jenseits der durch die Stadt mäandernden Spree, im Zentrum, stand einst das Berliner Schloss, der Palast der Hohenzollern, der Herrscher von Brandenburg-Preußen und der Kaiser des Zweiten Reichs von der Vereinigung 1871 bis zu seinem Zusammenbruch 1918. Das alte Schloss war nicht schön, aber imposant. Es beherrscht die Fotografien aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann wurde es durch Bomben schwer beschädigt und 1950 von der neuen ostdeutschen Regierung in einem Akt symbolisch-ideologischer Bedeutung gesprengt: Die preußische Vergangenheit musste zerstört werden. An ihre Stelle trat der Palast der Republik, eine Konstruktion aus Glas und Beton, die nach der Wiedervereinigung jedoch abgerissen wurde. Es war ein mit Mängeln behafteter und asbestverseuchter Protzbau – aber nicht auch ein grässliches und peinlich berührendes Erinnerungsmal an die 40 Jahre währende schmerzhafte Teilung, brutal erzwungen von einer Regierung, die nur der verlängerte Arm der Sowjetunion war?
Wie dem auch sei – jetzt herrscht dort wieder Leben und Treiben. Das alte Schloss entsteht in neuer Form – eine eng am Original orientierte Nachbildung, die nach ihrer Fertigstellung die Mitte von Berlin beherrschen und den jetzt schon augenfälligen Eindruck der Kontinuität zwischen Alt und Neu an diesem Ende der Straße Unter den Linden verstärken wird. Steht man auf dem benachbarten Bebelplatz (wo 1933 die Bücherverbrennung stattfand), mit dem Rücken zur St. Hedwigs-Kathedrale, rechts die Staatsoper Unter den Linden und gegenüber, auf der anderen Straßenseite, das Hauptgebäude der Humboldt-Universität, scheint sich gegenüber der Vorkriegszeit nichts verändert zu haben.
In der Nähe steht die solide wirkende Friedrichswerdersche Kirche, ein neogotischer Backsteinbau, der bis 2012 als Museum für Karl Friedrich Schinkel diente, den Architekten, der sie und viele andere glanzvolle Gebäude in unmittelbarer Nähe errichtete. Im Innern befinden sich an den Wänden noch immer alte Gedenktafeln für längst vergessene Würdenträger aus dem 19. Jahrhundert. Auch steht dort noch ein Kriegerdenkmal für die im Ersten Weltkrieg „gegen eine Welt von Feinden“ gefallenen deutschen Soldaten. Nach dem Ersten Weltkrieg – nach dem Trauma der unerwarteten Niederlage, dem Zusammenbruch des wilhelminischen Reichs und den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in der Stadt – war das Gefühl, die Welt sei gegen Deutschland, lebendiger als zuvor. So drängen sich das Neue, das Alte und das Unvollendete aneinander und gegeneinander.
Weil Ostern ist, hört man überall das Dröhnen der großen Glocke vom Turm des protestantischen Doms (er hat kein Glockenspiel und muss daher selbst zum Osterfest mit feierlicher Tiefe tönen). Allgegenwärtig sind auch Bachs Matthäuspassion und Brahms’ Deutsches Requiem. Touristen flanieren die Prachtstraße Unter den Linden auf und ab. Man hört europäische und asiatische Sprachen.
Das neue Leben vermischt sich mit Geisterhaftem. Nahe den Hackeschen Höfen steht die Sophienkirche, die einzige Kirche in Berlin-Mitte, die den Krieg unbeschädigt überstanden hat. Gleich daneben liegt ein alter jüdischer Friedhof, der ein paar Besucher anzieht. Auf ihm findet man den Grabstein von Moses Mendelssohn, dem Großvater des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy. Moses Mendelssohn war einer der glänzendsten Geister der deutschen Aufklärung im 18. Jahrhundert. Nur wenige Hundert Meter entfernt erhebt sich in der Oranienburger Straße die jüdische Synagoge, die die Zerstörungen und Brandstiftungen der „Kristallnacht“ überstanden hat, weil ein so mutiger wie mitfühlsamer Polizeichef ihr Schutz gab. Doch fiel sie später den Bombardements der Alliierten zum Opfer. Nun aber ist sie von Grund auf restauriert und das Herzstück einer Straße, die seit der Wiedervereinigung die Nachtschwärmer anzieht wie ein Magnet. Hier finden auch Prostituierte ihren Strich. Man erkennt sie an ihrem fast uniformen Outfit: schulterlanges schwarzes oder blondgefärbtes Haar, dazu Stiefel, die bis übers Knie reichen. Auch das erinnert stark an das Berlin der 1920er-Jahre.
Inmitten all der Kontinuität verweist das Neue auf die Brüche in der Geschichte. Im Herzen von Berlin, benachbart dem Brandenburger Tor, stehen die unregelmäßigen Steinblöcke des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Es scheint leer zu sein und sich zugleich immer tiefer in die Seele hineinzusenken. Es zieht einen in seine Dunkelheit. An einem warmen Frühlingstag wirkt es indes nicht so düster: Kinder turnen auf den Steinen herum, asiatische Touristen fotografieren einander, wie sie auf den Blöcken sitzen oder stehen. Aber nachts wirkt der Ort so bedrohlich, wie er gedacht ist.
Und es gibt noch andere schmerzliche Erinnerungen. Im Zentrum des einstigen Westberlin steht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche – eine auffallende Kombination aus dem zerbombten Turm und einem neuen achteckigen Gebäude, das 1962 fertiggestellt wurde (im selben Jahr wie der dritte Neubau der von den Deutschen zerbombten Kathedrale von Coventry und wie diese eine der bemerkenswertesten Konstruktionen der Nachkriegsarchitektur). Betritt man die Kirche, lässt man den Glitzerprunk des Kurfürstendamms hinter sich. Man ist umgeben von ätherischer Stille, und Tausende blau gefärbter Glasscheiben tauchen den Raum in ein überirdisch wirkendes Licht.
Hier findet man auch die Stalingradmadonna: ein Stück weißes Tuch, auf das der Lazarett-Oberarzt Kurt Reuber in einem Feldlazarett in Stalingrad im Dezember 1942 als Trost für seine Patienten eine Madonna mit Kind gezeichnet hatte. Rechts neben der Figur stehen die Worte „Licht, Leben, Liebe“*. Als er das schrieb, muss er gewusst haben, dass für ihn wie für die Verwundeten kaum Hoffnung auf ein glückliches Ende bestand. Als die Sechste Armee ein paar Wochen später kapitulierte, geriet Reuber in Gefangenschaft. Ein Jahr später zeichnete er eine weitere Madonna mit Kind (das Werk befindet sich im Besitz der Familie und wird nicht öffentlich gezeigt). Hier ist der Gesichtsausdruck der Mutter ganz anders als in der ersten Ausführung – verzerrt auf eine Weise, die fast an Edvard Munchs Gemälde Der Schrei gemahnt. Aber die Worte sind dieselben: Licht, Leben, Liebe. Reuber starb kurz darauf. Von seinen Kameraden gelang nur wenigen die Heimkehr.
Wenn man die Kirche verlässt, hat einen das Stadtleben wieder: ein Straßenmarkt, gläserne Türme, Verkehr, Menschen von überall her, die umherschlendern oder geschäftig vorübereilen. Als der britische Journalist Richard Dimbleby 1945 nach Berlin kam, hielt er es nicht für möglich, dass jemals wieder Menschen hier wohnen würden. So weit sein Auge reichte, erstreckten sich Ruinen und Schutt. Das scheint jetzt sehr lange zurückzuliegen.
Ist man in Berlin, stellt man sich unweigerlich Fragen: Überall gibt es Zeichen einer großen und lebendigen Kultur, Zeichen vibrierenden neuen Lebens, gibt es Beispiele kühner neuer Kunst und Architektur, aber auch Zeichen einer tragischen Vergangenheit; Orte voller Schönheit wie auch Orte der Leere, Hässlichkeit, Trostlosigkeit. Fragen zu Geschichte, Kultur und Identität – Fragen, die für alle Menschen jederzeit und allerorts von Bedeutung sind – stellen sich hier mit besonderer Intensität. Schauen wir rückwärts, fragen wir: Woher kam der nationale Minderwertigkeitskomplex, der doch so aussah wie ein nationaler Überlegenheitskomplex und der zu so unsäglicher Zerstörung führte? Schauen wir nach vorn in ein neues Jahrhundert, so fragen wir: Wie ist die nationale Identität auf dieser immer stärker befahrenen und bevölkerten Kreuzung der Welten beschaffen? Die Suche nach Antworten ist wichtig – nicht nur für die Deutschen, nicht nur für die Europäer, sondern für die Menschen allgemein. Die Suche ist eine Reise, bei der Höhen und Tiefen durchmessen werden, die uns allen vertraut sind.