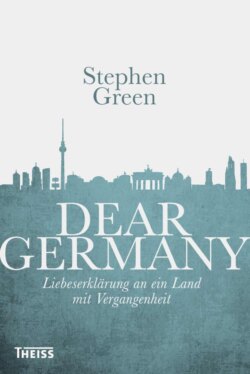Читать книгу Dear Germany - Stephen Green - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеSeit meiner Schulzeit bin ich von allem Deutschen fasziniert – zuallererst von der deutschen Sprache, die mir als kräftiger Blutsbruder des Englischen erschien. All diese angelsächsischen Wörter, die das Englische erden, haben einen leicht erkennbaren Vetter in der deutschen Sprache. Und das Deutsche hat zudem diese wundervoll ellenlangen, aus den Grundwörtern aufgebauten Mundhöhlenfüller. Man kann im Deutschen sprachliche Zusammensetzspiele wie mit Legobausteinen betreiben.
Das klassische Beispiel, mit dem sich bei den Schülern garantiert Heiterkeit erzeugen ließ, war der legendäre Donaudampfschifffahrts-gesellschaftskapitän*. Und es war nicht schwer, noch längere Wörter zu bilden. Doch auch in kürzerer Form sind deutsche Komposita häufig so ausdrucksvoll – oder schwer zu übersetzen –, dass das Englische, das sich aus allen Sprachen nimmt, was es brauchen kann, sie einfach unverändert übernommen hat: Apfelstrudel, Bildungsroman, Blitzkrieg, Dachshund, Doppelgänger, Edelweiß, Einsatzgruppe, Glühwein, Götterdämmerung, Kristallnacht, Lebensraum, Leitmotiv, Poltergeist, Realpolitik, Schadenfreude, Singspiel, Übermensch, Untermensch, Volkswagen, Wanderlust, Weltanschauung, Wirtschaftswunder, Zeitgeist. (Und noch viele andere.) Die Mischung aus dem Guten, dem Tiefen, dem Harmlosen und dem Bedrohlichen in dieser Sprache, die das Englische sich borgte, schlug mich in ihren Bann. Ich spürte, dass darin viel von der Kultur zum Vorschein kam, aus der die Wörter stammten.
Im Ringen mit der und um die Sprache öffnete sich der Zugang zur Literatur, vor allem zu Goethes Faust, den ich (wenngleich nicht gründlich genug) an der Universität studierte. Sodann die Philosophie (dito). Und die Musik – ja, die Musik. Ernsthaft von ihr berührt wurde ich zuerst in der Schule. Es war klassische Musik – die herbstlichen Töne von Brahms. Zuerst die „Variationen über ein Thema von Joseph Haydn“, gespielt (ich weiß es noch genau) vom Concertgebouw-Orchester unter Eugene Ormandy. Vor allem die siebte Variation, die sich himmelwärts erhob, war für mich etwas vollkommen Neues. Dann hörte ich die Dritte Sinfonie auf einer LP, deren Hülle das Foto eines herbstlaubgeschmückten Waldes zierte. Brahms wurde meine erste wirkliche musikalische Liebe. Jetzt höre ich seine Musik auf dem iPad, während ich dieses Vorwort schreibe.
Mit den Jahren hat sich meine Liebe zur klassischen Musik verbreitert und vertieft: Später – in manchen Fällen viel später – lernte ich einiges über die raffinierte Geometrie in Bachs Werken und die Riesenpanoramen Wagners, ganz zu schweigen von der Beweglichkeit Mozarts, der Leidenschaftlichkeit Beethovens, dem Melodienreichtum von Schubert und der Klangpracht von Richard Strauss – um nur einige zu nennen. Auch andere musikalische Traditionen haben mich bewegt, vor allem Werke italienischer und russischer Komponisten. Doch meine erste Liebe bleibt die deutsche Musik mit ihrer unübertroffenen Weite, Tiefe und Intensität.
Während meines ersten Aufenthalts in Deutschland wohnte ich bei einer Familie in Bayern. Ich war dort in den Schulferien und sollte mein Deutsch verbessern. Wahrscheinlich machte ich in den drei Wochen keine großen Fortschritte, lernte aber das kennen, was die Mutter dort als „richtige Bergwanderungen“* bezeichnete. Auch das wurde mir zur dauerhaften Liebe.
Ich bin dann im Lauf der Jahre häufig in Deutschland gewesen – als Student, später geschäftlich und als Urlauber. De facto dürfte ich mehr vom Land gesehen haben als mancher Deutsche. Eine Erfahrung von vielen sticht besonders heraus: der Tag, an dem ich am Checkpoint Charlie die Grenze überquerte. Wir waren zwei junge Firmenberater, die einen Kunden in Westberlin besuchten. Am späten Nachmittag hatten wir etwas freie Zeit und beschlossen, den Osten zu erkunden. Es war kurz vor Weihnachten; in winterkalter Luft strahlte die Sonne auf den am Vortag gefallenen Schnee, der in den Straßen schon zu schmutzigem Matsch geworden war, auf dem Todesstreifen an der Mauer aber in reinem, unberührtem Weiß erglänzte. Wir kamen mit einem ostdeutschen Grenzsoldaten etwa unseres Alters ins Gespräch, das sich um ein demnächst stattfindendes europäisches Fußballspiel drehte – das Gewöhnliche inmitten des Außergewöhnlichen.
Wir alle wissen viel zu wenig über dieses Land mit seiner außerordentlichen Kultur und Geschichte. Man suche in einer Buchhandlung die Abteilung „Geschichte“: Dort findet man ganze Regale mit Werken über das „Dritte Reich“ und die Judenvernichtung, vielleicht noch ein paar Titel über das Kaiserreich und Friedrich den Großen. Und natürlich, aus gegebenem Anlass, eine Flut von Büchern zum Ersten Weltkrieg. Kaum jedoch wird man etwas über die weiter zurückliegende Geschichte der deutschen Territorien oder über das gegenwärtige Deutschland und seine Rolle im neuen Europa finden. Es scheint, als gäbe es außer den zwölf Jahren von 1933 bis 1945 nichts, was an Deutschland interessant sein könnte.
Natürlich aber reicht das nicht aus. Keine Kultur auf unserem Planeten ist umfassender als die deutsche. Kein Land hat mehr zur Geschichte der Ideen und der menschlichen Schöpferkraft beigetragen. Kein Land ist tiefer in den Abgrund gestürzt. Und kein Land hat eine bemerkenswertere Vergebung erlangt und Erneuerung erlebt. All dies macht die Geschichte Deutschlands so faszinierend und verleiht ihr eine tiefgreifende und universelle Bedeutung. Und eben darum habe ich – lange nach der mit der Beherrschung der langen Komposita verbrachten Schulzeit – nicht aufgehört, das Land, seine Eigenarten, seine Literatur, seine Musik zu lieben.
Nur durch Schreiben lassen sich Gedanken entwickeln und herauskristallisieren. Zwar liegt das Ergebnis – wie immer es ausfällt – allein in meiner Verantwortung (dies ist eine sehr persönliche Reaktion auf das deutsche Phänomen), doch konnte ich enormen Gewinn aus den überaus freundlichen und geduldigen Hinweisen ziehen, die ich von anderen Personen erhielt. Insbesondere war es mir möglich, von dem Wissen zu profitieren, über das Helen Watanabe O’Kelly, Professorin für deutsche Literatur an der Universität Oxford und Emeritus Fellow meiner Alma Mater, dem Exeter College, verfügt. Gleiches gilt für Georg Boomgarden, den ehemaligen deutschen Botschafter in London; Sir Michael Arthur, den ehemaligen britischen Botschafter in Berlin; Neil McGregor, den ehemaligen Direktor des British Museum und jetzigen Gründungsintendanten des Berliner Humboldt-Forums; Martin Roth, den Direktor des Victoria and Albert Museum (und ehemaligen Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden); Baroness Ruth Henig, die ehemalige Dekanin der Faculty of Arts and Humanities an der Universität Lancaster; Alan Sharp, Professor emeritus (Internationale Geschichte und Diplomatie) an der Universität Ulster; sowie Hans Kundnani, Forschungsdirektor am Rat für Auswärtige Angelegenheiten. Die Hilfe all dieser Menschen hat dazu geführt, dass schon das Schreiben selbst für mich äußerst lohnend und erfreulich war.
Und schließlich gilt mein von Herzen kommender Dank Jay, die mir weiterhin zur Seite steht …
* Es ist erstaunlich und aussagekräftig, wie viele Wörter in der englischen Originalausgabe deutsch geschrieben sind. Sie sind hier im Folgenden durch Asterisken kenntlich gemacht.