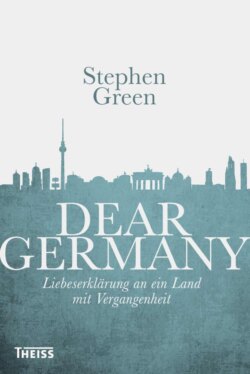Читать книгу Dear Germany - Stephen Green - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
ОглавлениеDeutschland ist ein Land mit einer Vergangenheit. Aber es ist auch ein Land mit einer Zukunft, in der es – ob es nun will oder nicht – die führende Rolle in der Weiterentwicklung des europäischen Projekts wird spielen müssen.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts haben in Europa gleich zwei Wiedervereinigungen stattgefunden: zum einen die deutsche, zum anderen die europäische, in der Ost- und Mitteleuropa Anschluss an den politischen und kulturellen Mainstream fanden. Somit ist Deutschland wieder das, was es jahrhundertelang war: das geografische Zentrum Europas.
Zugleich verschiebt sich das Gravitationszentrum des europäischen Projekts. In den ersten zwei Jahrzehnten nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 spielte sie die Rolle des Wirtschaftsgiganten und politischen Biedermanns*. Durch Deutschland verlief auch die Frontlinie des Kalten Krieges zwischen den beiden außereuropäischen Mächten, die das „Dritte Reich“ besiegt hatten. Aus strategischen und historischen Gründen begnügte Deutschland sich gern mit der Rolle im Maschinenraum des europäischen Projekts, während Frankreich auf der Kommandobrücke stand, die Briten aber noch nicht einmal an Bord gegangen waren.
Dann änderten sich die Dinge. 1969 ließen die Wahlen zum Bundestag das innenpolitische Pendel nach der anderen Seite ausschwingen, und außenpolitisch begann die Bundesrepublik, sich mit ihren Nachbarn im Osten zu arrangieren. Die Briten wiederum schlossen sich, nachdem sie ihre Fehler auf der Weltbühne der 1950er-Jahre bereut hatten, in den 1960er-Jahren von Charles de Gaulle gedemütigt worden waren und nun angesichts der westdeutschen Wirtschaftsmacht zunehmend nervös wurden, in den 1970er-Jahren dem europäischen Projekt mit einiger Verspätung an.
Am Ende des 20. Jahrhunderts hätte man gern den Schluss gezogen, dass die umfassenden europäischen Probleme endlich Aussicht darauf hatten, gelöst zu werden. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg war Großbritannien dabei, eine konstruktive Rolle zu spielen. Deutschland war wiedervereinigt und hatte sich auf einen außergewöhnlichen Weg begeben, dessen Stationen Erneuerung, Vergebung und Versöhnung hießen. Das deutsche Wirtschaftswunder hatte überall Anerkennung gefunden, doch war der politische Erfolg der Bundesrepublik ebenso bemerkenswert. In nur wenigen Jahrzehnten war sie zu einer der sichersten und stabilsten Demokratien weltweit geworden – eine erstaunliche Leistung, wenn man die jüngere Geschichte mit Kaiserreich, Weimarer Republik und „Drittem Reich“ bedenkt. Noch erstaunlicher war die schmerzhafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die so gründlich ausfiel, dass sie der übrigen Welt als Vorbild dienen kann (und das nicht nur für die üblichen Verdächtigen wie Japan, Russland und die Türkei, sondern auch für andere europäische Länder, die sich mit den Sünden ihrer Vergangenheit beschäftigen müssten, allen voran Großbritannien und Frankreich).
In den letzten zwei Jahrzehnten lag die Führerschaft Europas in den Händen der drei größten Mitgliedsstaaten der EU: Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Das heißt nicht, dass zwischen ihnen immer Einigkeit herrschte – wie sollte es auch? Ihre jeweilige Perspektive auf die Geschichte, auf ihren Platz in der Welt und auf die Beschaffenheit des europäischen Projekts war durch scharfe Gegensätze gekennzeichnet – die Folge von in jahrhundertelanger Entwicklung unterschiedlich geprägten Kulturen. Bis heute ist die deutsche Identität durchtränkt von ihrem metaphysischen Idealismus, während die Briten den Pragmatismus pflegen und die Franzosen cartesianische Rationalisten sind. Das aber bedeutete, dass die Aussichten auf echten Fortschritt im europäischen Projekt dann am günstigsten waren, wenn die drei Länder kooperierten.
Von diesen führenden Mitgliedsstaaten sind nun nur noch zwei übrig. Großbritannien hat sich dazu entschieden, die Union zu verlassen, und damit ist das Gleichgewicht der drei dahin. Das Dreieck ist durch eine Achse ersetzt worden, deren eines Ende indes schwächer ist als das andere. Alle politischen Wege in Europa führen jetzt zunehmend nach Berlin statt nach Paris, und London hat sich selbst marginalisiert. Mithin gibt es nur noch eine wirkliche Führungskraft für das europäische Projekt: Jetzt steht Deutschland auf der Kommandobrücke – eine Rolle, in der es sich häufig alleingelassen fühlen und sich über den Ärger, den andere empfinden, ärgern wird.
Denn am Horizont ballen sich die Gewitterwolken. Auf das europäische Anhängsel der eurasischen Landmasse kommen viele Herausforderungen zu: Das Gravitationszentrum der Weltwirtschaft hat sich nach Asien verlagert; Europa ist nicht mehr Austragungsort des Kalten Krieges und darum für die USA nicht mehr von höchster strategischer Priorität; um Europa herum herrscht Aufruhr, und die daraus resultierenden Flüchtlingsströme sind zum Nährboden für populistische Politiker geworden; die so ungleichgewichtigen nationalen Wirtschaften verweisen auf die Dringlichkeit von Reformen in kleineren wie größeren Mitgliedsstaaten, und das zweitgrößte Mitglied der EU ist nun tatsächlich dabei, sie zu verlassen.
Dem zugrunde liegt eine Identitätskrise – was heißt es, in einem zunehmend vernetzten 21. Jahrhundert europäisch zu sein? Was hat Europa der Welt zu bieten? Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen ist Deutschland gefordert, denn es ist das Land, das – gemäß geografischer und ökonomischer Logik – die europäische Reaktion auf diese vielen miteinander vernetzten Herausforderungen koordinieren muss. In der Tat ist diese Rolle – europäische Führungskraft zu sein – Deutschlands neue historische Bestimmung.
Dabei hat Deutschland an seiner Geschichte schwer zu tragen. Auch heute – in einem Jahrhundert, in dem weniger als zehn Prozent der Deutschen noch persönliche Erinnerungen an das „Dritte Reich“ haben – ruft die Vorstellung einer deutschen Bestimmung als Führungskraft neuralgische Reaktionen hervor. Viele sind schlicht der Ansicht, dass Deutschland diese Rolle nicht übernehmen kann oder soll. Beim amerikanischen Autor William Faulkner lesen wir, die Vergangenheit sei nicht tot, sie sei nicht einmal vergangen. Das gilt für kein Land so sehr wie für Deutschland. Die Vergangenheit verurteilt es dazu, die unvermeidliche Rolle als Führungsmacht des europäischen Projekts mit offenkundigem Zögern zu übernehmen.
Doch trotz dieses Zögerns hält das deutsche Establishment im Großen und Ganzen das europäische Projekt für Deutschlands Bestimmung; der Ausbau dieses Projekts sei das Risiko und den Kampf wert. Deshalb lautet die daraus sich ergebende Frage: Inwieweit versteht die Bevölkerung die Bedeutung des Projekts und unterstützt es? Die deutsche Öffentlichkeit ist nicht begeistert von Deutschlands Rolle als Zahlmeister der Union, und die Flüchtlingskrise hat ziemliche Unruhe hervorgerufen. Doch eines ist klar: Europa braucht Deutschland auf der Kommandobrücke – und jetzt mehr als zuvor.
Und auch die Welt braucht Deutschland in dieser Rolle. Denn Europas Identität ist geprägt durch jene Geschichte, die es dem Kontinent ermöglichte, zu einem Bund wohlhabender Völker zu werden. Diese Geschichte ist erhaben und tragisch und von tiefer und fortwährender Bedeutung für die gegenwärtige conditio humana. Und kein Land hat in diesem großen Schauspiel der europäischen Selbstentdeckung eine zentralere Rolle gespielt als Deutschland.
In letzter Hinsicht ist Europa mehr als nur eine Regierungs- und Verwaltungsstruktur. Und es ist sicherlich mehr als die augenblickliche Beschäftigung mit den Schwierigkeiten der Eurozone, dem Verlust an geopolitischem Einfluss und der britischen Ambivalenz. Denn Europas spirituelle, philosophische und ästhetische Erkundungen sind in ihrer Gesamtheit die reichsten, vielfältigsten, lebendigsten und forschungsträchtigsten weltweit. Dadurch hat Europa sich Werte erschaffen, die aus harten historischen Erfahrungen resultieren. Diese gemeinsamen Werte sind das Erbe einer europäischen Gedankenwelt, die durch Persönlichkeiten wie Thomas von Aquin, Luther, Erasmus von Rotterdam, Galilei, Descartes, Locke, Hume, Rousseau, Kant, Hegel, Darwin und noch viele andere geprägt wurde.
Aus den unterschiedlichen Perspektiven dieser Denker und aus den vielen und schmerzlichen Sünden, die wir Europäer in den vergangenen Jahrhunderten begangen haben, ist etwas entstanden, was für die ganze Welt des 21. Jahrhunderts von Bedeutung ist: ein Engagement für Vernunft, Demokratie, Rechte und Pflichten des Individuums, Gesetzesherrschaft, wirtschaftliche Effektivität und Fairness, soziales Mitgefühl und Sorge für den Planeten. Auch das Bewusstsein davon, dass die Treue zu Europa nicht der letzte Schritt, nicht die höchste Stufe der Identität sein kann – dass wir, wie uns allmählich deutlich wird, alle Weltbürger sind –, auch dieses Bewusstsein resultiert aus jenen europäischen Werten und ist mithin Bestandteil dessen, was Europas Projekt der Welt zu bieten hat.
Bringt Deutschlands Führungsrolle im zukünftigen Europa eine besondere Verantwortung und ein bedeutsames Risiko mit sich? Ja, in der Tat. Wird die Weiterentwicklung Europas Deutschland verändern? Zweifellos. Doch trotz aller German angst vor der Zukunft hat kein Land – keine Kultur – ein Identitätsbewusstsein, das besser dazu geeignet wäre, dieses „Haus Europa“ aufzubauen und zu bewohnen. Kein Mitgliedsstaat der EU steht mehr im Einklang mit der Vision dessen, was Europa für die Welt bedeuten kann. Dieses Buch will erklären, warum das so ist.