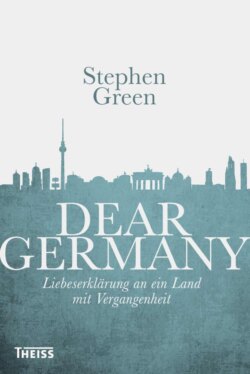Читать книгу Dear Germany - Stephen Green - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Tränen des Vaterlands
ОглавлениеIm Jahre 1636 schrieb der Dichter Andreas Gryphius ein Sonett, in dessen Versen er die fürchterlichen Erfahrungen der deutschen Lande in Europas schlimmstem Krieg vor dem 20. Jahrhundert – der damals größten von Menschen herbeigeführten Katastrophe – zusammenfasst. Tränen des Vaterlandes, anno 1636 heißt der bis heute tief bewegende Klagegesang über den Dreißigjährigen Krieg, der Deutschland so traumatisierte, dass die Erinnerung an seine Schrecken seitdem im Gedächtnis der Bevölkerung tief verwurzelt ist:
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret,
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun
Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.
Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret,
Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,
Die Jungfern sind geschändt, und wo wir hin nur schaun,
Ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret.
Doch war dieser Krieg mit all seinen Schrecken nur ein Kapitel in einer rund drei Jahrhunderte umfassenden Geschichte, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu dem starken Gefühl verdichtete, Opfer zu sein – und das wiederum trug seinen Teil zur Katastrophe des 20. Jahrhunderts bei.
Das Opfer schlägt zurück; der Gepeinigte wird zum Peiniger. Bei Menschen als Individuen ist uns dieses Muster vertraut: Wir wissen genug über den kindlichen Reifungsprozess, um sehen zu können, wann sich eine „normale“ moralische und soziale Entwicklung vollzieht – von der ersten Stufe, auf der das Kind anhand direkter Belohnungen und Strafen Gut und Böse zu unterscheiden lernt, über die zweite Stufe, wo es um diese Werte im Kontext familiärer Erwartungen geht, bis hin zum Stadium des Erwachsenen, der seine Werturteile unter Berücksichtigung des gemeinschaftlichen Wohlergehens ausbildet. Wir wissen auch, dass viele Individuen nicht über die zweite Stufe hinausgelangen (wobei die Familie oftmals zu einer umfassenderen Gemeinschaft oder Zugehörigkeit ausgeweitet, wenn nicht durch diese ersetzt wird). Einige verharren sogar auf der ersten Stufe. Häufig genug führen Misshandlungen und Missbrauch zu Störungen oder gar schwerwiegenden Behinderungen der Entwicklung. Damit soll keinem Determinismus das Wort geredet werden, der alles erklärt und die Schuldfähigkeit negiert. Doch wissen wir um die Zählebigkeit dieser Verhaltensmuster.
Und sie lassen sich auch auf der Ebene von Gemeinschaften und Gesellschaften beobachten. Zwar wäre es falsch, soziale mit individuellen Entwicklungslinien gleichzusetzen, doch gibt es Parallelen, wenngleich auch hier keinen Determinismus, der Schuldzuschreibung außer Kraft setzt. Tout comprendre, c’est tout pardonner? Nein, die mysteriöse Komplexität menschlichen Verhaltens werden wir nie ganz begreifen. Und wir verzeihen nicht so leicht. Im Übrigen ist es nicht an uns, zu verzeihen, es sei denn, wir selbst sind die Opfer. Und der Versuch, zu verstehen, läuft eher darauf hinaus, das uns alle einende, uns allen gemeinsame Menschsein zu erkennen, anhand dessen wir – auch und gerade im Blick auf uns selbst – wissen, wozu wir als Menschen fähig sind. Auf diese Weise zu verstehen, heißt, offen zu sein für eine uns einende Haltung der Demut und des gemeinsamen Lernens.
Für all dies ist Deutschland das eindrucksvollste Beispiel, wenn auch keineswegs das einzige. Eben deshalb ist seine Tragödie von universeller Bedeutsamkeit. Und wie bei allen den Menschen betreffenden Tragödien spielt der Hintergrund – die Geschichte – eine gewichtige Rolle.
Volksstämme, die in den deutschen Landen lebten, betraten zum ersten Mal die europäische Bühne, als Arminius (oder Hermann, wie sein deutscher Name lautet) mit seinen Stammesgenossen im Jahre 9 n. Chr. im Teutoburger Wald drei römische Legionen hinmetzelte und damit der Ausdehnung des Römischen Reichs nach Norden und Osten Einhalt gebot. Archäologen und Historiker haben darum gestritten, wo genau die schreckliche Schlacht stattgefunden hat. Unbeschadet dessen wurde im 19. Jahrhundert an ihrem vermuteten Ort eine riesige Statue – damals die größte in Europa – errichtet, um an diese Gestalt zu erinnern, die für die Deutschen der damaligen Zeit eine ähnlich mystische Bedeutung erlangte wie Vercingetorix für die Franzosen und Boadicea (oder Boudicca) für die Engländer. Allerdings gab es, wie wir noch sehen werden, in Bezug auf Hermann einen so entscheidenden wie aufschlussreichen Unterschied.
Wie sich herausstellte, konnte Arminius seinen militärischen Erfolg nicht nutzen (was übrigens auch Boudicca und Vercingetorix versagt blieb). Zwar war die Schlacht im Teutoburger Wald für die römische Armee eine der Niederlage gegen Hannibal vergleichbare Katastrophe, doch blieb sie im Kampf mit Arminius ein Einzelfall. Wie so häufig stellten die Römer neue Armeen zusammen, die während des folgenden Jahrzehnts Arminius zweimal besiegten. Bald danach wurde er von Stammesgenossen, denen er zu mächtig geworden war, umgebracht. Doch ein dauerhafter Sieg blieb ihm: Die meisten Stammesgebiete mit ihren undurchdringlichen Wäldern, die später zu deutschen Landen werden sollten, konnten von den Römern nicht unterworfen werden – im Unterschied zu Gallien und Britannien.
Später, als das Römische Reich durch die Völkerwanderung und die damit verbundenen Invasionen aus Mitteleuropa und Asien geschwächt wurde, breiteten sich germanische Stämme aus den deutschen Landen über weite Gebiete Westeuropas (inklusive Englands) aus. Zu eben dieser Zeit bildeten Angehörige germanischer Stämme das Rückgrat einer römischen Armee, die ihre Soldaten zunehmend aus den verschiedenen Regionen des Reichs rekrutieren musste. Gegen Ende des fünften nachchristlichen Jahrhunderts, als der Todeskampf des römischen Italiens begann, waren Germanen an der Verteidigung wie auch der Eroberung des Reichs beteiligt.
Dem Zusammenbruch des Römischen Reichs folgte ein Machtvakuum in Westeuropa; diverse germanische Königreiche entstanden, kämpften um die Vorherrschaft und verschwanden wieder. Am erfolgreichsten war dabei das Königreich der Franken, das in seiner Ausdehnung neben Norditalien einen Großteil jener Gebiete umfasste, aus denen später Frankreich, die Niederlande sowie West- und Süddeutschland entstehen sollten. Am Weihnachtstag (25. Dezember) des Jahres 800 wurde Karl der Große in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt: Das Römische Reich erlebte eine Art Wiedergeburt. Der Mittelpunkt von Karls Reich war die Königspfalz in Aachen, deren Kapelle, das unter Karl errichtete Oktogon, heute noch als Denkmal der außergewöhnlichen Errungenschaften seiner Herrschaft steht. Stilistisch orientiert sich die Marienkirche, die im 19. Jahrhundert zum Dom erhoben wurde, an San Vitale in Ravenna (ohne die Mosaiken). Sie sollte den Prachtbauten des byzantinischen Kaiserreichs Konkurrenz machen und war 200 Jahre lang das größte Gebäude nördlich der Alpen.
Aber das Reich war zu groß, als dass es sich hätte unter Kontrolle bringen lassen. Nach Karls Tod zerfiel es zunächst in drei Teile: ein westliches Königreich, das den größten Teil des heutigen Frankreichs umfasste, die Mitte (ungefähr die jetzigen Niederlande, Burgund und Norditalien) und ein östliches Königreich. Nur dieses, in etwa der heutige westliche Teil Deutschlands, blieb in den Händen der Karolinger.
Das westliche Reich entwickelte sich während der folgenden fünf Jahrhunderte zur französischen Nation, während die anderen Gebiete zu Beginn des Hochmittelalters durch eine Reihe von starken Königen zum Heiligen Römischen Reich zusammengefasst wurden, dessen Kern die deutschen Lande bildeten. Diese Herrscher dehnten ihren Machtbereich bis nach Rom aus, wo 962 einer ihrer Könige zum Kaiser gekrönt wurde – Otto I. Das war der Beginn eines Reichs, das zwar weite Regionen seines westlichen Territoriums verloren hatte (Burgund wurde schließlich von Frankreich einverleibt) und in Italien niemals wirklich festen Fuß fassen konnte, doch die Jahrhunderte überlebte, bis ihm Napoleon 1806 das Ende bescherte.
Aber die Krönung durch den Papst erwies sich als zweischneidiges Schwert, denn so geriet die Beziehung zwischen geistlicher Autorität und weltlicher Macht aus dem Gleichgewicht. Zudem waren deutsche Herrscher dadurch gezwungen, sich in die politischen Zwistigkeiten Italiens einzumischen, was häufig genug dazu führte, dass sie ihren eigenen Machtbereich aus den Augen verloren. Ein Ergebnis dieser Einmischung war der Beginn einer Liebesaffäre mit Italien. Es ist dies einer der bemerkenswertesten Charakterzüge der deutschen Kulturgeschichte, von dem später noch zu reden sein wird. Politisch aber führten die italienischen Verwicklungen zu einer Schwächung der Zentralmacht in den Heimatgebieten, was für die deutsche Geschichte auf lange Sicht tiefgreifende Folgen zeitigen sollte.
Frankreich wurde allmählich stärker und entwickelte eine immer deutlicher hervortretende nationale Identität, die auch durch den Hundertjährigen Krieg mit England gefördert wurde (der England übrigens das Gleiche bescherte). Deutschlands Geschichte verlief anders. Zwar gab es auch hier eine Empfindung für deutsche Identität: Ab Mitte des 15. Jahrhunderts wurde das Reich als „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“ bezeichnet.1 Aber die politische Geografie des Reichs zwang deutsche Herrscher wiederholt zu langen Feldzügen in Italien, deren Erfolge sich allzu oft als kurzlebig erwiesen. Und der Streit mit den Päpsten um die moralische Autorität, der auch anderswo in Europa ausgetragen wurde (nicht zuletzt in England unter Heinrich II., wo er in der niederträchtigen Ermordung Thomas Beckets kulminierte), fand seine äußerste Zuspitzung im Heiligen Römischen Reich.
Der Streit zwischen geistlicher und weltlicher Macht erlangte (zumindest in der Erinnerung der Deutschen) seinen Höhepunkt 1077, als sich der deutsche König Heinrich IV. einem der mächtigsten mittelalterlichen Päpste, Gregor VII. (Hildebrand aus der Lombardei), in Canossa unterwarf. Dieses Ereignis nimmt für das deutsche Bewusstsein in etwa die Rolle ein, die die Schlacht von Hastings (1066) für die Engländer spielt. Jeder Deutsche weiß, was in Canossa geschah oder geschehen sein soll (wobei unklar ist, ob das heute noch für die jungen Deutschen des 21. Jahrhundert gilt). Aus einer solchen Geschichte werden Legenden gewebt – Historiker haben nämlich nachgewiesen, dass die Überlieferung weitgehend eine Travestie dessen ist, was tatsächlich geschah.2 Aber das deutsche Bewusstsein ließ sich von der Legende beeinflussen, nicht vom wirklichen Ereignis.
Die Geschichte ist voller lebendiger Dramatik. Der Grund für die Auseinandersetzung war ein Kampf darum, wer in kirchlichen Angelegenheiten bestimmen konnte, wer also befugt war, die Bischöfe und andere geistliche Führungspersönlichkeiten zu berufen. Durfte es der Kaiser tun oder der Papst? Heinrich bestand darauf, das Recht zur Betätigung dieses wichtigen Machthebels auf seiner Seite zu haben. Gregor VII. schlug mit einer Waffe zurück, deren psychologische und politische Wirksamkeit für uns Heutige nicht mehr so recht begreifbar ist – er exkommunizierte Heinrich. Der gab nach einigen Kraftgebärden klein bei und pilgerte mitten im Winter nach Canossa, einer auf einem Berg in der heutigen Emilia-Romagna gelegenen Burg (von der nur noch Ruinen erhalten sind). Heinrich wartet barhäuptig im Schnee kniend, bis der Papst ihm Einlass gewährt und ihn angesichts seiner Bußfertigkeit vom Bann erlöst. Der Machtverlust ist umfassend und schwächt Heinrich beträchtlich. In Deutschland wird ein Gegenkönig gewählt.
Zwar kann Heinrich sich behaupten und Rache nehmen, indem er Gregor aus Rom vertreibt, doch hat sich das Bild der Erniedrigung des deutschen Kaisers durch den Papst tief ins nationale Gedächtnis eingeprägt und entfaltete im 19. Jahrhundert, als das Verlangen nach nationaler Identität immer stärker wurde, beträchtliche Wirkung. Otto von Bismarck berief sich darauf, als er im neu gegründeten und noch auf unsicheren Füßen stehenden Deutschen Reich mit erstaunlicher Aggressivität gegen die katholische Kirche vorging: „Nach Canossa gehen wir nicht, weder körperlich noch geistig.“ Auch Adolf Hitler bediente sich dieser Wendung, um zu beschreiben, wie er den bayrischen Ministerpräsidenten dazu bringen wollte, nach dem fehlgeschlagenen Münchener Putsch und seiner Inhaftierung das Verbot der NSDAP aufzuheben. Zu jener Zeit war der „Gang nach Canossa“ eine Umschreibung für tätige Selbsterniedrigung geworden und hatte so eine eindeutige Richtung gewonnen.
Im Hochmittelalter gab es auf der politischen Bühne nur zwei bedeutende deutsche Protagonisten. Da war zum einen Kaiser Friedrich Barbarossa, ein Hohenstaufer, Zeitgenosse des englischen Königs Heinrich II. Alle Berichte lassen auf eine charismatische Persönlichkeit von beeindruckend hohem Wuchs und mit dem berühmten roten Bart geschmückt schließen. Sein großes militärisches Können, das sich in wiederholten Feldzügen gegen die Lombarden von Norditalien zeigte, machte ihn in ganz Europa gefürchtet und geachtet. Wie andere europäische Herrscher seiner Zeit ließ auch er sich zum Kreuzzug verführen und starb auf dem Weg ins Heilige Land. Vermutlich ertrank er in einem Fluss in der heutigen Türkei. Doch als Legende lebte er fort – er sei, so hieß es, nicht gestorben, sondern warte nur tief in einer Höhle im Kyffhäuser, um wieder zu erscheinen, wenn Deutschland seiner bedürfe. Vielleicht wirft diese Legende ein Licht auf jene lang währende und langwierige deutsche Tragödie, die damals begann. Es sollte fast siebenhundert Jahre dauern, bis Deutschland wieder zu einer Einheit unter starker Hand zurückfand.
Zum anderen gab es Barbarossas Enkel, Kaiser Friedrich II., berühmt für seine Streitigkeiten mit diversen Päpsten und einen energisch geführten Kreuzzug. Doch seine in Italien und dem Mittelmeerraum erfolgreich betriebene Machtpolitik ließ ihn in Deutschland die Zügel schleifen. Gleichwohl war er ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Herrscher. Er sprach sechs Sprachen, darunter das Arabische. Sein Hof erlangte Berühmtheit über die Grenzen Europas hinaus, war er doch von kosmopolitischer Eleganz und zeigte des Kaisers Interesse für Wissenschaft und Kultur. Friedrich erhielt den Beinamen stupor mundi: das Erstaunen der Welt. Er residierte jedoch in Palermo auf Sizilien – weit entfernt von Deutschland, räumlich wie atmosphärisch. Er konnte dem düsteren und harten Leben nördlich der Alpen nichts abgewinnen. In Palermo lebte er im Überfluss und kommunizierte ohne Schwierigkeiten mit der gesamten Mittelmeerwelt, die damals noch das Gravitationszentrum Europas war. Im Gegensatz dazu war Deutschland eine eher trübe Alternative. Er reiste kaum einmal dorthin, und so konnten sich die zentrifugalen Kräfte ungehindert entfalten.
Allerdings förderte er eine Bewegung, die für sein Heimatland langfristig von großer Bedeutung sein sollte. Während seiner Regierungszeit begannen die Deutschordensritter damit, ihren Machtbereich an der Ostseeküste entlang weit nach Norden hin auszudehnen – ein Unternehmen, das zugleich missionarischen, kolonisatorischen und wirtschaftlichen Charakter besaß. Vom Gründungsgedanken her waren die Deutschordensritter ein religiös-militärischer Orden vergleichbar den Johannitern und Templern. Wie diese sollte der Deutsche Orden die Kreuzfahrer unterstützen. Als aber die christlichen Herrschaftsgebiete im Heiligen Land vor dem Zusammenbruch standen, suchte die Führerschaft des Deutschen Ordens neue Tätigkeitsfelder. Nach einigen Unternehmungen in Mitteleuropa entschied man sich dazu, die düsteren, unwirtlichen und gefährlichen Waldgebiete des Nordostens zu missionieren. 1226 unterzeichnete Friedrich II. die Goldene Bulle von Rimini, mit der dieser neue und so ganz anders geartete Kreuzzug begann. Er sollte erheblich erfolgreicher sein als alles, was je im Heiligen Land erreicht worden war.
Das erste Ziel waren die Stämme der Prußen. Sie waren noch Heiden, die Waldgötter verehrten, während das übrige Europa, Russland nicht ausgenommen, schon längst christlich geworden war. Die Prußen und ihre Sprache haben in der Geschichte keine weiteren Spuren hinterlassen bis auf den Namen der von ihnen bewohnten Region, mit dem später der mächtigste deutsche Staat benannt werden sollte. Aber das lag noch in weiter Ferne. Für die Ordensritter gab es einen sehr viel mächtigeren Feind als die Prußen: die weiter östlich lebenden litauischen Stämme. Auch sie waren Heiden.
Die geografischen Verhältnisse machten das Vorankommen nicht leicht, und das Klima war brutal. Ständig verschoben sich Einflusssphären und Machtgebiete. Der Expansion in Richtung Osten wurde durch eine russische Streitmacht unter Alexander Newski Einhalt geboten. In der Schlacht auf dem zugefrorenen Peipussee 1246 erlitten die Ordensritter eine empfindliche Niederlage; Sergei Eisenstein setzte dem Ereignis ein von der elektrisierenden Musik Prokofjews unterlegtes filmisches Denkmal. (Der See liegt heute im Grenzgebiet von Russland und Estland.) 1410 wurden die Ordensritter erneut vernichtend geschlagen. In der Schlacht von Tannenberg (auf Polnisch: Grunwald) errangen die verbündeten Polen und Litauer den Sieg. Diese zwei Schlachten spielen im Geschichtsbewusstsein Polens bzw. Russlands eine herausragende Rolle. Für die Deutschen war Tannenberg das entscheidende Desaster. Die Niederlage blieb unvergessen und war auch präsent, als es fünfhundert Jahre später, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, erneut zu einer Schlacht bei Tannenberg kam – diesmal zwischen Deutschland und Russland (Polen war zu der Zeit politisch nicht existent). Nun trugen die Deutschen den Sieg davon, und er schmeckte ihnen besonders süß.
Zwar läutete die Niederlage von Tannenberg 1410 nicht das Ende der Ordensritter ein, doch war ihre Expansionskraft gebrochen und sie stellten in der Region keine Bedrohung mehr dar. Immerhin konnten sie das bislang Eroberte sichern, und die Grenzen, die ihnen in den Auseinandersetzungen mit Litauern, Polen und Russen aufgezeigt worden waren, bestimmten nach und nach das Territorium eines deutschen Ostpreußens, das in den kommenden Jahrhunderten unheilvollen Einfluss auf das deutsche Selbstverständnis erlangen sollte – einen Einfluss, der das demografische Gewicht und die wirtschaftliche Bedeutung dieses Gebiets weit überstieg.
Während sich der deutsche Einfluss im Osten innerhalb dieser Grenzen konsolidierte, bahnten sich in den Kerngebieten grundlegende Veränderungen an. Die unterschiedlichen Fürstentümer gewannen stärkeres Profil, ihre Macht verfestigte sich und wurde institutionalisiert. Diese Vorgänge bildeten die Grundlage für die Entwicklung mächtiger Dynastien, die einige Jahrhunderte lang die Geschicke der deutschen Geschichte bestimmen sollten – in Österreich waren es die Habsburger, in Brandenburg die Hohenzollern, in Bayern die Wittelsbacher und in Sachsen die Wettiner. Zur nämlichen Zeit gewannen die Städte durch Handel und Finanzwirtschaft an Gewicht. Auch kam es zur Gründung von Universitäten, später zwar als in Frankreich und England, aber dann in rascherem Tempo: In den 150 Jahren bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts waren 14 Universitäten eingerichtet worden. Um 1450 begann in Mainz mit Gutenberg der Buchdruck. Es war dies die für viele Jahrhunderte wichtigste technologische Entwicklung; in ihrer Bedeutung mindestens vergleichbar mit der digitalen Revolution der Jetztzeit.
Damit waren in Deutschland vor dem Hintergrund eines von italienischen Denkern stark beeinflussten Renaissance-Humanismus geistige Gärstoffe in Gang gesetzt, die mithilfe der Druckerpressen in ganz Nordeuropa verbreitet werden konnten. Für die Kirche und das von ihr beanspruchte Monopol auf geistiges Leben stellte diese Entwicklung eine kaum zu bewältigende Herausforderung dar, war sie doch als Institution in vielerlei Hinsicht spirituell verknöchert, politisch kompromittiert und zudem korrupt. Vorboten künftiger Unruhen hatten sich schon in so unterschiedlichen Regionen wie England (die Lollarden) und Böhmen (Jan Hus) gezeigt, doch entzündeten sich die Gemüter schließlich an Roms Forderung, ehrgeizige päpstliche Bauprogramme zu finanzieren, wobei vor allem die Art und Weise der Gelderhebung – die als Ablasshandel bekannte Spekulation mit Aberglauben und religiöser Leichtgläubigkeit – Zorn erregte, der nirgendwo besseren Nährboden fand als in Deutschland. Auch dort war der Zunder trocken wie anderenorts. War der Zündfunke erst einmal übergesprungen, würden sich die Flammen rasant ausbreiten.
Es war, überlebensgroß, Martin Luther, der das Feuer entfachte. Auch wenn er seine berühmten 95 Thesen im Jahr 1517 vielleicht anders öffentlich gemacht hat als durch Annagelung an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg, verbreiteten sie sich überaus schnell in ganz Deutschland und Europa. 1520 verbrannte er öffentlich die päpstliche Bulle, die ihm den Kirchenbann androhte, wenn er seine Thesen nicht widerriefe. Was als Angriff auf die kirchliche Korruption begann, wurde zu einer Reformationsbewegung, die sich mit ungeahnter Geschwindigkeit ausbreitete – beflügelt auch von den neuen Medien der Flugblätter und Flugschriften, die schnell geschrieben und schnell gedruckt werden konnten. So geriet, was Luther als Reform lanciert hatte, zu einer die Kirche spaltenden Revolution.
Vermutlich wissen wir über Luther mehr als über fast jede andere Gestalt vor dem Beginn der Moderne. Wir sehen ihn vor uns in seiner vollen Leiblichkeit, kennen seine Flugschriften, Predigten, Kirchenlieder, Tischgespräche. Er war intelligent, leidenschaftlich, impulsiv, explosiv, mutig und beredsam. Als er 1521 vor den Reichstag zu Worms zitiert wurde, wusste er, dass er mit dem Auftritt dort sein Leben riskierte. Der neue Kaiser, der Habsburger Karl V., hatte, jung wie er war, mehr als genug Sorgen in seinem Riesenreich (er herrschte über Spanien und die Neue Welt wie auch über das Heilige Römische Reich). Insbesondere drohte im südöstlichen Europa die türkische Gefahr. Wittenberg dürfte für ihn kaum mehr gewesen sein als ein unbedeutendes Hinterlandstädtchen, und Luther eine Art Querulant, den man am besten beseitigte, so wie Jan Hus ein Jahrhundert zuvor verbrannt worden war. Luther wird sich dieser Gefahr bewusst gewesen sein, verweigerte aber den Widerruf. Seine trotzige Beharrlichkeit machte Geschichte – auch wenn nicht ganz sicher ist, ob er in Worms tatsächlich sagte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, so wahr mir Gott helfe. Amen.“
Luther besaß die instinktive Fähigkeit, sich in einer der breiten Bevölkerung verständlichen Sprache auszudrücken. Seine Bibelübersetzung setzte Maßstäbe für die deutsche Sprache. Das Neue Testament übertrug er, während er, beschützt durch den Kurfürsten von Sachsen, zu seiner eigenen Sicherheit 1522 auf der Wartburg versteckt war. Sein Einfluss auf das deutsche Selbstverständnis und Denken ist kaum abschätzbar. Er beschränkt sich nicht auf den lutherischen Protestantismus und ist nach wie vor von erheblicher Bedeutung. In Luthers Theologie trug einzig das Individuum vor Gott die Verantwortung für seine Lebensentscheidungen. Ein jeder glaubt für sich, so, wie ein jeder für sich stirbt. Der Christ lebt in zwei Reichen – dem Reich seiner Beziehung zu Gott und dem Bereich der irdischen Welt mit ihren Aufgaben und Pflichten. Luthers Gedanken hatten, wie wir noch sehen werden, enorme gesellschaftliche und kulturelle Auswirkungen.
Luther war es nicht um eine soziale Revolution im Sinne der Moderne zu tun. Bekanntermaßen ermutigte er Fürsten und Adel zur brutalen Unterdrückung des Bauernaufstands von 1525. (Einer seiner Anführer, Thomas Müntzer, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den ostdeutschen Kommunisten zum Helden und Märtyrer gemacht.) Berüchtigt sind auch Luthers höchst unerfreuliche Schriften gegen die Juden, insbesondere sein gefühlserregender Traktat Von den Jüden und iren Lügen (1543). Historiker streiten darüber, wie groß der Einfluss von Luthers Äußerungen auf die nur langsam sich verbessernde rechtliche Position der Juden im Reich war; doch haben sich in späteren Jahrhunderten bösartig Gesinnte eifrig auf Luthers Worte berufen.
Eine Reform der Kirche fand nicht statt – jedenfalls nicht in der Art, die Luther gewollt hatte. Stattdessen kam es zur Spaltung, zu heftigsten Auseinandersetzungen um Einzelheiten der christlichen Lehre (von denen einige uns heute unsäglich abstrus anmuten), zur Entstehung protestantischer Denominationen und schließlich zum Bürgerkrieg, als der Kaiser den Versuch unternahm, die religiöse Einheit wiederherzustellen. Das Ergebnis war ein Patt. Seinen Ausdruck fand es im Reichstag zu Augsburg 1555, wo entschieden wurde, dass jeder Fürst bestimmen konnte, ob sein Territorium protestantisch oder katholisch sein solle – cuius regio eius religio lautete das Prinzip. Abgesehen von der religiösen Bedeutung zeigte sich darin deutlich die Macht der Fürsten gegenüber der relativen Schwäche des Kaisers. Zwar war das Reich noch weit von seinem endgültigen Bedeutungsverlust für die deutsche Politik entfernt, doch war mittlerweile die Wahrscheinlichkeit mehr als gering, dass es in einen zentralisierten Staat à la Frankreich oder England transformiert werden, geschweige denn sich spontan dahin entwickeln könnte.
Zu eben dieser Zeit verschmolz das Luthertum mit der Kultur jenes Territoriums, das später Deutschlands mächtigster Staat werden sollte. Herzog Albrecht von Preußen, der als letzter Großmeister der Deutschordensritter zum Protestantismus übergetreten war, machte diesen als erster europäischer Herrscher 1525 zur offiziellen Religion seines Landes. Aber Ostpreußen gehörte nicht zum Reich, und die Bedeutung dieser preußischen Entscheidung für das gesamte Deutschland sollte sich erst sehr viel später herauskristallisieren.
Der Augsburger Religionsfriede hielt gut 60 Jahre, war aber nicht stabil. Zum einen waren keine rechtlichen Vorkehrungen für andere protestantische Kirchen getroffen worden, was insbesondere dem Calvinismus Schwierigkeiten bereitete, der in einigen Regionen mittlerweile eine wirkliche Macht darstellte und sich als radikalere Verwirklichung von Luthers Vision verstand. Hätte es ein Bündnis geben können? Zu bestimmten Zeitpunkten schien das möglich zu sein. Aber trotz einiger Brückenschlagsversuche war die religiöse Landschaft Deutschlands letztlich dreigeteilt. In dieser Spaltung schlugen sich die unterschiedlichen Entscheidungen der Herrscher und die jeweiligen Erfolge bei der Durchsetzung ihrer Überzeugungen nieder. Der damalige Status quo hat sich grosso modo bis zum heutigen Tag erhalten, womit Deutschland unter den großen europäischen Nationen einzigartig dasteht. Welchen sozialpsychologischen Einfluss das auf die Deutschen hatte, kann immer noch leicht unterschätzt werden. Im 19. Jahrhundert jedenfalls machte es den Weg zur Vereinigung sehr viel beschwerlicher.
Zunächst aber braute sich einige Jahrzehnte nach dem Augsburger Frieden großes Unheil zusammen. Die labile Machtbalance zwischen Protestanten und Katholiken im Reich wurde 1617/18 durch unsinnige konfessionelle Manöver gestört. Das Kräftemessen zwischen einem neuen, militant katholischen Herrscher in Böhmen und seinen protestantischen Adligen kulminierte im berühmten Prager Fenstersturz – und in einer Einladung, gerichtet an Friedrich, den calvinistischen Kurfürsten der Pfalz (und Schwiegersohn Jakobs I. von England), den Thron in Prag zu besteigen. Nur einen Winter dauerte seine Herrschaft, dann wurden die Protestanten von kaiserlichen Truppen vernichtend geschlagen. Dem Sieg folgte die Invasion der Pfalz. Vergleichbar den Torheiten und Fehlurteilen von 1914 wurde damit ein Krieg losgetreten, der viel länger währte, viel zerstörerischer und in seinen Folgen weitreichender war, als man zu Beginn vermutet hätte. Er sollte dreißig Jahre dauern.
Immer mehr deutsche Ländereien und Territorien wurden in den Kriegswirbel hineingezogen, immer mehr europäische Mächte mischten sich ein – vor allem Frankreich und Schweden. Als wären sie Darsteller in einer überdimensionierten, auf riesiger Bühne inszenierten Shakespeare-Tragödie, zeigten die Protagonisten dieses Kriegs so ziemlich alles, was an Emotionen, Ambitionen, Tor- und Bosheiten vorstellbar war. Da gab es die Leidensgestalt des „Winterkönigs“ Friedrich, der nach seiner Vertreibung aus Böhmen die westlichen Gebiete des Reichs durchwanderte und schließlich auf der Flucht in Mainz starb. Da war der von Hybris verblendete Generalissimus Albrecht von Wallenstein (dessen Schicksal der Stoff von Schillers Dramentrilogie Wallenstein ist). Da musste der charismatische schwedische König Gustav Adolf im Augenblick eines strategisch wichtigen Siegs auf dem Schlachtfeld sein Leben lassen. Und da waren all die anderen Herrscher und Generäle mit berechnenden Manövern und schwankender Loyalität, mit ihren verzweifelten Versuchen, Ereignisse in den Griff zu bekommen, die eine verwirrende Eigendynamik entfalteten.
Dem allen ausgeliefert waren die Millionen gewöhnlicher Leute, deren Leiden nur hin und wieder eine vernehmbare Stimme fand: die Soldaten (häufig Söldner aus allen Teilen Europas), die Bewohner jener zerstörten Städte, die einstmals europäische Handelszentren und Stätten geistigen Austauschs gewesen waren, und schließlich, wie immer, die unglückseligen Bauern. 1631 wurde Magdeburg von kaiserlichen Truppen heimgesucht: Das war der bildgewordene Schrecken schlechthin. Die Bürger wurden abgeschlachtet und die Stadt niedergebrannt – ein Ereignis, das sich in das Bewusstsein vor allem der protestantischen Deutschen so tief eingegraben hat wie die Plünderung von Drogheda durch Cromwell in das Gedächtnis der Iren. Das Verbum „magdeburgisieren“ hat Eingang in das deutsche Wörterbuch gefunden; es bezeichnet die rest- und gnadenlose Zerstörung. So starb Magdeburg im Feuersturm von 1631 zum ersten Mal – der zweite Tod kam 1945 und war noch furchtbarer.
Von den Erlebnissen der Einzelnen ist natürlich nur wenig auf uns gekommen. Aber ein bemerkenswerter Autor lässt uns am Leben der einfachen Leute teilhaben: Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen zeigt in seinem pikaresken Roman Die Abenteuer des Simplicissimus Teutsch, wie der Krieg mit den Menschen umgegangen ist. Auf recht robuste Weise rückt die Geschichte der Melancholie zu Leibe, die den Dreißigjährigen Krieg unvermeidlich in ein trübes Licht taucht. Zudem befördert sie das moralische und religiöse Nachdenken über menschliche Erfahrungen und die Notwendigkeit (und Möglichkeit) von Erlösung. Grimmelshausen schrieb auch eine sehr viel düsterere Erzählung, die in vergleichbaren Kriegsumständen spielt und deren Protagonistin die Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche ist. Sie trägt Soldatenuniform, gehört als Prostituierte zum Tross und kämpft jeden Tag ums Überleben. Die Geschichte kennt keine Lösung noch Erlösung: Courasche überlebt, weil sie eine Allegorie für die Verführungen dieser Welt ist. 300 Jahre später, am Vorabend eines neuen Kriegs, macht Bertolt Brecht „Mutter Courage“ zur Protagonistin einer weiteren Tragödie über die Schrecken des Kriegs, die Strategien des Überlebens und die augenscheinliche Sinnlosigkeit dieser Bemühungen. Letztlich versinnbildlicht sie die Begehrlichkeit der „kleinen Leute“, die den Krieg am Leben hält.
1648 endlich kam es zum Westfälischen Frieden. Er bestätigte im Großen und Ganzen das, was schon im Augsburger Religionsfrieden festgelegt worden war, nur dass jetzt die reformierte Kirche der Calvinisten Berücksichtigung fand. Zudem waren mittlerweile dynastische Interessen und die internationale Machtpolitik in den Vordergrund gerückt; konfessionelle Motive spielten bei Konflikten eher eine Nebenrolle. Im Reich lag die Macht nunmehr in den Händen der territorialen Herrscher, und auch der Kaiser selbst vertrat als Habsburger vorwiegend die Interessen seiner österreichischen (und sonstigen) Gebiete. Sachsen und Bayern fanden sich durch das Abkommen von 1648 gestärkt, und die Hohenzollern machten sich daran, ihre Besitzungen in Preußen, Brandenburg und einigen westlichen Territorien zu einem Staat zusammenzuschweißen, der zwei Jahrhunderte später ein vereinigtes Deutschland beherrschen sollte.
Und es gab weitere Veränderungen. Die wirtschaftliche Entwicklung Europas verlagerte sich von ihrem geografischen Zentrum – den deutschen Gebieten – zur Atlantikküste. Die deutschen Städte büßten ihre soziale Potenz, die sie noch im 16. Jahrhundert genossen hatten, allmählich ein. Davon profitierten die kleinen und großen Erbfürsten, die indes, sofern sie nicht das Erstgeburtsrecht (Primogenitur) in Anschlag brachten, Territorien in immer kleinere Erbstücke aufteilen mussten. Das war der Beginn der Kleinstaaterei* – der Entstehung von bisweilen winzigen Herzogtümern und Grafschaften. So zeigte die Landkarte Deutschlands zwischen den Territorien der größeren Mächte einen Flickenteppich von Fürstentümern im Duodez-Format.
Es begann das Zeitalter eines kulturell infizierten Absolutismus. Überall zeigten die Fürstenhöfe ihr diesbezügliches Engagement. Nicht nur in Wien, Dresden und München, auch in zweitrangigen Zentren wie Würzburg wurde gebaut, was das Zeug hielt – Kirchen, Paläste, überhaupt kulturelle Monumente aller Art. Ebenso gerieten Stadträte und Kirchenfürsten in Bauwut – überall erhoben sich neue und markante Zeichen einer kulturellen Energie, die von Italien genährt wurde und der sich katholische wie protestantische Zentren hingaben. Die Zeugnisse können wir heute noch bestaunen (viele mussten nach schrecklicher Zerstörung im Zweiten Weltkrieg restauriert oder komplett neu errichtet werden): Zwinger, Hofkirche und Frauenkirche in Dresden, die Theatinerkirche in München, Schloss Charlottenburg in Berlin, die Residenz in Würzburg (um nur einige architektonische Denkmäler zu nennen).
Das alles besagt nicht, dass es zu jener Zeit ein weiter verbreitetes Bewusstsein einer nationalen Identität des Deutschen gegeben hätte, die zu einem Auftritt auf der europäischen Bühne bereit gewesen wäre. Österreich war mit der osmanischen Bedrohung beschäftigt – 1683 standen die Türken vor den Toren Wiens. Niedergekämpft wurden sie von einer europäischen Streitmacht unter Führung des Königs von Polen; es war einer der bedeutenden Wendepunkte in der Geschichte Europas. Preußens Zeit war noch nicht gekommen; es fehlte ein Jahrhundert. Zwar konnte Schweden die westfälischen Verhandlungen als Gewinner verlassen, war aber nicht in der Lage, seine Besitzungen an der Ostseeküste gegen die rasch aufkommende Macht Preußens zu verteidigen. Die einzige Nation, die wirklich vom Westfälischen Frieden profitierte, war Frankreich – nunmehr Hegemonialmacht in Europa.
Unter Ludwig XIV. wurde Frankreich in Sachen Krieg zur führenden Nation Europas. Mit fast allen Nachbarn gab es bewaffnete Auseinandersetzungen; es waren komplexe Konflikte, die teils dynastischen Interessen, teils der nationalen Vergrößerung dienten. Insbesondere orientierte Frankreich sich schon bald nach Osten und verfolgte das ehrgeizige Ziel, zur Macht im Rheinland zu werden. Die Franzosen gaben das als Defensivmaßnahme aus, doch dürfte dies den Kaiser in Wien oder die deutschen Fürsten vor Ort kaum überzeugt haben. Bereits 1680 hatte Frankreich die historische Reichsstadt Straßburg besetzt, und kurz danach verwickelte es sich in einen Krieg im Rheinland, der neun Jahre währte. 1689 brannten französische Truppen in der Pfalz eine ganze Reihe deutscher Städte bis auf den Grund nieder – es war vielleicht die erste geplante Aktion „verbrannte Erde“. Der Krieg zog sich einige Jahre hin, aber Ludwigs brutale Strategie blieb letztlich erfolglos: Kaiserliche und lokale Streitkräfte leiteten wirksame Verteidigungsmaßnahmen ein, und die französischen Kräfte waren irgendwann erschöpft. Doch gab es zuvor noch ein weiteres einschneidendes Ereignis – 1693 verwüsteten französische Truppen Heidelberg. Bis heute steht die ausgebrannte Ruine des Schlosses über der schönen Universitätsstadt. Nun war der Keim gelegt für ein deutsches Opferempfinden – angereichert mit einem spezifisch antifranzösischen Groll.
Und er wuchs später zu äußerst giftigen Früchten heran. Es liegt geschichtliche Ironie darin, dass ein vereintes, aber unsicheres Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Notwendigkeit sah, in die Offensive zu gehen, und dafür, wie wir noch sehen werden, auch wieder das Bedürfnis nach Verteidigung und Defensive anführte. Doch davon war an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert noch keine Rede. Vielmehr hatte die französische Kultur auch in der Aufklärungszeit großen Einfluss auf intellektuelle Kreise und Fürstenhöfe in Deutschland. Gottfried Wilhelm Leibniz etwa verfasste viele seiner bedeutenden Werke in französischer Sprache. Die absolutistischen Herrscher der deutschen Territorien waren häufig große Bewunderer der französischen Kultur. Zu ihnen gehörte auch Friedrich der Große, der besser Französisch als Deutsch sprach und schrieb – und dies auch bevorzugte. Franzosen und Frankophile gehörten zu seinem Freundeskreis, unter ihnen der Dichter und philosophe Voltaire (mit dem er sich allerdings per Briefwechsel besser verstand als im direkten Gespräch).
Indes hatte diese kulturelle Affinität keinerlei Einfluss auf die machtpolitischen Beziehungen. Mehr als einmal kämpften im 18. Jahrhundert, in jener Zeit zwischen dem Ende der konfessionell bestimmten Konflikte und der Französischen Revolution, französische Armeen – typischerweise an der Seite anderer Deutscher – gegen preußische und weitere deutsche Truppen. Später erst sollten tiefsitzende Erinnerungen an den Dreißigjährigen Krieg und die französischen Verwüstungen im Rheinland eines deutschen Bewusstseins sich bemächtigen, das nach nationaler Einheit und Anerkennung verlangte und nun einen mit Groll angereicherten Opferstatus entwickelte. Sogar Preußens Friedrich, kein Herold nationaler deutscher Identität, wusste, was der „tödliche Prägestempel“ des Dreißigjährigen Krieges seinem Brandenburg angetan hatte. Doch wird die politische Bühne im Deutschland des 18. Jahrhunderts – mit einer wichtigen Ausnahme, auf die wir noch zu sprechen kommen – eher von wechselnden Machtverhältnissen im Gerangel der deutschen Staaten (häufig mit ausländischer Beteiligung) beherrscht als von äußeren Verwicklungen oder Angriffsgelüsten. Ansonsten wuchs Preußen auf Kosten anderer deutscher Mächte zur Hegemonialmacht heran.
Preußen wurde Europas modernster und am besten (durch)organisierter Staat, und mit seiner Stärke musste gerechnet werden. Friedrich der Große war ein kultivierter Herrscher – er spielte Flöte und komponierte Sonaten –, doch erwies er sich zugleich als aggressivster Potentat dieses Jahrhunderts.3 Schon im ersten Jahr seiner Regentschaft eroberte er das zu Österreich gehörende Schlesien mit seinen reichen Bodenschätzen und verschob so das wirtschaftliche Gleichgewicht der Mächte. Angriffslust lässt sich nicht so leicht befriedigen. Nach wenigen Jahren hatte Friedrich sich übernommen. Ein Überraschungsangriff auf das neutrale Sachsen (begleitet von der Beschießung Dresdens, die viele Kulturschätze vernichtete) führte zu massiven Vergeltungsschlägen. Als Österreich ein Bündnis mit Russland schloss, dem sich die allzeit bereiten Franzosen zugesellten, um dem preußischen Emporkömmling die Flügel zu stutzen, wurde Friedrich im Siebenjährigen Krieg fast in die Knie gezwungen.
Aber wir befinden uns noch in der Ära der dynastischen Herrscherindividuen mit ihren persönlichen Marotten: Als Preußen schon fast am Boden lag, starb die Zarin Elisabeth von Russland. Thronfolger war ihr Sohn, Peter III., ein Preußenfreund. Er scherte – Friedrichs Rettung – aus der Allianz aus, wurde jedoch bald zugunsten seiner Frau entthront, einer Deutschen, die dann als Katharina die Große Russland an der Seite von Österreich wieder in den Krieg zurückführte. Aber es war zu spät, Österreich war zutiefst erschöpft. Friedrich entging der Katastrophe und behielt Schlesien (das nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen abgetreten wurde).
Österreich war immer noch mächtig, aber im Hinblick auf das Reich keine Vormacht mehr. Überdies richtete es seine Interessen nun vornehmlich auf Mittel- und Südosteuropa, während Deutsche mittlerweile in den Habsburger Territorien die Minderheit waren. Einhundert Jahre später würde die deutsche Einheit ohne Österreich vollzogen werden und nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte das Land eine definitiv eigene, nicht deutsche Identität.
Ein weiterer Verlierer im deutschen Machtspiel war Sachsen, das sich von dem preußischen Überfall nie wieder vollständig erholen sollte. Als eines der Kurfürstentümer des Reichs konnte Sachsen auf eine große Vergangenheit zurückblicken – nicht zuletzt auf die Zeit, als der Kurfürst in einem entscheidenden Moment der deutschen Geschichte Martin Luther Schutz und Unterschlupf gewährte. Noch viel früher waren es sächsische Könige gewesen, die Deutschland nach dem Zusammenbruch des karolingischen Reichs geführt hatten. Und davor noch hatten sich Sachsen – zusammen mit Angeln und Jüten – in England niedergelassen, wo sie Städten und Grafschaften Namen gaben, die bis heute von ihnen künden. Im 18. Jahrhundert war der Hof der sächsischen Kurfürsten höchst kultiviert, und Dresden zählte zu den schönsten Städten Europas. Aber in der deutschen Politik würde Sachsen keine herausragende Rolle mehr spielen.
Immerhin gewann Sachsen die Unabhängigkeit zurück, die Friedrich dem Land hatte nehmen wollen. Und für einen Moment gab es die Hoffnung auf etwas Neues: Der Kurfürst Friedrich Christian war vom Denken der Aufklärung geprägt. Äußerst kultiviert und musikalisch begabt – wie Friedrich II. – hatte er zudem eine überaus klare Vorstellung von den Pflichten der Fürsten, die, wie er in seinem Tagebuch vermerkte, „für ihre Untertanen da sind, und nicht die Untertanen für ihre Fürsten“. Aber Friedrich Christian starb nach nur 40 Tagen seiner Herrschaft und lässt uns so mit der schmerzlichen Frage zurück, was hätte sein können, wenn … Danach bewiesen die sächsischen Fürsten weder Klugheit noch Stärke. In den Napoleonischen Kriegen unterstützten sie die Franzosen, was sie auf dem Wiener Kongress 1815 teuer zu stehen kam, verloren sie doch den größeren Teil ihres Territoriums an Preußen. Das Rumpfgebiet des Königreichs Sachsen wurde dann von Bismarck dem neuen Deutschen Reich einverleibt (blieb aber bis 1919 als Bundesstaat in Deutschland Königreich).
Bayern hingegen war zum Zentrum einer entschiedenen katholischen Gegenreformation geworden. Das Land hatte die Jesuiten nach Deutschland gebracht und im Dreißigjährigen Krieg mit aller Kraft gegen die Protestanten gekämpft. Es gelang ihm, sich territorial zu vergrößern und an Einfluss zu gewinnen, doch litt es auch unter den Launen der Wittelsbacher, deren Dynastie die Herrscher stellte. Einer von ihnen, Maximilian III. Joseph, unternahm in den 1760erund 1770er-Jahren ernsthafte Anstrengungen, die Finanzen zu stabilisieren und die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Ansonsten aber tat sich Bayern vor allem dadurch hervor, in fast jedem militärischen Konflikt die falsche Seite zu unterstützen. Wiederholt betrieben Bayerns Herrscher Machtpolitik mit bemerkenswerter Unfähigkeit. Einmal wollten sie sogar Österreich dazu bringen, im Austausch gegen dessen Besitzungen in Flandern (das heutige Belgien) Bayern den Anschluss an Österreich zu gewähren. Das hätte das politische Machtzentrum in Deutschland klarerweise wieder nach Wien verlagert. Friedrich der Große verlor keine Zeit, dem entgegenzuwirken. Er schmiedete ein Bündnis mit anderen deutschen Fürsten (darunter dem britischen König Georg III. in seiner Eigenschaft als Kurfürst von Hannover), um das Geschäft zu verhindern. In den Napoleonischen Kriegen aber ging die bayerische Politik schlauer und opportunistischer zu Werke, als die sächsischen Herrscher es taten. Bayern ins Reich zu holen, sollte sich denn auch für Bismarck als große Herausforderung erweisen. Bis heute zeigt Bayern in Deutschland mehr Eigenständigkeit als jede andere Region.
Deutschlands politische Zukunft wurde ab dem 18. Jahrhundert in den Geplänkeln zwischen Preußen und Österreich bestimmt. Doch waren sich beide nicht zu schade, bei der Teilung eines militärisch wehrlosen und politisch schwachen Polen mit Russland zusammenzuarbeiten. Das war die entscheidende Ausnahme für die Regel, dass die deutschen Staaten im 18. Jahrhundert nicht in ausländische Angelegenheiten verwickelt waren. In drei aufeinanderfolgenden Teilungen nahmen sich Polens Nachbarn, was sie brauchten. 1796 war es mit der polnischen Unabhängigkeit dann endgültig vorbei. Eine stabile und dauerhafte Eigenständigkeit würde es für die nächsten 200 Jahre nicht geben. Die Teilungen lohnten sich, besonders für Preußen. Das Gefühl, Opfer zu sein, das schon bald zu einem wichtigen Bestandteil des deutschen Selbstverständnisses werden sollte, schloss die Empathie für den Opferstatus der anderen großen Nation nicht ein. Und Polen blieb Opfer: Eineinhalb Jahrhunderte später machten sich Hitler und Stalin daran, Polen zu teilen – mit vergleichbarem Zynismus, aber ungleich größerer Brutalität.
Kulturell war die Ära der Aufklärung in Deutschland wie auch anderswo eine Zeit geistiger und spiritueller Gärung; doch lag der Wandel schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts in der Luft. Leibniz, der zeitgleich mit Isaac Newton die Infinitesimalrechnung entwickelte, war gleichermaßen Naturwissenschaftler, Ingenieur und Philosoph. Er war der Erste in einer Reihe bedeutender Persönlichkeiten, die dafür sorgten, dass die deutsche Kultur in ihrem denkerischen und schöpferischen Beitrag zur Moderne unübertroffen blieb.
Insbesondere war es Immanuel Kant, der die Gedankenwelt des 18. Jahrhunderts beherrschte. Mehr als jeder andere Philosoph bestimmte dieser Mann, der nie heiratete oder verreiste und sein ganzes Leben im ostpreußischen Königsberg verbrachte, die späteren Debatten über Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik und Religion. Sein Einfluss – sei er direkt oder indirekt, anerkannt oder unerkannt – auf viele geistige Auseinandersetzungen überall auf der Welt ist unbestreitbar. Insbesondere seine Wirkung auf das Selbstverständnis der intellektuellen Eliten in Deutschland vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute ist nur mit der von Luther zu vergleichen.
Das geistige Leben blühte in vielen Formen auf: Im Zeitalter der Aufklärung interessierte man sich auch für Mystik oder Freimaurerei, und nicht wenige suchten nach authentischer religiöser Erfahrung. Davon zeugt die Ausbreitung des Pietismus im protestantischen Deutschland. (Seine Bedeutung für die romantische Bewegung wird in einem späteren Kapitel deutlich.) Ganz grundsätzlich war es für Deutschland eine Blütezeit der Kultur, die ihren Ausdruck in Philosophie und Literatur, in Architektur, Naturwissenschaft, Musik, Forschungsreisen und einer neuen Faszination für Geschichte fand. Nicht zufällig war es auch die Zeit, in der deutsche Intellektuelle sich der deutschen Sprache bedienten, statt auf Latein oder Französisch zu schreiben; und sie fragten sich nun auch, welche Bedeutung eine deutsche Identität haben könnte, wo ihre Ursprünge lägen und wie sie auf der europäischen Bühne verwirklicht werden könnte und sollte.
Nur wenige ahnten die Ereignisse von 1789 voraus; keiner konnte mutmaßen, was für ein Erdbeben die Französische Revolution auslösen würde. In Deutschland verbanden sich mit ihr große Hoffnungen, denen eine ebenso große Enttäuschung folgte. Uns Heutigen fällt es, nach über 200 Jahren und so vielen Erfahrungen mit Revolutionen, Aufbrüchen ins Neue und Gewalt schwer, uns in die Lage derer zu versetzen, die so entzückt auf die jäh sich bietenden Möglichkeiten reagierten. Liberté, fraternité, égalité – diese Trias ist heute ein Klischee. Damals aber waren damit große Erwartungen verknüpft. Ein neuer Kalender mit neuer Zeitrechnung wurde eingeführt; alles sollte von null an beginnen. Es war die erste große Revolution der modernen, urbanen Welt. Das Ancien régime mit seinen Machtstrukturen und Vorurteilen wurde hinweggefegt. Endlich triumphierte die Vernunft. Für Deutschland, hofften einige, könnte das nicht weniger als die Verwirklichung einer neuen Identität im Zeichen der Freiheit bedeuten.
Die Enttäuschung war bitter. 1792 erklärte die neue französische Republik Österreich den Krieg und zeigte ein erstaunliches Maß an militärischer Effektivität, als die republikanischen Truppen zunächst die Armeen Preußens und Österreichs zurückschlugen und dann den Kampf in die Niederlande und das Rheinland trugen. Zu dieser Zeit entstand die Marseillaise – sicher eine der blutrünstigsten Nationalhymnen überhaupt – und wurde zunächst als Chant de guerre de l’armée du Rhin (Kriegslied der Rheinarmee) gesungen. Blutige Kämpfe um Ziele und Zwecke der Revolution lösten in Frankreich Terror und Chaos aus, bis schließlich Napoleon als Diktator und dann als von eigener Hand gekrönter Kaiser im Inneren für Ruhe sorgte. Sein expansionistisches Streben, sein militärisches Können, sein Reformeifer und seine schiere Unbezähmbarkeit wirkten sich in und auf ganz Europa aus und sollten Deutschland unwiderruflich verändern.
In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts marschierten französische Armeen fast unablässig nach Osten und brachten Deutschland den bitteren Geschmack von Niederlagen und Erniedrigung. Österreich wurde 1805 in der Schlacht von Austerlitz auf die Knie gezwungen, Preußen im darauffolgenden Jahr bei Jena und Auerstädt. Napoleon schuf mit dem Rheinbund 1806 eine neue Konföderation deutscher Fürstentümer als Vasallenstaaten. Im selben Jahr wurde das Heilige Römische Reich Deutscher Nation formell aufgelöst. Damit endete die über 800 Jahre währende Geschichte einer überaus komplizierten politischen Konstruktion, die schließlich den Herausforderungen der napoleonischen Umwälzung nicht mehr gewachsen war. Diese Umwälzung betraf direkt die Identität Deutschlands. Zwanzig Jahre französischer Herrschaft veränderten das Rheinland durch die Neuorganisation von Regierungstätigkeit, Verwaltung und Rechtssystem von Grund auf und unwiderruflich.
Noch grundlegender stellte sich angesichts der napoleonischen Herausforderung die Frage: Wer sind die Deutschen? In allen ostwärts gerichteten Feldzügen Napoleons fochten deutsche Truppen auf der Seite der Franzosen; in großer Zahl waren sie auch in der Grande Armée präsent, die 1812 in Russland einmarschierte. Im nächsten Jahr sahen sich die geschwächten Franzosen einer neuen Koalition gegenüber, der Russland, Preußen, Österreich und Schweden angehörten. Selbst da noch kämpften deutsche Truppen für Frankreich: Die Sachsen hatten, im Gegensatz zu den Bayern, nicht Verstand genug gehabt, um die Seiten zu wechseln. Die französischen Streitkräfte wurden in der Völkerschlacht von Leipzig 1813 entscheidend geschlagen. Immer drängender stellte sich die Frage: Wie konnte es sein, dass Deutsche auf deutschem Boden für ausländische Interessen gegen Deutsche kämpften? Durch Napoleon war die Frage nach der deutschen Identität in den Brennpunkt gerückt, und dort sollte sie auch bleiben.
Binnen eines Jahres konnte die von Russland angeführte Koalition in Paris einmarschieren, und alles schien vorbei. Doch gab es noch ein letztes und potenziell besonders gefährliches Hurra, die berühmten „Hundert Tage“. Aber Napoleon unterlag bei Waterloo, und es waren, wie man weiß, preußische Truppen, die Wellington zum Sieg verhalfen.
Mittlerweile hatte sich die Welt verändert. Neue Sehnsüchte regten sich im Bewusstsein der Deutschen, genährt von einer reichen – und überaus deutschen – Mahlzeit: Da gab es eine romantische Bewegung, die sich mit neuem Stolz Deutschlands Ruhm im Alten Reich und seinen schönen Landschaften zuwandte; da gab es ferner eine industrielle Revolution, die später begann als die englische, bald aber mit Volldampf voraneilte; da gab es die starke Neigung für die Kultivierung des Ostens (eingedenk des von den Ordensrittern hinterlassenen Erbes, bewahrt von pflichtbewussten lutherischen Protestanten und genährt von Herrschern, die neue Siedler dazu ermutigten, das Land urbar und sich zu eigen zu machen); da gab es schließlich den Groll auf das Fremde – vor allem auf die Franzosen wegen der erlittenen Demütigungen und des Raubs von Ländereien westlich des Rheins. Opfer war man gewesen, und die Erinnerung daran wurde gehegt, doch nun schlug das Verlangen nach bislang vorenthaltener nationaler Identität immer tiefere Wurzeln.
1815 ging der Wiener Kongress zu Ende. Zu seinen Ergebnissen gehörte die Einrichtung eines Deutschen Bundes, dessen Grenzen ungefähr denen des Heiligen Römischen Reichs entsprachen. Allerdings hatten seine zwei mächtigsten Mitglieder, nämlich Österreich und Preußen (die zudem umfangreiche Territorien außerhalb dieser Grenzen besaßen), nicht die Absicht, radikale politische Reformen zu fördern oder den Bund zu einem tatsächlichen vereinten deutschen Staatswesen werden zu lassen. Die Vertreter der alten Ordnung – deren Verkörperung der erzkonservative österreichische Minister Metternich war – zögerten nicht, nationalistische Studentengruppen, die sich an manchen Universitäten ausgebreitet hatten, zu unterdrücken und als unzuverlässig eingeschätzte Professoren zu entlassen. Zugleich wurde die Zensur verschärft.
In den folgenden Jahrzehnten wurde das Streben nach Einheit unterdrückt, selbst nach 1848, als eine weitere Revolution in Frankreich zu größeren Aufständen in Deutschland führte. Immerhin schien für eine gewisse Zeit die Entstehung eines vereinten Deutschlands möglich zu sein. In Frankfurt am Main, der ehemals freien Reichsstadt, trafen sich Abgeordnete aus den verschiedenen deutschen Territorien, um eine Verfassung zu schmieden, die ein Reich mit Erbkaisertum und zu wählender Legislative vorsah. Doch wäre diese Initiative nur dann erfolgreich gewesen, wenn Preußen und Österreich sie unterstützt hätten. Das aber geschah nicht. Eine Reihe von tragikomischen Wirrnissen und Fehlern führte dazu, dass revolutionäre Aufstände in Wien und Berlin (wie auch in anderen, kleineren Staaten) scheiterten. Zudem waren weder der österreichische Kaiser noch der preußische König bereit, dem Frankfurter Parlament irgendwelche Befugnisse in ihren Herrschaftsbereichen einzuräumen. Im Hinblick auf Österreich kam noch eine weitere, unüberwindliche Schwierigkeit hinzu: Die Habsburger Herrschaftsgebiete wurden von einer mehrheitlich nicht deutschen Bevölkerung bewohnt. Alle diese Territorien in ein geeintes Deutschland zu integrieren, würde auf ein künstliches Gebilde hinauslaufen (und es ließe sich angesichts der Unabhängigkeitsbestrebungen der Ungarn und Tschechen auch kaum denken). Es war klar, dass der österreichische Kaiser einer Teilung seines Reiches niemals zustimmen würde. Die Versammlung in der Frankfurter Paulskirche verlor an Schwung und schließlich auch an Leben. Gern wären die Abgeordneten Vertreter eines neuen deutschen Reichs geworden, aber nun mussten sie unverrichteter Dinge heimwärts ziehen. Das Experiment war gescheitert und die Herrschenden kehrten zwar nicht zum Status quo ante zurück, setzten aber auf eine Art von Stagnation, die wirtschaftliche Entwicklung, aber so gut wie keinen politischen Wandel erlaubte.
Doch ließ sich das Verlangen nach nationaler Identität und Einheit nicht ersticken. Unterdessen nahmen die Modernisierungskräfte der industriellen Revolution an Geschwindigkeit zu und trieben die wirtschaftliche Integration ebenso voran, wie sie eine neue Bourgeoisie schufen, die nach politischem Einfluss strebte. 1834 wurde unter preußischer Federführung der Deutsche Zollverein geschaffen, dem bald alle Mitglieder des Deutschen Bundes – mit der bedeutenden Ausnahme von Österreich – angehörten. Es war nicht zu übersehen, dass der Zollverein das Vorspiel für eine später mögliche politische Vereinigung darstellte. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes beschleunigte die Urbanisierung und Industrialisierung (stärker als in Großbritannien schuf die Eisenbahn in Deutschland die Nachfrage nach Industrieerzeugnissen, statt eine Reaktion auf gesteigerte Produktivität zu sein) und verband die deutschen Regionen miteinander. Zudem eröffneten sich dadurch militärische Möglichkeiten, die niemand so gut bewerten konnte wie deutsche Taktiker. Obwohl der Terminus „militärisch-industrieller Komplex“ dem US-amerikanischen politischen Diskurs der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstammt, lässt er sich ohne Schwierigkeiten auch auf die gleichermaßen industriellen wie militärischen Ambitionen der preußischen Elite in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beziehen.
Gab es im 18. Jahrhundert ungeahnte Entwicklungen im intellektuellen Bereich, so war das 19. Jahrhundert eine Zeit beispiellosen sozialen Wandels. Vorangetrieben wurde er durch die mit der industriellen Revolution einhergehende Urbanisierung. Der wachsende Einfluss eines neuen Bürgertums machte sich bemerkbar – zwar nicht so sehr im politischen Bereich, wo das wiederholte Scheitern von revolutionären Bestrebungen die Stimmen, die Wandel forderten, nur sehr gedämpft ertönen ließ, aber in der Welt der Kultur. Die Jahre nach dem Wiener Kongress waren die Zeit des bürgerlichen Biedermeier*: Nun schätzte man eine geordnete, fromme Häuslichkeit, in der das Seelenleben sich entwickeln und vervollkommnen konnte. Beispiele dafür lassen sich in der Literatur, der Kunst, der Architektur, im Kunsthandwerk und bis zu einem gewissen Grad in der musikalischen Entwicklung jener Periode finden. Damals erwachte auch ein neues Interesse an deutscher Geschichte, an ihren Legenden und volkstümlicher Überlieferung. Besonders die romantische Kunst feierte und popularisierte in zahllosen Werken diese Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Diese Bewegung verband sich aufs Engste mit dem wachsenden Streben nach nationaler Identität, das auf ganz natürliche Weise Bestandteil eines europäischen Bewusstseins war und Widerhall bei so unterschiedlichen Völkerschaften wie den Italienern, Ungarn und Polen fand. Und auch die Briten übten sich, angefeuert durch die Napoleonischen Kriege, in patriotischem Stolz.
Diese kulturelle Kreativität wuchs auf dem Fundament einer augenscheinlich selbstzufriedenen Bourgeoisie, deren wirtschaftliches Wohlergehen sich den Früchten der industriellen Revolution verdankte. Zugleich aber wuchs, wie sich zuerst an Großbritannien zeigte, die Zahl der armen Leute in Stadt und Land, die wiederum diesen Reichtum bedrohte. Dem Aufstand der schlesischen Weber 1844, bei dem Besitz und Maschinen zerstört und Menschenleben dahingerafft wurden, begegnete man mit brutaler Unterdrückung. Aber er versetzte die politische Führung und die Bourgeoisie in Angst und Schrecken. Wiederholt nahmen Literatur und Kunst sich seiner an – stellvertretend für viele andere seien hier Heinrich Heine, Gerhart Hauptmann und Käthe Kollwitz genannt. In Deutschland wie anderenorts brachten Urbanisierung und Industrialisierung in raschem Tempo eine Arbeiterklasse hervor, deren Bewusstsein in mehreren Persönlichkeiten eine Stimme fand, die im Zusammenhang mit der Revolution von 1848 die politische Bühne betraten. Allen voran wurden Karl Marx und Friedrich Engels später weltweit berühmt als Verkünder einer neuen Lehre – des Kommunismus. Allerdings betrieben sie ihre wichtigsten Studien in London. Für die deutschen Zusammenhänge waren Ferdinand Lassalle, August Bebel und andere wichtiger. Ihre politische Tätigkeit, die häufig von hitzigen Debatten und Streitereien begleitet wurde, führte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Herausbildung der Sozialdemokratie.
In Deutschland wie auch sonst in den urbaner werdenden Gesellschaften der damaligen Zeit entwickelte sich ein lautstarker Pluralismus, dessen Vertreter indes in den Schatten jenes Mannes gerieten, der in der zweiten Jahrhunderthälfte die deutsche – und europäische – Bühne betrat, um die Einigung Deutschlands zu bewerkstelligen: Otto von Bismarck.
In den entwickelten Staaten Europas sah sich die politische Führung vor die Herausforderung gestellt, mit tiefgreifendem sozialen Wandel, einer vernehmbar sich äußernden medialen Öffentlichkeit und immer deutlicheren Forderungen der urbanen Klassen umzugehen. In Deutschland kamen noch die mit den Fragen von Identität und Einheit verbundenen Probleme hinzu. Wie Bismarck mit all diesen Herausforderungen fertig wurde, ist mehr als erstaunlich. Seiner Einstellung nach war er ein Konservativer, für den die politische Führung der Nation in den Händen einer Elite aus Großgrundbesitzern und Militärs liegen sollte, während die wirtschaftliche Entwicklung von bürgerlichen Kapitalisten und Händlern vorangetrieben wurde. Für die Arbeiterklasse traf die Regierung eine Reihe von Vorkehrungen, zu denen ein angemessenes Bildungs- und Erziehungssystem ebenso gehörte wie ein weltweit erster Wohlfahrtsstaat mit allgemeiner Gesundheits-, Unfall- und Altersvorsorge. Dank dieser Errungenschaften wuchs Deutschland in den Jahrzehnten bis zum Ersten Weltkrieg zur stärksten Wirtschaftsmacht in Europa heran.
Doch liegt Bismarcks historische Bedeutung mehr noch in dem, was er auf der europäischen Bühne erreichte. In der bemerkenswert kurzen Zeit von neun Jahren nach 1862, als er zum Ministerpräsidenten Preußens berufen wurde, spielte er in der internationalen Politik wie ein Schachgroßmeister. Die Vereinigung Deutschlands konnte, dazu war er entschlossen, nur unter preußischer Führung (und Vorherrschaft) vonstattengehen. Auf dem Weg zu diesem Ziel musste er drei Probleme lösen, die die territoriale Ausdehnung der zukünftigen deutschen Nation betrafen: Zum einen ging es um die Nordgrenze zu Dänemark, zum anderen um die Frage der Zugehörigkeit Österreichs und zum Dritten um die Beziehung mit dem alten Feind der Deutschen – mit Frankreich. Bismarck bewältigte alle drei Probleme mit Entschiedenheit.
Zunächst manipulierte er das berüchtigt verwickelte Problem der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Den Krieg gegen Dänemark gewann Preußen mit österreichischer Unterstützung, und die beiden Herzogtümer wurden der gemeinsamen Verwaltung von Preußen und Österreich unterstellt. Dann aber kam es zu Unstimmigkeiten, die Bismarck den idealen Vorwand für einen Krieg mit den Österreichern lieferte. In der Schlacht von Königgrätz 1866 erlitt Österreich eine verheerende Niederlage. Zum letzten Mal waren Deutsche auf dem Schlachtfeld gegeneinander angetreten. Allerdings spielte Österreich nun auch keine Rolle mehr im Vereinigungsprozess, der, wie von Bismarck vorgesehen, gemäß den Bedingungen Preußens stattfinden würde – also ohne Österreich. Dann ging Bismarck daran, Preußen jene norddeutschen Staaten einzuverleiben, die den Fehler begangen hatten, an der Seite Österreichs zu kämpfen. An erster Stelle stand hier das Königreich Hannover mit seinen umfangreichen Schätzen, die Bismarck später unauffällig nutzte, um König Ludwig II. von Bayern zu belohnen, hatte dieser doch die Nominierung des preußischen Königs Wilhelm I. als Kaiser des Deutschen Reichs unterstützt. (Die geheimen Zahlungen an Ludwig wurden bis zu dessen Tod im Jahre 1886 fortgesetzt. Sie dienten dem bayrischen König, der der Romantik anhing und der Melancholie verfallen war, unter anderem zur Finanzierung des Märchenschlosses Neuschwanstein sowie der Unterstützung Richard Wagners und seiner ehrgeizigen Pläne für den Bau einer Oper in Bayreuth.)
Nun galt es noch, das Verhältnis mit Frankreich zu klären. Mit meisterhafter Ranküne bereitete er den Konflikt vor, indem er dynastische Probleme in Spanien ausnutzte, um den politisch unbedarften französischen Kaiser Napoleon III. zur Kriegserklärung zu reizen. Der Waffengang war noch kein deutscher Blitzkrieg, endete aber mit einer eindeutigen Niederlage Frankreichs. Bismarck hatte zusätzlich Glück: Napoleon III. wurde gestürzt und in Paris eine neue Republik ausgerufen, Frankreich war isoliert und konnte von keiner Macht in Europa Unterstützung erwarten. So war dieser „nationale vaterländische Krieg“ für das neue Deutsche Reich durch und durch ein Erfolg. In den Friedensverhandlungen gelang es Bismarck, das Elsass und große Teile Lothringens zurückzuholen. Außerdem verpflichtete sich Frankreich zu umfangreichen Reparationszahlungen (berechnet pro Kopf der französischen Bevölkerung, als genaues Äquivalent der 1807 von Napoleon für Preußen pro Kopf erhobenen Steuer). Alte Rechnungen waren damit beglichen. Frankreich erntete den von Ludwig XIV. und Napoleon gesäten Sturm, und schon war neue Saat für einen weiteren Sturm ausgebracht worden – diesmal von den Deutschen. Nur wenige Deutsche erkannten, um nur ein Beispiel zu nennen, wie stark die republikanischen Gefühle im deutschsprachigen Elsass waren. Frankreich würde die Annexion weder vergeben noch vergessen. Das bekam Deutschland 1918 bitter zu spüren. Rache brütet Rache aus.
Aber die seit Langem im Raum stehende Frage der deutschen Identität hatte endlich eine Antwort gefunden. Die war gesucht worden, seit das Heilige Römische Reich Jahrhunderte zuvor zu schwächeln begonnen hatte – und ab dem 18. Jahrhundert hatte sich die Frage immer lauter und dringlicher vernehmen lassen. Doch nicht nur in Deutschland strebte man nach nationaler Identität. In diversen Habsburger Herrschaftsgebieten rumorte es. Für Polen erhob Adam Mickiewicz seine Stimme im Pariser Exil. Und das italienische Risorgimento sorgte für Dramatik und Aufregung in ganz Europa. Auch hier fand sich eine Stimme, die so schön wie verhüllt davon sang – Giuseppe Verdis Va pensiero. Doch das deutsche Streben war anders orchestriert; es klang nach Tragödie. Die deutsche Lösung sah nicht aus wie die Verwirklichung eines Traums, sondern war eher das Ergebnis einer Reihe exakt berechneter Manöver zur Sicherung der Vorherrschaft Preußens und preußischer Werte. Das Ethos des neuen Reiches glich nicht dem Sonnenaufgang des italienischen Risorgimento, sondern war politisch-klimatisch eher ostpreußisch orientiert – streng, rigoros, militärisch, lutherisch in seinem Bewusstsein von Ordnung und Pflicht.
Zudem war dieses neue Deutschland wenig stabil. Als es nach langen Jahrzehnten enttäuschter Hoffnungen schließlich als „Deutsches Kaiserreich“ in die Welt trat, sah es ein wenig wie ein Bastard aus: Es war einesteils demokratisch, anderenteils autokratisch, vereint, aber ohne die österreichischen Deutschen, ohne Begeisterung begrüßt von einer väterlichen Schar deutscher Könige und Herrscher im Schatten Bismarcks – und proklamiert auf französischem Grund und Boden, im Schloss von Versailles und im Gefolge eines überwältigenden militärischen Siegs. All dies konnte in Europa wenig Vertrauen erwecken: Deutschland war offensichtlich kriegslüstern und triumphalistisch, andererseits aber in sich uneins und unsicher. Europa war nervös.
Unter den richtigen Bedingungen hätte sich die Regierungsform des Kaiserreichs entweder auf die britische Weise einer durch Wahl bestimmten parlamentarischen Regierung oder nach dem amerikanischen Modell einer getrennt wählbaren Exekutive und Legislative entwickeln können. Doch das deutsche politische System war keins von beiden: Die Regierung musste ihren Haushalt vom Reichstag autorisieren lassen, der direkt gewählt wurde, wobei das Wahlrecht zwar allgemein, aber nur den Männern vorbehalten war. Der Reichskanzler wiederum wurde vom Kaiser ernannt und war auch nur diesem verantwortlich, ebenso wie das Militär. Das verminderte die Bedeutung des allgemeinen Wahlrechts beträchtlich, wie auch die Tatsache, dass es in Preußen, dem geografischen und politischen Kern des Reichs, ein die konservativen und militärischen Kräfte begünstigendes Dreiklassenwahlrecht gab. Die Trennung von militärischer und ziviler Amtsgewalt war einer der „entscheidenden Mängel“4 der preußischen Verfassung gewesen, was nun auch für die Verfassung des Kaiserreichs galt. Streitigkeiten wegen des Militärhaushalts wurden zum ständigen Merkmal der Innenpolitik. Weil es nicht gelang, das Militär wegen seines Verhaltens in den Kolonien oder hinsichtlich des politisch noch viel sensibleren Umgangs mit dem Elsass zur Verantwortung zu ziehen, geriet Deutschland in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg auf der europäischen Bühne zunehmend in den Ruf, unangenehm und aggressiv zu sein.
Inwieweit die Politik des Kaiserreichs wirksam und gar vernünftig war, hing gemäß Bismarcks Konstruktion in erster Linie von der Beziehung zwischen Kaiser und Kanzler ab. Verfügte wenigstens einer von beiden über Stärke und Klugheit, war damit eine effiziente Innen- und Außenpolitik gewährleistet. In den ersten 17 Jahren des Reichs sorgte die Beziehung zwischen dem alten Kaiser Wilhelm I. und einem die Richtlinien der Politik bestimmenden Bismarck für diese Effizienz. Wilhelm I. starb im Alter von 90 Jahren und sein Nachfolger, Friedrich III. (verheiratet mit Vicky, der ältesten Tochter von Königin Victoria), war bereits vom Krebs gezeichnet, als er den Thron bestieg, den er nur 99 Tage innehatte. Ihm folgte, als Wilhelm II., sein Sohn. Der aber war prunkliebend, unreif, impulsiv und unsicher. Er war die Galionsfigur des Kaiserreichs bis zu dessen Zusammenbruch 1918. Bismarck wurde 1890, nach fast 30 Jahren praktisch unumschränkter Vorherrschaft, in knapper Form entlassen. Keiner seiner Nachfolger hatte die Statur oder politische Klugheit, dem Kaiser und den Militärs eigenes Gewicht entgegenzusetzen (Wilhelm II. war zwar militärischer Oberbefehlshaber, wurde aber zunehmend von seinen Generälen beherrscht).
Es war letztlich nur eine kleine Gruppe von Männern (in einer ohnehin männlich dominierten Gesellschaft), die alle außen- und militärpolitischen Entscheidungen traf: Kaiser Wilhelm II., eine Reihe von Kanzlern mit jeweils variierendem Einfluss und eine Clique militärischer Führungsgestalten. Sie sahen sich als die Vertreter einer Gesellschaft, die ihnen zufolge konservativ und harmonisch zu sein hatte. Doch waren sie sich – der eine mehr, der andere weniger – der wachsenden Spannungen in einer rasch sich wandelnden Gesellschaft bewusst und eben deshalb von Furcht erfüllt.
Oberflächlich gesehen mochte Deutschland auftrumpfend und technokratisch wirken, tatsächlich aber wirkte im Innern ein gefährlicher Cocktail aus Enttäuschung, romantischen Sehnsüchten und Ressentiments. Wie wir noch sehen werden, ließ sich mit zunehmender Deutlichkeit die Stimme eines aggressiven Nationalismus hören (die immer häufiger antisemitische Tonlagen bevorzugte). Sie verkündete, dass Deutschlands Zeit nunmehr gekommen sei. Hinzu kam Bismarcks vielleicht schwerwiegendster innenpolitischer Fehler. Mit dem sogenannten Kulturkampf* führte er einen äußerst aggressiven Angriff auf die katholische Kirche – einen Kampf, der gesellschaftlich und regional zu Spannungen führte und schließlich kraftlos versandete, wobei er jedoch in der großen Gemeinschaft der deutschen Katholiken Groll und Misstrauen gesät hatte. Auch gab es nunmehr ein Gesetz, demzufolge es ein Verbrechen war, wenn Geistliche die Kanzel für politische Äußerungen nutzten, die den inneren Frieden gefährden konnten. Das Gesetz wurde später von den Nationalsozialisten gegen katholische Geistliche verwendet und erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgehoben.
Dies war nur einer von mehreren Rissen in einem System, das die herrschende Elite als nationale Identität ansah. Über den religiösen und regionalen Unterschieden erhob sich eine Klassenstruktur, die zunehmend unter Druck geriet. Die Bedrohung kam indes nicht vom gebildeten Bürgertum. Sicher hätte es Zugang zu den politischen Machthebeln finden können, die zu bedienen ihm die Verfassung des Reichs verwehrte, doch hatte der Staat den Bürgern für ihre Geschäfte ein rechtlich gesichertes Umfeld geschaffen. Ihnen gehörte das Kapital, das die industrielle Revolution vorantrieb; der Ausbau von Infrastruktur und Militär schuf Wachstum; und auf der lokalen Ebene war ihr politischer Einfluss – formell oder informell – enorm. Sie beherrschten Städte und Gemeinden nicht nur wirtschaftlich, sondern auch durch ihre Präsenz in den kommunalen Vereinigungen. Freiwilligenverbände gab es in Hülle und Fülle: Berufs- und Wohlfahrtsverbände, Musik- und Sportvereine. Überall war das Bürgertum vertreten, stärker als in jedem anderen Land. Doch waren diese Bürger nicht so zufrieden und selbstbewusst, wie man angesichts ihrer starken gesellschaftlichen Stellung hätte annehmen können. Ihre Vorherrschaft schwächte sich in dem Maße ab, in dem andere Stimmen in den Vordergrund drängten. Daraus resultierte eine Art von Kulturpessimismus, wie er sich etwa in Oswald Spenglers Werk Der Untergang des Abendlandes manifestierte. Derlei Auffassungen waren nicht auf Deutschland beschränkt, hier jedoch, angesichts der spektakulären Erfolge in Wirtschaft und Industrie und der auftrumpfenden Selbstdarstellung des Reichs, von einer gewissen Ironie.
Allerdings führten solche Selbstzweifel nicht dazu, für die Interessen des Bürgertums eine größere Beteiligung an der politischen Macht zu fordern. Die Bedrohung des konservativen Gesellschaftsmodells ging von drei Gruppen aus, die sich (wie auch in anderen Staaten Europas) mittlerweile deutlich bemerkbar machten: die Bauernschaft, das Kleinbürgertum und die Arbeiterklasse. Die Bauern hatten mit sinkendem Einkommen, steigenden Schulden und der Ausbeutung durch die Junker und die urbanen Eliten zu kämpfen, und ihre Unzufriedenheit wuchs entsprechend dem Fortschritt der Urbanisierung. Die Kleinbürger waren durch die wirtschaftlichen Erschütterungen, die während der ersten Jahre des Kaiserreichs ganz Europa durchgerüttelt hatten, schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Es war die erste einer ganzen Reihe von Krisen des globalen Finanz- und Wirtschaftssystems, die den Kapitalismus bis heute begleiten.
Die stärkste Bedrohung aber sah das Establishment in der Arbeiterklasse, die damals nicht nur in Deutschland erstarkte. Bismarck hatte sie durch sein Sozialversicherungssystem gesellschaftlich eingebunden (und politisch durch das allgemeine, Männern vorbehaltene Wahlrecht für den Reichstag). Dennoch gab es für das Establishment Grund zur Beunruhigung: Im Reichstag wuchs die Zahl der Vertreter der Arbeiterschaft und das Programm der Sozialdemokratischen Partei zeigte mittlerweile deutlich den Einfluss marxistischen Denkens. Zudem wurden die Industriearbeiter häufiger aufsässig und sogar gewalttätig und es entwickelte sich eine urbane Subkultur – eingefangen und dargestellt in den Zeichnungen und Karikaturen von Heinrich Zille –, die sich der sozialen Verortung entzog und von tradierten Werten nichts wissen wollte. Nach den Wahlen von 1912 stellte die SPD – die Sozialdemokratische Partei Deutschlands – im Reichstag die meisten Abgeordneten. Das gab es in keinem anderen großen Land Europas. Niemand wusste, wem diese Abgeordneten sich politisch verpflichtet fühlten oder wie sie bei einer Krise abstimmen würden.
Doch zumindest in dieser Hinsicht hätte sich die konservative Führung keine Sorgen machen müssen. Denn in einem neuen, dem 20. Jahrhundert, das den Deutschen zu gehören schien, gab es viele Menschen in allen sozialen Schichten, die sich dem Reich zugehörig fühlten. Ruhiger Stolz oder erfülltes Verlangen – Gefühle, die oft nicht einmal ganz ins Bewusstsein vordrangen – transzendierten die Spannungen und Unterschiede, die aus bestimmten ökonomischen Verhältnissen, religiöser Herkunft oder politischer Einstellung resultierten, ohne diese Differenzen zu leugnen. Und das galt nicht nur für das konservative Establishment oder rabiate Nationalisten – von denen es eine Menge gab –, sondern auch für viele Vertreter der gebildeten und kosmopolitisch eingestellten geistigen Eliten.
Natürlich gab es nicht nur den kultivierten Nationalismus. In der lärmenden Öffentlichkeit der spätwilhelminischen Zeit ließen sich auch Stimmen vernehmen, die es für Deutschlands Recht und Pflicht hielten, die slawischen Völker zu unterjochen – derlei Stimmen gaben zumeist auch antisemitische Ressentiments von sich. Die einflussreichste dieser Gruppierungen war der 1891 gegründete Alldeutsche Verband. Zu seinen ca. 20.000 Mitgliedern gehörte Max Weber, der den Verband später jedoch verließ und sich zunehmend gegen dessen aggressiven Nationalismus und Expansionismus stellte. 1912 rief dessen Vorsitzender, der rechtsnationale Publizist Heinrich Claß, zur Eroberung und Germanisierung der slawischen Gebiete im Osten auf. Das war ein Anzeichen für Kommendes.
1914 war das internationale Gleichgewicht der Mächte ins Schwanken geraten, auch wenn die Spannungen gegenüber dem Vorjahr scheinbar etwas abgenommen hatten. Bombastischen Nationalismus gab es nicht nur bei den Deutschen, aber Deutschland hatte sich in den vorangegangenen zwei Jahrzehnten wie der Teenager benommen, der als Kind immer gehänselt wurde, jetzt seine erwachende Stärke spürt und den Eindruck hat, dass die Welt gegen ihn ist, während er sich auf der Suche nach seiner Identität befindet. Tatsächlich hatten sich Großbritannien, Frankreich und Russland in seltsamer Bettgenossenschaft zu einem Bündnis gegen Deutschland zusammengefunden. Der Teenager fühlte sich eingekreist und entsann sich seiner familiären Beziehungen. Deutschland bekannte sich und stand fest zu Österreich – in Nibelungentreue*, jener Treue bis in den Tod, wovon der Mythos des Nibelungenlieds erzählt (dazu später mehr). Der Knoten für eine Tragödie war geschürzt, es fehlte nur noch das auslösende Moment. Ein Schuss, abgegeben in Sarajewo am 28. Juni 1914, setzte das Drama in Gang.
Deutschland im Sommer 1914 – das ist ein Paradoxon. Seine Wirtschaft war stark, seine Handelsbeziehungen ausgedehnt, sein kulturelles Leben in voller Blüte und gleichfalls europäisch gut vernetzt; darüber hinaus war es energisch und selbstbewusst – mit einer Identität, die es seit über einem Jahrhundert angestrebt hatte. Aber es war auch eine in raschem Wandel begriffene Gesellschaft und viele sahen darin eine ernste Bedrohung für die junge Nation. Konkurrierende Klasseninteressen und religiöse Bruchlinien schienen es zu verhindern, dass auch nur bei einer politischen Angelegenheit gemeinsame Sache gemacht wurde. Manche hielten das für ein Zeichen kommenden Unheils. Und natürlich gab es jene Konservativen, die den demokratischen Auseinandersetzungen im Reichstag die Schuld gaben. Sie sahen die deutsche Gemeinschaft* durch den vulgären, selbstsüchtigen Materialismus der Handel treibenden Gesellschaft* verunreinigt (einer der prominentesten deutschen Soziologen, Ferdinand Tönnies, analysierte vor dem Ersten Weltkrieg den Unterschied zwischen „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“). Einige beschlich die Ahnung, dass früher oder später ein gewaltiges Gewitter über Deutschland hereinbrechen werde. Zu ihnen gehörte der Chef des Generalstabes, Helmuth von Moltke, der mit sorgenvoller Besessenheit die wachsende wirtschaftliche und militärische Macht Russlands beobachtete und davon überzeugt war, dass es möglichst bald zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen sollte.
Als der Sturm dann endlich losbrach, waren die Reaktionen auf seltsame Weise gemischt: Zum Teil herrschte Erleichterung darüber, dass nun ein reinigendes Kriegsgewitter die dumpfe Luft vertreiben werde, zum Teil gab es tief empfundene Befürchtungen für die Zukunft von Deutschlands neu gewonnener Identität. Die SPD versprach am 28. Juli, Verteidigungsaktionen gegen russische Angriffe zu unterstützen, und stimmte für die Bewilligung von Kriegskrediten. Sogar Karl Liebknecht, später Mitbegründer der KPD, schloss sich (nach langen und heftigen Debatten) dem an. Die Sozialdemokraten sahen Russland nämlich als im Mittelalter verhafteten Anachronismus, dem man entgegentreten müsse. Und sie waren, auch wenn sie der marxistischen Lehre anhingen, in erster Linie Deutsche. (Den Konflikt mit Frankreich, wo der populäre und charismatische Sozialist Jean Jaurès ein international anerkannter Kriegsgegner gewesen war, schätzten sie weit ambivalenter ein.).
Das soll natürlich nicht heißen, dass die Sozialdemokraten einem krassen Nationalismus gehuldigt hätten. Aber auch sie waren von dem neuen Identitätsgefühl beseelt, das damals das Bewusstsein der Deutschen beherrschte. Aus der Distanz von einhundert Jahren lässt sich dies Gefühl leicht karikieren, mit Herablassung beurteilen oder gleich ganz ignorieren. Aber in ihm liegt die Antwort auf die Frage, warum das Kaiserreich bei seinem Kriegseintritt 1914 nicht nur von der SPD-Führung unterstützt wurde, sondern auch von so namhaften, international bekannten Intellektuellen wie Thomas Mann und Max Weber. Aus heutiger Sicht muss das wie ein kaum erklärbarer Lapsus dieser Persönlichkeiten wirken, doch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte bis 1914 ist diese Reaktion verständlicher.
Es ist der August des Jahres 1914. Die Planungen der deutschen Militärs beruhten auf dem Grundsatz, dass Angriff die beste Verteidigung sei. Der Krieg an der Westfront sollte im Hinblick auf den Stand der technologischen Entwicklung allerdings bald das Gegenteil zeigen. Doch die Furcht vor der Einkreisung saß tief und stärkte die instinktive Absicht, als Erster zuzuschlagen. Die Verletzung der Neutralität Belgiens (und das brutale Vorgehen der deutschen Truppen dort), die Nordfrankreich zugefügten umfassenden Wirtschaftsschäden und schließlich der uneingeschränkte U-Boot-Krieg – all das weckte den Hass der Alliierten in einem Maße, dass sie in den Friedensverhandlungen von Versailles Deutschland mit demütigender Härte behandelten. So sollte sich schon bald der Vorhang für den nächsten, den letzten Akt der großen Tragödie heben. Noch heute kann man die Erinnerungstafel im Salon des Hotels Trianon in Versailles betrachten, wo die Entente-Mächte der Delegation der neuen deutschen Republik die Bedingungen vorlegten. Allein die Art der Formulierungen mit der langen Liste der Siegermächte, die Deutschland als Schuldigen deklarieren, unterstreicht die Demütigung.
Vielfach wurde gegen die Kritik von John Maynard Keynes an den wirtschaftlichen Folgen des Versailler Vertrags eingewandt, dass die Bedingungen nicht zu hart und die Reparationen bezahlbar gewesen seien.5 Aber das trifft nicht das Wesentliche. Hitler sah in der Zustimmung der deutschen Politiker zu einem Waffenstillstand den berühmten Dolchstoß in den Rücken der Armee. Das neue RestÖsterreich – Deutsch-Österreich nannte sich die Republik – durfte sich nicht mit Deutschland vereinigen. Die Franzosen besetzten das Rheinland und holten sich Elsass-Lothringen zurück. Wieder waren die Geister des Ressentiments aus der Flasche gelassen worden, wieder hatten Rachegelüste Rache ausgebrütet. Der Misshandelte schlägt zurück und sieht seine Bestrafung als Viktimisierung – ein wiederkehrendes Muster. Aber diesmal sollten die Folgen wahrhaft schrecklich sein.
Die Jahre der Weimarer Republik hinterlassen ein Gefühl trauriger Müdigkeit. Fast alles läuft schief. Die Republik entstand, als das Reich zusammenbrach und im Bürgerkrieg versank. Von Beginn an verweigerten die militaristische und aristokratische Rechte wie auch die kommunistische Linke der Republik ihre Loyalität. Hyperinflation trieb die Mittelschichten in den Ruin und die Arbeiterklasse in die Armut. Angst und Unsicherheit breiteten sich in der Gesellschaft aus. Im Rheinland benahmen sich die Franzosen wie Bourbonen, die nichts gelernt und nichts vergessen hatten. Nachdem 1924 der von den USA lancierte Dawes-Plan in Kraft getreten und Deutschlands finanzielle Fesselung dadurch etwas gelockert war, konnte sich die Wirtschaft erholen und wäre, bessere weltwirtschaftliche Bedingungen vorausgesetzt, womöglich gesundet. Die grassierende Arbeitslosigkeit und andere Bedrohungen hätten abgebaut werden und die durch Krisen und Aufruhr gebeutelten Menschen Hoffnung schöpfen können. Aber ab 1930 wurde die wirtschaftliche Erholung in Deutschland durch die Weltwirtschaftskrise torpediert. Die Arbeitslosigkeit stieg erneut an und betrug Ende 1932 bei den männlichen Erwachsenen 25 Prozent. Mittlerweile war die NSDAP zur stärksten Partei im Reichstag aufgestiegen. Die Kommunisten verweigerten die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten, und so gelangten die Nationalsozialisten an die Macht. Im Januar 1933 wurde der faustische Pakt zwischen Papen und Hitler geschlossen.
Der Rest ist ein Countdown bis zur Stunde Null* im Mai 1945. Die Geschichte dieser Jahre vermag immer noch zu fesseln und zu entsetzen. Es gab einige frühe Triumphe – innenpolitisch die Wiederbelebung der Wirtschaft, außenpolitisch die Annullierung der Bedingungen des Versailler Vertrags. Der Krieg weckte in der Bevölkerung wenig Begeisterung, brachte aber anfänglich einige leichte Siege, insbesondere – was die Mehrheit der Deutschen überraschte und begrüßte – über Frankreich. Die Pläne für den Umgang mit den Unerwünschten – vor allem den Juden – wurden immer düsterer. Und dann gab es den tödlichen Irrtum – den Krieg gegen die Sowjetunion, bei dem frühe Erfolge schon bald durch entsetzlich harte Winter und unsagbar grausame Kämpfe zunichtegemacht wurden. Energie und Kampfmoral des „Dritten Reichs“ schwanden dahin. Unterdessen bombardierten die Alliierten eine deutsche Stadt nach der anderen und brachten so den Krieg mit all seinen Schrecken der Zivilbevölkerung noch vor dem Eintreffen der Roten Armee. Nachdem im Juli 1944 die Verschwörung gegen Hitler fehlgeschlagen war, bewegte sich alles auf eine totale Opferung à la Wagner zu: Bis kurz vor Kriegsende wurde die Vernichtung der Juden ebenso fortgesetzt wie die Bombardierung der Städte (im März 1945 starb Magdeburg zum zweiten Mal), und der Vormarsch auf Berlin wurde Stadt für Stadt von brutalen Straßen- und Häuserkämpfen begleitet.
Dann kam das Ende: ein so vollständiger militärischer, physischer und moralischer Zusammenbruch, dass viele tatsächlich die Stunde Null für gekommen hielten. Für den Philosophen Jürgen Habermas war Auschwitz die große Zäsur in der deutschen Geschichte – die Zukunft würde auf vollständig neuen Fundamenten errichtet werden müssen. Und die Öffentlichkeit außerhalb von Deutschland sah mit dem Kriegsende das Ende der deutschen Geschichte überhaupt gekommen: Der moralische und materielle Schutthaufen, der Deutschland 1945 war, bedeutete das Ende all der Jahrhunderte deutscher Kultur* – Stunde Null. Wie immer die Zukunft beschaffen sein mochte, es gab nichts mehr, worauf man hätte bauen, aufbauen können. Es gab nur noch den Zusammenbruch und die vollständige Orientierungslosigkeit.
Aber natürlich war 1945 nicht die Stunde Null. Deutschlands Geschichte endete nicht mit der Kapitulation, und es gab durchaus noch etwas, worauf sich ein neues Gebäude errichten ließ. Tatsächlich lädt uns diese Geschichte in einzigartiger Weise dazu ein, der Vielschichtigkeit des menschlichen Wesens zu begegnen – den Gipfeln, die es erstürmen, den Tiefen, in die es fallen kann, und den unahnbaren Möglichkeiten zu Wiedergutmachung und Versöhnung, die es selbst in den dunkelsten Augenblicken des Versagens gibt.
Denn das ist die Geschichte des modernen Deutschlands, das nun im Europa des 21. Jahrhunderts unausweichlich die Führungsrolle übernimmt. Einhundert Jahre nach dem Beginn einer Tragödie, die ihren Höhepunkt im Mai 1945 erreichte, wohnen wir der Entwicklung eines neuen deutschen Selbstverständnisses bei, sehen wir ein Land, das zum ersten Mal seit eintausend Jahren mit seinen Nachbarn und sich selbst in Frieden lebt, so, wie es die zwei nach der Stunde Null geborenen Generationen langsam, aber sicher vollbracht haben. Das zum Aggressor und Untäter mutierte Opfer hat seine schrecklichen Verbrechen gesühnt und Versöhnung erfahren und ist nun in einer neuen Ära für Europa widerstrebend zur Führungsnation geworden. Andere in unserer unumkehrbar global gewordenen Welt können aus dieser Geschichte lernen – wie am Ende unserer Erzählung deutlich wird. Doch zuerst müssen wir Deutschlands Reisewege erkunden.