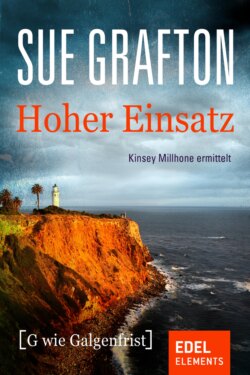Читать книгу Hoher Einsatz - Sue Grafton - Страница 3
1
ОглавлениеDrei Dinge ereigneten sich am oder um den 5. Mai herum, der in Kalifornien nicht nur Cinco de Mayo*, sondern auch mein Geburtstag ist. Abgesehen von der Tatsache, dass ich dreiunddreißig wurde (nachdem ich zwölf endlos lange Monate zweiunddreißig war), geschah Folgendes:
1 Der Umbau meiner Wohnung war endlich fertig, und ich zog wieder ein.
2 Eine gewisse Mrs. Clyde Gersh heuerte mich an; ich sollte ihre Mutter aus der Mojave-Wüste zurückbringen.
3 Ich rutschte auf einen der obersten Plätze von Tyrone Pattys Abschussliste.
Ich zähle diese Ereignisse nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer Bedeutung auf, sondern so, wie sie am leichtesten zu erklären sind.
Fürs Protokoll: Ich heiße Kinsey Millhone, bin Privatdetektivin mit einer Lizenz des Staates Kalifornien, (jetzt) dreiunddreißig Jahre alt, wiege sehr weibliche hundertacht Pfund und bin einssiebenundsechzig groß. Ich habe dunkles, dichtes, glattes Haar, das ich gewöhnlich kurz trage, seit einiger Zeit aber wachsen lasse, nur um einmal zu sehen, wie sich das macht. Normalerweise bearbeite ich meinen Schopf ungefähr alle sechs Wochen selbst mit einer Nagelschere, weil ich zu geizig bin, in einem Schönheitssalon achtundzwanzig Dollar zu berappen. Ich habe haselnussbraune Augen, eine Nase, die schon zweimal gebrochen war, aber noch ganz gut funktioniert, glaube ich. Wenn man mich auffordern würde, mein Aussehen auf einer Skala zwischen eins und zehn zu bewerten, würde ich das ablehnen. Ich verwende jedoch selten Make-up, was zur Folge hat, dass ich bei fortgeschrittener Tageszeit immerhin noch genauso aussehe wie am frühen Morgen.
Seit Neujahr wohne ich bei meinem Hauswirt, dem zweiundachtzigjährigen Henry Pitts, der mir vor zwei Jahren eine zum Apartment umgebaute Garage vermietet hatte. Diese unscheinbare, aber sonst zweckmäßige Behausung war in die Luft gepustet worden, und Henry hatte mir vorgeschlagen, ich solle während des Wiederaufbaus in seinem kleinen Hinterzimmer unterkriechen. Es gibt anscheinend ein Naturgesetz, nach dem jeder Hausbau den ursprünglichen Kostenvoranschlag um hundert Prozent überschreitet und fünfmal so lange dauert wie erwartet. Das wäre eine Erklärung dafür, warum nach fünf Monaten intensiver Arbeit die Einweihung mit dem Pomp einer Filmpremiere gefeiert werden sollte. Mir war nicht ganz wohl bei dem Gedanken an die neue Bleibe, weil ich absolut nicht sicher war, was Henry sich für Grundriss und Innendekoration hatte einfallen lassen. Er hatte sehr geheimnisvoll getan und platzte fast vor Selbstzufriedenheit, seit die Stadt seine Entwürfe genehmigt hatte. Ich befürchtete nur, dass man mir meine Bestürzung allzu deutlich anmerken würde, sowie ich den ersten Blick darauf geworfen hatte. Ich bin zwar eine geborene Lügnerin, schaffe es aber nicht besonders gut, mich zu verstellen. Deshalb sagte ich mir immer wieder vor, es ist sein Eigentum, und er kann damit machen, was er will. Sollte ich mich bei zweihundert Dollar Miete im Monat etwa beklagen? Na also.
An diesem Donnerstagmorgen wachte ich um sechs Uhr auf, stieg aus dem Bett und in den Jogginganzug. Ich putzte mir die Zähne, klatschte mir ein bisschen Wasser ins Gesicht, machte ein paar flüchtige Kniebeugen und lief durch Henrys Hintertür hinaus. Mai und Juni sind in Santa Teresa oft neblig – trüb wie ein weißflimmernder Bildschirm nach Programmschluss. Im Winter sind die Strände kahl, massive Gesteinsbrocken kommen zum Vorschein, wenn die Ebbe den Sommersand weggespült hat. Diesmal waren März und April verregnet gewesen, aber der Mai hatte klar und mild begonnen. Mit den Frühjahrsströmungen kam auch der Sand zurück, und die Strände wurden für die Touristen hergerichtet, die um den Memorial Day herum in die Stadt einfallen und erst nach dem Labor-Day-Wochenende wieder verschwinden würden.
Diese Morgendämmerung war spektakulär, Schönwetterwolken sprenkelten den Himmel mit dunkelgrauen Wattebäuschchen, deren Unterseite die Sonne intensiv rosa gefärbt hatte. Es war Ebbe, und der Strand schien sich wie ein silbernes Spiegelbild des Himmels bis zum fernen Horizont zu dehnen. Santa Teresa war üppig und grün, und die Luft fühlte sich weich an, gesättigt mit dem Duft von Eukalyptusblättern und frisch gemähtem Gras. Ich lief drei Meilen und kam eine halbe Stunde später zurück, gerade rechtzeitig, um Henry »Zum Geburtstag viel Glü-ü-ück« schmettern zu hören, während er ein Blech mit frischen Zimtbrötchen aus dem Backofen zog. Ich bin eigentlich nicht besonders scharf drauf, mir ein Ständchen bringen zu lassen, aber er sang so falsch, dass ich nur belustigt und gerührt sein konnte. Ich duschte, zog Jeans, T-Shirt und Tennisschuhe an, und dann überreichte Henry mir eine in Geschenkpapier eingepackte Schmuckschachtel, die den nagelneuen Messingschlüssel zu meinem Apartment enthielt. Er benahm sich wie ein Kind, ein scheues, faltiges Lächeln im schmalen gebräunten Gesicht, und die blauen Augen funkelten vor kaum bezähmbarer Erregung. In feierlicher Zwei-Mann-Prozession zogen wir von seiner Haustür über den gepflasterten Patio zu meiner Wohnungstür.
Von außen kannte ich meine Behausung schon – Erdgeschoss und erster Stock waren cremefarben verputzt, mit abgerundeten Ecken, in einem Stil, den man wohl als Art déco bezeichnen könnte. Mehrere verstellbare Fenster waren neu eingesetzt worden, und den Garten ums Haus herum hatte Henry selbst bepflanzt. Um die Wahrheit zu sagen, von außen wirkte das Ganze nicht besonders ansprechend, was mich jedoch überhaupt nicht störte. Ich hatte mich nur immer davor gefürchtet, dass das Apartment zu pompös ausfallen würde.
Wir besichtigten erst ein paar Minuten lang das Grundstück, und Henry schilderte mir in allen Einzelheiten die Kämpfe, die er sich mit den Baubehörden der Stadt geliefert hatte. Mir war klar, dass er den Bericht so ausdehnte, um die Spannung bis aufs Letzte auszureizen, und tatsächlich fühlte ich mich unsicher und wünschte mir nur, ich hätte schon alles hinter mir. Endlich durfte ich den Schlüssel im Schloss herumdrehen, und die Wohnungstür mit dem bullaugenförmigen Fenster schwang auf. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Ich war bemüht gewesen, mir nichts auszumalen, aber jetzt verschlug es mir die Sprache. Das ganze Apartment gab einem das Gefühl, auf einem Schiff zu sein. Die Wände bestanden aus poliertem Teak- und Eichenholz, mit Regalen und kleinen, gemütlichen Nischen auf beiden Seiten. Die Kochnische war rechts, wo sie auch früher gewesen war, sah jetzt aber aus wie eine Kombüse mit winzigem Herd und Kühlschrank. Hinzugekommen waren ein Mikrowellenherd und eine Abfallpresse. Eingepasst in einen Winkel neben der Küche stand eine Kombination aus Waschmaschine und Trockner, und daneben lag ein winziges Badezimmer.
Im Wohnbereich bildete das in einen Fenstererker eingebaute Sofa mit zwei Sesseln aus königsblauem Segeltuch eine gemütliche Sitzgruppe. Henry führte mir kurz vor, wie man das Sofa mit ein paar Handgriffen in ein Gästebett verwandeln konnte. Die seitliche Länge des Wohnraums betrug ungefähr viereinhalb Meter, wie vor der Explosion, doch jetzt gab es oben, wo früher mein Speicher gewesen war, einen Schlafraum, den man über eine winzige Wendeltreppe erreichte. In der alten Behausung hatte ich gewöhnlich, nackt in eine Steppdecke gewickelt, auf der Couch geschlafen. Jetzt bekam ich ein regelrechtes Schlafzimmer.
Ich schlängelte mich die Treppe hinauf und betrachtete staunend das Doppelbett mit den Schubkästen darunter. Über dem Bett hatte man durch die Zimmerdecke und durch das Dach einen Schacht getrieben, der mit einer klaren Plexiglashaube abgedeckt war, durch die gebündeltes Licht auf die blau-weiße Patchwork-Bettdecke fiel. Schräge Fenster blickten an einer Seite auf den Ozean und an der anderen zu den Bergen hinaus. Ein mit Zedernholz verkleideter Schrankraum mit Kleiderstange, Haken für alles Mögliche, Schuhhaltern und vom Boden bis zur Decke reichenden Schubfächern bildete die Rückwand.
Neben dem Schlafraum befand sich ein winziges Badezimmer. Die Wanne war im Boden versenkt, mit eingebauter Dusche. Vor einem Fenster in Wannenhöhe standen üppige Grünpflanzen auf einem hölzernen Fenstersims. Ich konnte inmitten der Baumwipfel baden, mit Blick auf den Ozean, über dem die Wolken sich wie Seifenblasen türmten. Die Handtücher waren königsblau wie der baumwollene Zottelteppich, und sogar die Seife in der weißen Porzellanschale auf dem runden Messingbecken war blau.
Als die Besichtigung beendet war, drehte ich mich um und starrte Henry sprachlos an – eine Reaktion, über die er laut lachen musste, hell begeistert von sich selbst, weil ihm sein Plan so perfekt gelungen war. Den Tränen nahe, legte ich die Stirn an seine Brust, während er mir verlegen den Rücken tätschelte. Einen besseren Freund als ihn kann ich mir nicht wünschen.
Bald darauf ließ er mich allein, und ich schaute in jedes Schränkchen, in jede Schublade, atmete den Geruch des Holzes ein und lauschte auf das geisterhafte Ächzen des Windes in den Dachsparren. Ich brauchte fünfzehn Minuten, um mit meiner ganzen Habe umzuziehen. Das meiste, was ich besessen hatte, war ein Opfer der Bombe geworden, die meine alte Bleibe dem Erdboden gleichgemacht hatte. Mein ›Kleid für alle Gelegenheiten‹ hatte überlebt, zusammen mit einer Lieblingsweste und dem Hängefarn, den Henry mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Alles andere war von Schwarzpulver, Sprengkapseln und Schrapnellen atomisiert worden. Vom Geld der Versicherung hatte ich mir ein paar Klamotten gekauft – Jeans und Jogginganzüge – und den Rest auf ein Festkonto gelegt, wo es fröhlich Zinsen sammelte.
Um acht Uhr fünfundvierzig schloss ich ab, schaute kurz bei Henry hinein und stammelte ein zweites Dankeschön; er winkte nur lässig ab. Dann machte ich mich auf den Weg ins Büro, eine schnelle Zehn-Minuten-Fahrt in die Stadt. Ich wäre gern daheimgeblieben und um mein Haus herumgewandert wie ein Seekapitän, der drauf und dran ist, auf eine fantastische Reise zu gehen, aber ich konnte mich der Tatsache nicht verschließen, dass ich Rechnungen zu bezahlen hatte und auf Telefonanrufe reagieren musste.
Ich erledigte ein paar weniger wichtige Dinge und tippte zwei Rechnungen. Der letzte Name auf der Telefonliste war der einer Mrs. Clyde Gersh; sie hatte am Abend vorher auf meinem Anrufbeantworter die Nachricht hinterlassen, ich solle mich gelegentlich mit ihr in Verbindung setzen. Ich wählte ihre Nummer und griff nach einem gelben Notizblock. Das Telefon klingelte zweimal, dann wurde abgehoben, und eine Frau meldete sich.
»Mrs. Gersh?«
»Ja«, sagte sie. Ihre Stimme klang zurückhaltend, als erwarte sie, von mir um eine Spende für eine betrügerische Wohlfahrtseinrichtung angegangen zu werden.
»Kinsey Millhone. Sie haben mich angerufen«, sagte ich.
Stille, die einen Sekundenbruchteil dauerte, dann schien sie wieder zu wissen, wer ich war. »O ja, Miss Millhone. Schön, dass Sie sich so schnell bei mir melden. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen, aber ich fahre nicht Auto und möchte das Haus nicht verlassen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie heute irgendwann im Lauf des Tages zu mir kommen?«
»Aber sicher«, sagte ich. Sie nannte mir die Adresse, und da ich keinen anderen Termin vorgemerkt hatte, versprach ich, innerhalb der nächsten Stunde bei ihr zu sein. Die Sache schien zwar nicht besonders eilig, aber egal, was es war, Geschäft ist Geschäft.
Die Adresse, die sie mir gegeben hatte, lag im Zentrum der Stadt, nicht weit von meinem Büro entfernt, in einer stillen, von Bäumen gesäumten Straße mit älteren Einfamilienhäusern. Eine dichte Hecke, undurchdringlich wie eine Mauer, verhinderte, dass das Haus von der Straße eingesehen werden konnte. Ich parkte den Wagen direkt davor und trat durch eine quietschende Gartentür ein. Das Haus wirkte ziemlich chaotisch. Seine beiden Stockwerke, Erdgeschoss und erster Stock, waren mit dunkelgrünen Schindeln verkleidet. Es stand nicht in der Mitte, sondern etwas seitlich auf einem dicht mit Sykomoren bewachsenen Grundstück. Über hellgraue Holzstufen, die kürzlich frisch gestrichen worden waren und noch nach Farbe rochen, stieg ich zur Veranda hinauf. Die Fliegengittertür stand offen. Ich ging zur Haustür, drückte auf den Klingelknopf und musterte die Fassade. Das Haus war vermutlich in den zwanziger Jahren erbaut worden, nicht elegant, aber großzügig: komfortabel, schlicht, einst für die Mittelklasse gedacht, heutzutage für den durchschnittlichen Käufer auf dem Immobilienmarkt unerschwinglich. Ein Haus wie dieses kostete jetzt wahrscheinlich über eine halbe Million und musste auch noch renoviert werden, damit es nach etwas aussah.
Eine dicke Schwarze in einer kanariengelben Uniform mit weißem Kragen und weißen Manschetten ließ mich ein. »Mrs. Gersh ist auf der oberen Veranda«, sagte sie, zeigte auf eine Treppe gegenüber der Tür und watschelte davon, anscheinend überzeugt, dass ich mich nicht an den Kristallnippes vergreifen würde, die auf einem Tisch rechts vom Eingang standen.
Es gelang mir, einen kurzen Blick ins Wohnzimmer zu werfen – auf den breiten gemauerten Kamin, der von Bücherschränken mit in Blei gefassten Glastüren flankiert wurde, auf die Zottelteppiche in einem abgetretenen Naturweiß. Die Wände waren bis zu halber Höhe cremefarben getäfelt, die Tapete über der Täfelung hatte ein blasses Druckmuster und setzte sich an der Decke als stilisierte Wildblumenwiese fort. Der Raum war etwas düster, es fehlten ein paar Tischlampen. Im ganzen Haus herrschte dumpfe Stille, und es roch nach Blumenkohl und Curry.
Ich stieg die Stufen hinauf. Auf dem ersten Absatz angelangt, stellte ich fest, dass sich die Treppe hier gabelte und eine zweite in die Küche hinunterführte; auf dem Herd blubberte ein Wasserkessel. Das Hausmädchen, das mir geöffnet hatte, stand jetzt am Tisch und rieb Koriander. Sie spürte meinen Blick, drehte sich um und sah mich träge an. Ich ging weiter.
Am Ende der Treppe öffnete sich eine Fliegengittertür auf eine breite Veranda mit hölzernen Pflanzkästen, in denen leuchtend rote und orangefarbene Geranien blühten. Über die Hauptstraße, zwei Blocks entfernt, flutete der Verkehr, aufrauschend und abebbend wie das Meer. Mrs. Gersh lag auf einer Chaiselongue, die Beine mit einer Reisedecke zugedeckt. Sie sah aus, als schnappe sie ein bisschen frische Luft an Deck und warte auf einen Animateur, um das Tagesprogramm an Bord zu erfahren. Sie hatte die Augen geschlossen, und auf ihrem Schoß lag aufgeschlagen, mit dem Einband nach oben, ein Roman von Judith Krantz. Eine Trauerweide ließ ihre langen, filigranartigen Zweige in eine Ecke der Veranda hängen und sprenkelte den Boden mit einem Muster aus Licht und Schatten.
Der Tag war mild, doch der leichte Wind kam mir hier oben ein wenig kühl vor. Die Frau war dünn wie eine Bohnenstange und hatte die totenblasse Haut einer Schwerkranken. Für mich hatte sie große Ähnlichkeit mit jenen Frauen, die vor hundert Jahren die Sanatorien bevölkerten, Opfer zahlreicher Fehldiagnosen, die gegen Angst, Unglücklichsein, Opiumabhängigkeit oder eine Abneigung gegen Sex anzukämpfen versuchten. Sie hatte weißblond gebleichtes, schütteres Haar. Ihr Mund war mit grellrotem Lippenstift bemalt, und der Lack auf den kurz geschnittenen Fingernägeln hatte den gleichen schrillen Farbton. Ihre Jean-Harlow-Brauen waren so gezupft, dass sie ständig mit einem Ausdruck sanften Staunens in die Welt blickte. Falsche Wimpern, die wie Fäden auf ihren Unterlidern lagen, umrahmten ihre Augen. Ich schätzte Mrs. Gersh auf Anfang bis Mitte Fünfzig, aber vielleicht war sie auch noch etwas jünger. Krankheit leistet dem Alter Vorschub. Ihr Brustkorb war eingefallen und die Brüste so flach wie Pfannkuchen. Sie trug eine weiße Seidenbluse, kostspielig aussehende hellgraue Gabardineslacks und grüne Slipper an den Füßen.
»Mrs. Gersh?«
Sie erschrak, riss blau blitzende Augen auf, schien im ersten Moment desorientiert, fasste sich jedoch schnell.
»Sie müssen Kinsey sein«, sagte sie leise. »Ich bin Irene Gersh.« Sie reichte mir die linke Hand; ihre Finger waren sehnig und kalt.
»Tut mir Leid, dass ich Sie erschreckt habe.«
»Schon gut. Ich bin ein Nervenbündel. Suchen Sie sich bitte einen Sessel, und setzen Sie sich. Da ich nachts nicht gut schlafe, versuche ich ein bisschen Schlaf zu ergattern, wo ich kann.«
Ich sah mich rasch um und entdeckte in einer Verandaecke drei ineinander gestapelte weiße Gartensessel. Ich holte mir den obersten, trug ihn zur Chaiselongue und setzte mich.
»Hoffentlich denkt Jermaine daran, uns Tee zu bringen, aber rechnen Sie nicht damit«, sagte Irene Gersh. Sie richtete sich ein wenig höher auf und zog die Decke zurecht. Dabei betrachtete sie mich interessiert. Ich hatte den Eindruck, dass ich ihr gefiel, wenn ich auch nicht sagen konnte, warum. »Sie sind jünger, als ich Sie mir vorgestellt habe.«
»Ich bin alt genug. Hab heute Geburtstag. Eben dreiunddreißig geworden.«
»Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich habe keine Feier gestört.«
»Aber nein, ganz und gar nicht.«
»Ich bin siebenundvierzig.« Sie lächelte flüchtig. »Ich weiß, ich sehe wie ein hässliches, altes Weib aus, aber ich bin noch relativ jung – nach kalifornischen Maßstäben.«
»Waren Sie krank?«
»Sagen wir so – es ging mir nicht gut. Mein Mann und ich sind vor drei Jahren aus Palm Springs nach Santa Teresa gezogen. Das Haus hier hat seinen Eltern gehört. Nach dem Tod seines Vaters hat Clyde für seine Mutter gesorgt. Sie ist vor zwei Monaten gestorben.«
Ich murmelte etwas und hoffte, dass es passend war.
»Der springende Punkt ist, dass wir eigentlich gar nicht herziehen mussten, aber Clyde hat darauf bestanden. Ob ich wollte oder nicht. Er ist in Santa Teresa aufgewachsen und war fest entschlossen, hierher zurückzukehren.«
»Sie waren offenbar nicht gerade begeistert davon.«
Sie warf mir einen raschen Blick zu. »Mir gefällt es hier nicht. Hat mir noch nie gefallen. Früher haben wir Clydes Eltern hier besucht, vielleicht zweimal im Jahr. Ich mag das Meer nicht. Die Stadt hat mich immer bedrückt. Sie wirkt irgendwie düster auf mich. Alle schwärmen davon, dass sie so schön ist. Mir gefällt diese ständige Selbstbeweihräucherung nicht, und ich mag auch nicht das viele Grün. Ich bin in der Wüste geboren und aufgewachsen, dort bin ich heute noch am liebsten. Vom Tag unserer Ankunft an ist es mir gesundheitlich immer schlechter gegangen, aber die Ärzte können nichts finden. Clyde blüht geradezu auf. Ich glaube, er denkt, dass ich schmolle, aber das stimmt nicht. Ich habe Angst. Jeden Morgen erwache ich mit Angst. Manchmal fühle ich sie wie einen pulsierenden elektrischen Strom oder ein Gewicht auf der Brust, fast unerträglich.«
»Sprechen Sie von Panik-Attacken?«
»So nennt es der Doktor immer, ja«, sagte sie.
Ich murmelte etwas Unverbindliches und fragte mich, worauf das alles hinaus sollte. Sie schien meine Gedanken zu lesen.
»Was wissen Sie über die Slabs?«, fragte sie abrupt.
»Die Slabs?«
»Sie sind Ihnen kein Begriff, wie ich sehe. Das überrascht mich nicht. Die Slabs liegen draußen in der Mojave-Wüste, östlich vom Salton Sea. Während des Zweiten Weltkrieges gab es dort einen Marinestützpunkt. Camp Dunlap. Es existiert nicht mehr. Übrig sind nur noch die Betonfundamente der Baracken – die Slabs. Tausende von Menschen fallen jeden Winter aus dem Norden in den Slabs ein. Man nennt sie die ›Schneeammer‹, weil sie vor den rauen nördlichen Wintern fliehen. Dort draußen bin ich aufgewachsen. Meine Mutter wohnt noch da, soviel ich weiß. Die Lebensbedingungen sind sehr primitiv – kein Wasser, keine Kanalisation, keinerlei Infrastruktur, aber es kostet nichts. Die Schneeammer hausen wie Zigeuner; manche in teuren Wohnmobilen, manche in Hütten aus Pappe. Im Frühling verschwinden die meisten wieder und ziehen nach Norden. Meine Mutter gehört zu den wenigen ständigen Bewohnern, aber ich habe seit Monaten nichts mehr von ihr gehört. Sie hat kein Telefon und keine Adresse, an die man ihr schreiben könnte. Ich mache mir Sorgen um sie und möchte, dass jemand hinunterfährt und nachsieht, ob es ihr gut geht.«
»Wie oft meldet sie sich gewöhnlich?«
»Früher regelmäßig einmal im Monat. Sie fährt per Anhalter in die Stadt und ruft aus einem kleinen Café in Niland an. Manchmal auch aus Brawley oder Westmorland, das hängt davon ab, wohin sie mitgenommen wird. Wir reden. Sie kauft ein, was sie braucht, und fährt dann per Anhalter wieder zurück.«
»Hat sie ein Einkommen? Eine Sozialversicherung?«
Mrs. Gersh schüttelte den Kopf. »Nur die Schecks, die ich ihr schicke. Ich glaube nicht, dass sie je eine Sozialversicherungskarte hatte. So weit ich mich erinnere, hat sie uns beide immer mit Heimarbeit durchgebracht und ihr Geld bar auf die Hand bekommen. Sie ist jetzt dreiundachtzig und arbeitet natürlich nicht mehr.«
»Wie bekommt sie Post, wenn sie keine Adresse hat?«
»Sie hat ein Schließfach. Oder hatte auf jeden Fall eins.«
»Was ist mit den Schecks? Hat sie sie eingelöst?«
»Wahrscheinlich nicht. Die Beträge sind von meinem Konto nicht abgebucht worden. Das hat mich zuallererst misstrauisch gemacht. Sie braucht doch Geld für Lebensmittel und alles andere.«
»Wann haben Sie das letzte Mal von ihr gehört?«
»Weihnachten. Ich hatte ihr ein bisschen Geld geschickt, und sie rief mich an, um sich zu bedanken. Es sei alles in Ordnung, sagte sie, aber um ehrlich zu sein, sie hörte sich nicht besonders gut an. Sie trinkt manchmal.«
»Was ist mit den Nachbarn? Gibt es eine Möglichkeit, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen?«
Irene Gersh schüttelte wieder den Kopf. »Dort hat niemand ein Telefon. Sie können sich nicht vorstellen, wie primitiv die Verhältnisse da draußen sind. Die Leute müssen ihren Müll selbst zur städtischen Müllhalde bringen. Das Einzige, was die Stadt zur Verfügung stellt, ist ein Schulbus für die Kinder, und selbst darüber gibt es Beschwerden von der Bevölkerung.«
»Wie steht es mit der Ortspolizei? Könnte man sich vielleicht über sie mit Ihrer Mutter in Verbindung setzen?«
»Davor bin ich bisher noch zurückgeschreckt. Meine Mutter hütet ihre Privatsphäre geradezu eifersüchtig. Das ist schon fast ein Tick von ihr. Sie wäre wütend, wenn ich mich an die Behörden wenden würde.«
»Sie haben sechs Monate gewartet, das ist eine lange Zeit.«
Ihre Wangen röteten sich leicht. »Das ist mir klar, aber ich dachte immer, ich würde bald von ihr hören. Offen gesagt, wollte ich mich nicht ihrem Zorn aussetzen. Ich warne Sie, sie ist ein Ekel, besonders wenn sie wütend ist. Sie ist sehr auf ihre Unabhängigkeit bedacht.«
Ich durchdachte die Situation, überlegte mir die Möglichkeiten. »Sie sagen, sie hat keine feste Adresse. Wie finde ich sie?«
Sie griff nach unten und holte unter der Chaiselongue eine lederne Schmuckschatulle hervor, der sie ein kleines Kuvert und ein paar Polaroidfotos entnahm. »Das ist ihre letzte Nachricht. Und das sind ein paar Bilder, die ich gemacht habe, als ich das letzte Mal dort war. In diesem Caravan lebt sie. Von ihr selbst habe ich leider kein Foto.«
Ich warf einen Blick auf die Bilder, die einen altehrwürdigen, einfarbig blau gestrichenen Wohnwagen zeigten. »Wann wurde das aufgenommen?«
»Vor drei Jahren. Kurz bevor Clyde und ich hierherzogen. Ich kann Ihnen einen Plan vom Standplatz des Wohnwagens zeichnen und garantiere Ihnen, dass er noch da ist. Wenn jemand in den Slabs ein Stück Land ›besiedelt‹ hat – und wenn es nur ein drei mal drei Meter großes Stück zubetonierte Erde ist –, rührt er sich nicht mehr weg. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr Menschen an einem Streifen unfruchtbaren Bodens und ein paar mickrigen Sträuchern hängen können. Sie heißt übrigens Agnes Grey.«
»Sie haben überhaupt kein Bild von ihr?«
»Leider nein, aber dort kennt sie jeder. Ich glaube nicht, dass es für Sie schwierig sein wird, sie zu identifizieren – wenn sie noch dort ist.«
»Und wenn ich sie finde? Was dann?«
»Sie teilen mir mit, in welcher Verfassung sie ist. Dann können wir entscheiden, wie wir am besten verfahren. Übrigens habe ich mich an Sie gewandt, weil Sie eine Frau sind. Meine Mutter mag Männer nicht. Sie schließt sich Fremden nie schnell an, aber wenn Männer in der Nähe sind, ist es noch schlimmer. Übernehmen Sie den Auftrag?«
»Ich kann schon morgen losfahren, wenn Sie wollen.«
»Gut. Ich habe gehofft, dass Sie das sagen würden. Ich hätte gern die Möglichkeit, Sie auch außerhalb der Bürostunden zu erreichen. Falls Mutter sich melden sollte, würde ich gern sofort anrufen, ohne mit Ihrem Automaten sprechen zu müssen. Vielleicht geben Sie mir auch eine Adresse, über die ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen kann.«
Ich notierte meine Privatadresse und die private Telefonnummer auf die Rückseite meiner Geschäftskarte. »Geben Sie sie bitte nicht weiter, ich verteile meine Privatanschrift nicht wahllos«, sagte ich, als ich ihr die Karte reichte.
»Selbstverständlich. Vielen Dank.«
Wir besprachen das Geschäftliche. Ich hatte einen Standardvertrag mitgebracht, und wir füllten ihn handschriftlich aus. Sie zahlte mir fünfhundert Dollar Vorschuss und zeichnete eine grobe Skizze des Geländes, auf dem der Wohnwagen ihrer Mutter stand. Seit Juni vergangenen Jahres hatte ich keinen Vermisstenfall mehr gehabt, und ich brannte darauf, mich an die Arbeit zu machen. Die Sache schien reine Routine zu sein, und ich betrachtete den Auftrag als hübsches Geburtstagsgeschenk.
Ich verließ das Gersh-Haus um zwölf Uhr fünfzehn und fuhr schnurstracks zum nächsten McDonald’s, wo ich mir zur Feier des Tages einen Hamburger Royal mit Käse einverleibte.
* Mexikanischer Nationalfeiertag zur Erinnerung an den Sieg der mexikanischen Truppen über die Franzosen bei Puebla am 5. Mai 1862. Wird auch in Kalifornien von vielen mexikanischen Einwanderern gefeiert. (Anmerk. d. Übersetz.)