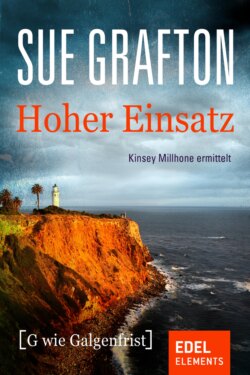Читать книгу Hoher Einsatz - Sue Grafton - Страница 6
4
ОглавлениеDer Wohnwagen auf der Rusted-Out-Chevy-Road bot einen erbärmlichen Anblick und hatte wenig Ähnlichkeit mit dem Schnappschuss in meiner Tasche, der einen zwar alten, aber robust aussehenden blaulackierten Caravan auf vier Schwarzwandreifen zeigte. Nach diesem Bild hatte ich ihn auf gut dreißig Jahre geschätzt, damals waren solche Caravans, von Buick-Limousinen gezogen, durch das halbe Land gerumpelt. Jetzt waren die Flanken mit aufgesprühten Wörtern verziert, deren Gebrauch man, wie meine Tante mir erklärt hatte, auf ein Minimum beschränken sollte. Aus einigen Fenstern waren die Belüftungsklappen herausgebrochen worden, und die Tür hing nur noch an einer Angel. Als ich vorüberfuhr, saß ein ungefähr zwölfjähriges Wesen unbestimmten Geschlechts mit Rastalocken und in zerlumpten, abgeschnittenen Jeans auf der Türschwelle, den Finger tief in der Nase, ganz offensichtlich zu dem Zweck, den Inhalt zu Tage zu fördern. Ich fuhr vorbei, wendete, fuhr zurück und hielt am Straßenrand. Als ich ausgestiegen war, war die Türschwelle leer. Ich klopfte.
»Hallo?«, rief ich in singendem Tonfall. »Hal-lo-o!«
Ich spähte hinein. Im Wohnwagen war niemand, wenigstens so weit ich ihn überschauen konnte. Es war hier drinnen wahrscheinlich noch nie besonders sauber gewesen, doch jetzt war der Raum mit Unrat übersät. Wo eigentlich ein Klapptisch hingehörte, lagen leere Flaschen und Dosen auf einem Haufen. Alles war dick verstaubt. Die Überreste einer Bank auf der rechten Seite sahen aus, als sei sie zu Feuerholz zerhackt worden. Die Türen der Küchenschränkchen hatte man abgeschraubt. Die Schränke waren leer. Der winzige vierflammige Butangasherd schien seit Monaten nicht mehr benutzt worden zu sein.
Ich schaute nach links und ging durch einen kurzen Gang nach hinten in das kleine Schlafzimmer. Rechts führte eine Tür in ein Badezimmer mit einer kaputten chemischen Toilette und einem gezackten Loch in der Wand, wo einmal ein Waschbecken gewesen war; über der Duschwanne, in der jetzt Lumpen lagen, hing noch ein Stück Rohr. Das Schlafzimmer enthielt eine schäbige Matratze und einen zusammengerollten Doppelschlafsack mit Reißverschluss. Irgendjemand wohnte hier, aber ich glaubte nicht, dass es Irene Gershs Mutter war. Ich schaute aus dem Fenster, doch alles, was ich sah, war ein Stück brauner Wüste mit einer niedrigen Bergkette, zehn oder fünfzehn Meilen entfernt. Entfernungen täuschen hier draußen, weil es keine Markierungspunkte gibt.
Ich schlängelte mich zum Eingang zurück, ging hinaus und einmal um den Wohnwagen herum. Ein Eimer mit eingelegtem Plastiksack diente als Außenabort. Es lagen noch mehrere zugebundene Plastiksäcke herum, eine Brutstätte für schwarze Fliegen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite war auf einem zementierten Stellplatz ein Winnebago vertäut, so ein geräumiges Wohnmobil mit vier Schlafplätzen. Daneben stand ein Kleinlaster mit Campingaufsatz. Der Zementboden hatte Risse, in denen Unkraut wucherte. Ein Grill war im Freien aufgebaut, und der Geruch von Holzkohle und rauchenden Briketts wehte zu mir herüber. In der Nähe des Grills sah ich einen Klapptisch und drumherum ein paar nicht dazupassende Chromsessel.
Als ich die Straße überquerte, tauchte aus dem Wohnmobil eine Frau auf. Sie trug ein Tablett mit einem mit Folie zugedeckten Teller, Gewürzen und anderen Utensilien. Sie war in den Vierzigern, schlank, mit einem schmalen, wettergegerbten Gesicht. Kein Make-up, das grau melierte Haar ganz kurz. Sie trug Jeans und ein Flanellhemd, beides zu hellem Grau ausgebleicht. Ohne mich zu beachten, machte sie sich an ihre Arbeit. Ich sah zu, wie sie fünf dicke Buletten auf den Rost legte. Dann ging sie zum Tisch und fing an, ihn mit Gabeln und Papptellern zu decken.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Kennen Sie die Frau von gegenüber?«
»Sind Sie eine Verwandte?«
»Nein, eine Freundin der Familie.«
»Höchste Zeit, dass jemand sich kümmert«, sagte sie bissig. »Was dort drüben vorgeht, ist eine ganz üble Schande.«
»Was geht dort drüben vor?«
»Jugendliche sind eingezogen. Sie sehen ja, wie verwahrlost alles ist. Laute Partys, laute Streitereien, Prügeleien. Wir hier draußen lassen jeden nach seiner Fasson selig werden, aber es gibt Grenzen.«
»Was ist mit Agnes? Wo ist sie? Sie wohnt doch bestimmt nicht mehr hier.«
Die Frau hob den Kopf und schaute zum Wohnmobil hinüber. »Marcus? Kommst du bitte mal? Eine Frau fragt nach Old Mama.«
Die Tür des Winnebago ging auf, und ein Mann schaute heraus. Er war mittelgroß, feingliedrig, und seine Hautfarbe ließ auf eine romanische Abstammung schließen. Er hatte dunkles Haar, das er aus der Stirn zurückgekämmt trug, eine kurze, gerade Nase und sehr volle Lippen. Die Augen waren von schwarzen Wimpern umrahmt. Er sah aus wie ein männliches Model in einem Inserat für italienische Herrenbekleidung. Einen Augenblick lang musterte er mich unbeteiligt.
»Wer sind Sie?«, fragte er. Ohne Akzent. Er trug eine gebügelte Hose und ein geripptes Altmännerunterhemd.
»Ich heiße Kinsey«, sagte ich. »Die Tochter von Agnes Grey hat mich gebeten, herzufahren und mich nach ihr zu erkundigen. Haben Sie eine Ahnung, wo sie steckt?«
Überraschenderweise streckte er mir die Hand entgegen, um sich vorzustellen. Ich nahm sie. Sein Handteller war weich und heiß, sein Händedruck fest.
»Ich bin Marcus. Das ist meine Frau Faye. Wir haben Old Mama schon lange nicht mehr gesehen. Das muss Monate her sein. Wir haben gehört, dass sie krank geworden ist, aber ich weiß es nicht sicher. Das Krankenhaus ist in Brawley. Fragen Sie dort nach ihr.«
»Hätte man dann nicht ihre Familie verständigt?«
Schulterzuckend schob Marcus die Hände in die Taschen. »Sie hat möglicherweise verschwiegen, dass sie Familie hat. Ich höre es jetzt auch zum ersten Mal. Sie ist ein sehr zurückhaltender Mensch. Lebt fast wie eine Einsiedlerin. Kümmert sich um ihre eigenen Angelegenheiten, solange die anderen sich um die ihren kümmern und niemand ihre Kreise stört. Wo wohnt diese Tochter?«
»Santa Teresa. Sie macht sich Sorgen um ihre Mutter, hatte aber keine Möglichkeit, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.«
Die beiden schienen von Irene Gershs Besorgnis nicht so recht überzeugt zu sein. Ich wechselte das Thema und warf einen Blick zurück zu dem Caravan auf der anderen Straßenseite. »Wer ist das kleine Monster, das vorhin auf der Türschwelle gesessen hat?«
»Es sind zwei«, antwortete Faye mürrisch. »Junge und Mädchen. Sie sind vor ein paar Monaten hier aufgetaucht und haben sich den Wohnwagen unter den Nagel gerissen. Müssen gehört haben, dass er leer steht, denn sie sind sehr rasch eingezogen. Es sind bestimmt Ausreißer. Wovon sie leben, ist mir schleierhaft. Wahrscheinlich stehlen sie oder gehen auf den Strich, was sich eben so bietet. Wir haben sie gebeten, die Kloake zu säubern, aber sie denken nicht daran.«
»Kloake« war eine freundliche Umschreibung für die Säcke voller Scheiße. »Das Kind, das ich gesehen habe, kann noch nicht einmal zwölf gewesen sein«, sagte ich.
»Sie sind fünfzehn«, antwortete Faye. »Der Junge jedenfalls ist fünfzehn. Sie benehmen sich wie wilde Tiere, und ich weiß, dass sie Drogen nehmen. Sie durchsuchen immer unseren Abfall nach etwas Essbarem. Manchmal kommen andere Jugendliche und kampieren bei ihnen. Es hat sich rumgesprochen, dass sie hier eine sturmfreie Bude haben.«
»Können Sie sie nicht der Polizei melden?«
Marcus schüttelte den Kopf. »Haben wir schon versucht. Sie lösen sich sofort in Luft auf, wenn jemand kommt.«
»Könnte es zwischen Agnes’ Verschwinden und ihrem Einzug einen Zusammenhang geben?«
»Das bezweifle ich«, sagte er. »Sie war schon zwei oder drei Monate weg, als die beiden hier ankamen. Jemand hat ihnen vielleicht gesagt, dass der Caravan unbewohnt ist. Sie schienen nie zu befürchten, dass Old Mama zurückkommen könnte. Ich weiß, dass sie den Wagen so ziemlich auseinander genommen haben, aber wir können nicht viel dagegen tun.«
Ich gab ihm meine Karte. »Hier ist meine Nummer in Santa Teresa. Ich bleibe noch ein paar Tage hier und will versuchen, Agnes aufzuspüren. Danach können Sie mich unter der Vorwahl 805 erreichen. Würden Sie mich anrufen, wenn Sie von ihr hören? Bevor ich zurückfahre, komme ich noch mal vorbei. Zumindest will ich’s versuchen, für den Fall, dass Sie inzwischen etwas gehört haben sollten. Vielleicht fällt Ihnen noch etwas ein, das mir helfen könnte.«
Faye schaute über seine Schulter auf die Karte, die ich ihm gegeben hatte. »Sie sind Privatdetektivin? Ich hab gedacht, Sie sind mit der Familie befreundet?«
»Ich bin beides – befreundet und angeheuert«, sagte ich. Ich ging schon zu meinem Wagen, als er meinen Namen rief. Ich drehte mich um und sah ihn an.
»In Niland gibt es ein Sheriffbüro, auf der First Street, gleich neben dem Gefängnis. Fragen Sie den Deputy. Es ist durchaus möglich, dass sie tot ist.«
»Daran habe ich natürlich auch schon gedacht«, sagte ich. Sein Blick hielt den meinen kurz fest, dann ging ich weiter.
Ich fuhr nach Niland zurück. Fünfundvierzig Meter unter dem Meeresspiegel, zwölfhundert Einwohner. Das alte Gefängnis ist ein winziges, weiß verputztes Gebäude mit verwittertem Schindeldach und einem nur als Dekoration dienenden eisernen Rad, das an der hölzernen Verandabrüstung befestigt ist. Im Haus nebenan, keine drei Meter entfernt, sind das neue Gefängnis und der Außenposten des Sheriffbüros untergebracht; es ist ebenfalls weiß verputzt und nicht viel breiter als eine Tür und zwei Fenster. Eine Klimaanlage ragt aus einem Seitenfenster.
Ich parkte vor dem Haus. An der Eingangstür hing ein Zettel. Bin um vier zurück. In Notfällen oder anderen dienstlichen Angelegenheiten wenden Sie sich an das Sheriffbüro in Brawley. Keinerlei Hinweis darauf, wie man sich mit dem Sheriffbüro in Brawley in Verbindung setzen konnte.
Ich fuhr zu einer Tankstelle und ging, während der Wagen aufgetankt wurde, zu einem Münztelefon, wo ich mir aus dem eselsohrigen Telefonbuch, das an die Wand gekettet war, die Nummer des Sheriffbüros heraussuchte. Nach der angegebenen Adresse zu schließen, war es von meinem Motel an der Main Street nicht weit entfernt. Ich rief an und erfuhr, dass Sergeant Pokrass, der Deputy, mit dem ich sprechen sollte, beim Lunch war und um ein Uhr zurückkommen würde. Ein Blick auf meine Uhr zeigte mir, dass es zehn vor eins war.
Die Dienststelle des Sheriffbüros in Brawley ist ein ebenerdiges Gebäude mit rotem Ziegeldach, direkt gegenüber dem Polizeirevier auf der anderen Straßenseite. Auf dem kleinen Parkplatz standen zwei weiße Sheriffwagen. Durch eine Glastür betrat ich das Haus.
Ein Pepsi-Automat beherrschte den Korridor. Links vom Eingang war eine geschlossene Tür, hinter der ein Gerichtssaal lag, wie das Türschild besagte. Auf der anderen Seite waren zwei kleine Büros mit einer offen stehenden Verbindungstür. Auf Hochglanz poliertes Linoleum auf dem Boden, die Tresenplatten aus Kunststoff, Schreibtische aus hellem Holz, metallene Aktenschränke und Drehsessel. Zwei Deputys und ein Zivilangestellter waren anwesend; letzterer telefonierte. Das leise Stimmengemurmel wurde untermalt vom stetigen, leisen Knacken und Krächzen des Polizeifunks.
Deputy Pokrass war eine Frau in den Dreißigern, hoch gewachsen und straff, mit kurzen blonden Haaren und einer Brille mit Schildpattrahmen. Die braune Uniform saß wie maßgeschneidert: funktional, ohne Kinkerlitzchen. Ihr Gesicht hatte keinen besonders lebhaften Ausdruck. Ihre Augen waren von einem durchdringenden Braun und ziemlich kalt. Sie wirkte zwar nicht direkt unhöflich, aber auf eine eher schroffe Weise sachlich. Wir verschwendeten nicht viel Zeit mit Vorreden. Ich stand vor dem kurzen Tresen und erklärte ihr die Situation, wobei ich mich kurz und präzise fasste. Sie hörte aufmerksam und ohne Zwischenfrage zu und griff, als ich fertig war, zum Telefon. Sie rief das Ortskrankenhaus – Pioneers Memorial – an und ließ sich mit der Verwaltung verbinden. Ihre Stimme wurde ein ganz kleines bisschen wärmer, während sie mit einer Person namens Letty sprach. Sie zog einen gelben Dienstblock näher zu sich heran, nahm einen perfekt gespitzten Bleistift zur Hand und machte sich ein paar Notizen; ihre Schrift war voller Ecken und Kanten. Ich war sicher, dass sie nicht einmal im zarten Alter von zwölf Jahren ein fröhliches Gesicht gemacht hatte, wenn sie einem i sein Tüpfelchen aufsetzte. Sie legte auf und benutzte ein Lineal, um den Papierstreifen abzutrennen, auf den sie die Adresse notiert hatte.
»Agnes Grey wurde am 5. Januar mit dem Krankenwagen ins Pioneers eingeliefert. Sie war vor einem Café in Downtown zusammengebrochen. Die Diagnose des Aufnahmearztes lautete auf Lungenentzündung, Unterernährung, akute Entwässerung und Altersschwachsinn. Am 2. März wurde sie ins Rio Vista Convalescent Hospital überführt. Das ist die Adresse. Geben Sie uns Bescheid, wenn Sie sie dort finden. Wenn nicht, können Sie wieder herkommen und eine Vermisstenmeldung ausfüllen. Wir werden tun, was wir können.«
Ich warf einen Blick auf das Papier, faltete es zusammen und steckte es in die Tasche meiner Jeans. »Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.« Als ich den Satz endlich herausbekam, hatte sie sich schon abgewandt und tippte wieder eifrig an ihrem Bericht. Ich benutzte die Hand, die ich ihr reichen wollte, um mich an der Nase zu kratzen, und kam mir vor wie jemand, der ein Winken erwidert und dann feststellen muss, dass der fröhliche Gruß jemand anderem gegolten hat.
Als ich zu meinem Wagen ging, kam mir der Gedanke, dass man mir in diesem Genesungsheim vielleicht gar keine Auskunft über Agnes Grey geben würde. Wenn sie noch Patientin war, bekam ich wahrscheinlich ihre Zimmernummer und durfte zu ihr hinein. Aber wenn sie schon entlassen worden war, würde es möglicherweise schwieriger werden. Das Krankenhauspersonal ist nicht mehr so geschwätzig wie früher. Es gab schon zu viele Prozesse wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Ich darf mir meine Chancen nicht verderben, dachte ich.
Ich fuhr ins »Vagabond« zurück, zog den Reißverschluss meiner Segeltuchtasche auf, nahm mein »Kleid für alle Gelegenheiten« heraus und schüttelte es kräftig. Dieses treue Stück ist das einzige Kleid, das ich besitze, aber ich bin darin immer richtig angezogen. Es ist schwarz, kragenlos, mit langen Ärmeln und einem Reißverschluss im Rücken, aus einem glatten Zauberstoff, dem man einfach alles antun kann, ohne dass er Schaden nimmt. Man kann darauf sitzen, kann es zerdrücken, zerknüllen, zu einem Strick drehen oder zu einem Knäuel zusammenrollen. In der Sekunde, in der man es auseinander faltet und ausschüttelt, nimmt es seine ursprüngliche Form wieder an. Ich wusste nicht einmal mehr so genau, warum ich es mitgebracht hatte – wahrscheinlich weil ich hoffte, in der Stadt eine heiße Nacht zu erleben. Ich warf das Kleid aufs Bett, zusammen mit meinen (ein bisschen abgestoßenen) flachen schwarzen Schuhen und einer schwarzen Strumpfhose. Ich gönnte mir eine Drei-Minuten-Dusche, saß dreizehn Minuten später wieder im Wagen und sah wie eine ernst zu nehmende Erwachsene aus, hoffte ich wenigstens.
Das Rio Vista Convalescent Hospital lag mitten in einer Wohngegend – ein einstöckiges stuckverziertes Gebäude in einem trüb aussehenden Navajo-Weiß. Das Grundstück war von einem Maschendrahtzaun umgeben, das breite Tor zum Parkplatz stand offen. Ein solches Krankenhaus hatte ich noch nie gesehen. Das Gelände drumherum war flach, nicht bepflanzt und bestand hauptsächlich aus gesprungenem Asphalt, auf dem die Wagen parkten. Als ich mich dem Eingang näherte, sah ich, dass der brüchige Asphalt mit merkwürdigen verblassten Kreisen und Vierecken bemalt war. Erst als ich in der Halle stand, ging mir auf, was ich gesehen hatte. Ein Spielfeld. Das war einmal eine Grundschule gewesen. Hier hatte man einst Ball gespielt. Im Innern des Gebäudes sah es fast genauso aus wie in der Grundschule, die ich besucht hatte. Hohe Räume, Holzfußböden, Lampen, die wie kleine runde Monde aussahen. An der Wand mir gegenüber stand noch immer ein Trinkbrunnen, weißes Porzellan mit chromglänzenden Armaturen, so niedrig angebracht, dass auch kleinere Kinder sie erreichten. Es roch sogar genauso – nach Gemüsesuppe. Für einen Moment war die Vergangenheit greifbar nah, legte sich wie ein Stück Cellophan über die Wirklichkeit und löschte sie aus. Die gleiche Angst, die mich an jedem Tag meiner Jugend gepeinigt hatte, überfiel mich hier. Ich hatte die Schule verabscheut. Immer wieder wurde ich von den Gefahren überwältigt, die ich in allen Ecken lauern sah. Die Schule war gefährlich. Es gab unendlich viele Hürden: Prüfungen in Rechtschreiben, Geographie und Mathe, Hausaufgaben, unangesagte mündliche Tests und Arbeitshefte. Alles, was man tat, wurde beurteilt, kritisiert, benotet, besprochen. Musik war das einzige Fach, das ich mochte, weil man ins Buch schauen durfte, obwohl man manchmal auch aufstehen und ganz allein vorsingen musste, und das war die Hölle. Die anderen Kinder waren noch schlimmer als der Unterricht. Ich war klein für mein Alter und immer Zielscheibe von Angriffen. Meine Mitschüler waren schlau und hinterhältig und heckten alle möglichen bösartigen Streiche aus, die sie dem Fernsehen abschauten. Und wer sollte mich vor ihren Gemeinheiten schützen? Die Lehrer halfen nicht. Wenn ich die Fassung verlor, bückten sie sich, bis sie mit mir auf gleicher Höhe waren, und ihre Gesichter füllten mein Gesichtsfeld aus wie stürzende Planeten, die sich gleich in die Erde bohren würden. Wenn ich heute zurückblicke, begreife ich, wie sehr ich sie beunruhigt haben muss. Ich war eines jener Kinder, die anscheinend ganz ohne Grund ständig jämmerlich weinten oder kotzten. An Tagen, an denen ich besonders verängstigt war, tat ich manchmal beides. In der fünften Klasse war ich fast ununterbrochen in Schwierigkeiten. Ich war nicht rebellisch – dazu war ich zu schüchtern –, aber ich gehorchte nicht, missachtete die Vorschriften. Nach dem Lunch, zum Beispiel, versteckte ich mich auf dem Mädchenklo, anstatt zum Unterricht zu gehen. Ich sehnte mich danach, hinausgeworfen zu werden, bildete mir irgendwie ein, ich wäre für immer von der Schule befreit, wenn sie mich rauswarfen. Ich erreichte mit meinem Verhalten jedoch nur, dass ich immer wieder zum Rektor zitiert wurde oder endlose Stunden mitten in der Halle auf einem kleinen Stuhl sitzen musste. Öffentlich angeprangert, gewissermaßen. Meine Tante stürzte sich wie ein Racheengel auf den Rektor und machte ihm einen höllischen Krach, weil er mich einer so unmenschlichen Prozedur aussetzte. Tatsächlich fühlte ich mich nur das erste Mal gedemütigt. Später gefiel es mir recht gut, in der Halle zu sitzen. Es war still. Ich war allein. Niemand stellte mir Fragen oder zwang mich, etwas an die Tafel zu schreiben. In den Pausen sahen die anderen Kinder mich kaum an, sie schämten sich für mich.
»Miss?«
Ich blickte auf. Eine Frau in Schwesterntracht stand vor mir. Ich konzentrierte mich auf meine Umgebung. Jetzt sah ich, dass im Korridor mehrere Rollstühle geparkt waren. Die Insassen waren alt und gebeugt. Einige starrten stumpf auf den Boden, andere wimmerten vor sich hin. Eine Frau wiederholte nörgelnd und endlos: »Jemand soll mich hier rausholen. Jemand soll mich rauslassen. Jemand soll mich hier rausholen ...«
»Ich suche Agnes Grey.«
»Patientin oder Angestellte?«
»Eine Patientin. Zumindest war sie es vor etwa zwei Monaten.«
»Versuchen Sie es in der Verwaltung.« Die Schwester zeigte auf die Büros zu meiner Rechten. Ich riss mich zusammen und wandte den Blick von den Schwachen und Gebrechlichen ab. Vielleicht führt das Leben in einer schnurgeraden Linie von den Schrecken der Schule zu den Schrecken eines Pflegeheims.
Die Verwaltung war provisorisch in Räumen untergebracht, in denen früher vermutlich der Schulleiter residiert hatte. Ein Teil der weitläufigen Eingangshalle war durch Glaswände abgeteilt worden; in dem so entstandenen kleinen Raum befand sich jetzt die Aufnahme. Ich wartete vor dem Schalterfenster, bis eine Frau mit einem Arm voll Akten aus dem Büro kam, das hinter dem Glaskäfig lag. Sie erblickte mich und steuerte mit einem unpersönlichen Lächeln auf mich zu. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Hoffentlich«, sagte ich. »Ich suche eine Frau namens Agnes Grey. So viel ich weiß, war sie vor ein paar Monaten hier Patientin.«
Die Frau zögerte kurz und sagte dann: »Darf ich fragen, warum Sie sich für sie interessieren?«
Ich entschloss mich, es mit der Wahrheit zu versuchen, ohne zu ahnen, wie beliebt ich mich dadurch machen sollte. Ich gab ihr meine Karte und erzählte meine Geschichte von Irene Gersh, die mich gebeten hatte, ihre Mutter zu finden; ich schloss mit der Frage, die ich schon so oft gestellt hatte: »Wissen Sie zufällig, wo sie jetzt ist?«
Sie sah mich einen Moment blinzelnd an. Irgendein innerer Prozess bewirkte eine Veränderung in ihren Zügen, mir war jedoch nicht klar, wie das mit meiner Bitte zusammenhing. »Entschuldigen Sie mich.«
»Aber gern.«
Sie verschwand wieder im hinteren Büro und erschien einen Augenblick später mit einer zweiten Frau, die sich als »Elsie Haynes, Leiterin dieses Hauses« vorstellte. Sie war vermutlich in den Sechzigern, rundlich, und sie hatte eine Frisur, die, schnurrbartkurz im Nacken, durch ein Haarteil rötlich brauner Locken ergänzt wurde. Dadurch wirkte ihr Gesicht zu groß für ihren Kopf. Sie lächelte mir jedoch überaus liebenswürdig zu. »Miss Millhone, wie ganz, ganz reizend!«, sagte sie, beide Hände ausstreckend. Der Händedruck gestaltete sich zu einer Art Sandwich, von ihren Händen gebildet, mit meiner Hand als Lunchfleisch dazwischen. »Ich bin Mrs. Haynes, aber Sie müssen mich Elsie nennen. So – was kann ich für sie tun?«
Das war beunruhigend. Einen solchen Empfang bin ich in meinem Beruf nicht gewöhnt. »Freut mich, Sie kennen zu lernen«, sagte ich. »Ich versuche den Aufenthaltsort einer gewissen Agnes Grey festzustellen. Man hat mir gesagt, sie sei aus dem Pioneers hierher verlegt worden.«
»Das ist richtig. Mrs. Grey ist seit Anfang März bei uns. Sie werden sie bestimmt sehen wollen, daher habe ich die Etagenaufsicht zu uns gebeten. Sie wird Sie zu Mrs. Greys Zimmer begleiten.«
»Wunderbar. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Offen gesagt, habe ich nicht erwartet, sie hier zu finden. Ich dachte, sie sei längst wieder draußen. Geht es ihr gut?«
»O Gott, ja. Es geht ihr viel besser – recht gut –, aber sie müsste ständig jemanden um sich haben, der sie versorgt. Wir können Patienten nicht entlassen, die nicht wissen, wohin. Soweit uns bekannt ist, hat Mrs. Grey keine feste Adresse, und sie hat uns nie anvertraut, dass es Verwandte gibt. Wir sind überglücklich zu hören, dass sie eine Tochter in diesem Staat hat. Ich bin überzeugt, Sie werden Mrs. Gersh bald Bericht erstatten und alles in die Wege leiten, damit Mrs. Grey in ein Pflegeheim nach Santa Teresa verlegt wird.«
Ah. Ich merkte, dass ich nickte. Das Mäntelchen selbstloser Fürsorge wurde fadenscheinig. Ich versuchte es jetzt selbst mit einem Reklamelächeln, um mich nicht in Irene Gershs Namen zu irgendetwas zu verpflichten. »Ich weiß nicht, was Mrs. Gersh tun will und wird. Ich habe versprochen, sie anzurufen, sobald ich festgestellt habe, was los ist. Sie wird wahrscheinlich mit Ihnen sprechen wollen, bevor sie eine Entscheidung trifft, aber ich nehme an, dass sie mich bitten wird, Agnes nach Santa Teresa mitzubringen.«
Elsie und ihre Assistentin wechselten einen Blick.
»Gibt es da ein Problem?«
»Nun, nein«, sagte sie. Ihr Blick schweifte zur Tür. »Das ist Mrs. Renquist, die zuständige Aufsicht. Ich glaube, sie ist diejenige, mit der Sie die Sache gründlich besprechen sollten.«
Eine neue Vorstellungsrunde, neue Erklärungen. Mrs. Renquist war etwa fünfundvierzig, dünn und sonnengebräunt mit einem großen, freundlichen Mund und der fahlen, faltigen Haut der starken Raucherin. Das kastanienbraune Haar hatte sie im Nacken zu einem straffen Knoten geschlungen, der wie ein Krapfen aussah, wahrscheinlich mit Unterstützung eines jener leicht verformbaren Nylondinger, die man bei Woolworth kaufen kann. Die drei Frauen standen um mich herum wie drei weltliche Nonnen, die unaufhörlich auf mich einmurmelten und irgendetwas beteuerten. Ein paar Minuten später eilten Mrs. Renquist und ich durch den Korridor zu ihrer Abteilung.