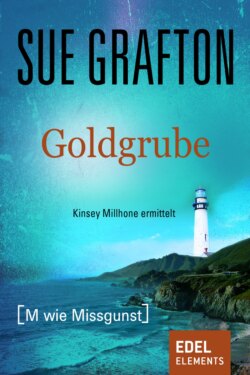Читать книгу Goldgrube - Sue Grafton - Страница 8
4
ОглавлениеIch fuhr wieder ins Büro, tippte den Umschlag, stellte dem Staat einen Scheck aus und befestigte ihn an dem Formular, klebte außen eine Briefmarke auf und warf das Ganze in die Ablage für den Postausgang. Dann nahm ich den Telefonhörer ab und rief Darcy Pascoe an, die Sekretärin und Empfangsdame von der California Fidelity Insurance. Wir plauderten ein Weilchen über die alten Zeiten, und ich ließ mich über die neuesten Banalitäten informieren, bevor ich sie um das gleiche bat wie die Angestellte bei der Kfz-Zulassungsstelle. Versicherungen machen ständig Überprüfungen durch die Zulassungsstelle. Darcy war zwar eigentlich nicht zu Anfragen berechtigt, aber sie wußte so gut wie jeder andere, wie man die Vorschriften umging. Ich sagte: »Ich brauche lediglich eine Auskunft.«
»Bis wann?«
»Ich weiß nicht. Wie wär’s morgen in aller Frühe?«
»Wahrscheinlich schaffe ich das, aber es wird dich einiges kosten. Wie heißt dieser Knabe noch mal?«
Als ich nach Hause kam, brannte Licht in meiner Wohnung, aber Dietz war immer noch irgendwo unterwegs. Er hatte einen Koffer mitgebracht, den er neben das Sofa gestellt hatte. Ein rascher Blick in den Schrank brachte seinen aufgehängten Kleidersack zum Vorschein. Im unteren Badezimmer stand sein Waschbeutel auf dem Deckel der Toilettenspülung. Der Raum roch nach Seife, und ein feuchtes Handtuch hing über der Duschkabine. Ich ging wieder in die Küche und stellte das Radio an. Elvis sang gerade den Schlußrefrain von »Can’t Help Falling In Love«.
»Verschone mich«, sagte ich mißmutig und schaltete das Ding aus. Ich stieg die Wendeltreppe zum Dachgeschoß hinauf, wo ich meine Reeboks abstreifte und mich auf dem Bett ausstreckte. Ich starrte zum Oberlicht hinauf. Es war schon nach fünf Uhr, und die Dunkelheit war über uns gefallen wie eine Wolldecke, ein bleiernes, undurchdringliches Grau. Durch die Plexiglaskuppel konnte ich wegen der Bewölkung nicht einmal den Nachthimmel sehen. Ich war müde und hungrig und irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Allein zu leben kann verwirrend sein. Einerseits sehnt man sich manchmal nach dem simplen Trost eines Gefährten: jemand, mit dem man seinen Tag besprechen kann, jemand, mit dem man eine Gehaltserhöhung oder eine Steuerrückzahlung feiern kann, jemand, der einen bemitleidet, wenn man erkältet im Bett liegt. Hat man sich allerdings erst mal ans Alleinsein gewöhnt (also daran, daß man machen kann, was man will), muß man sich andererseits fragen, warum man die Beschwernis einer Beziehung auf sich nehmen soll. Andere Menschen haben so viele hitzig verfochtene Ansichten, Eigenschaften und Macken, häufig einen schlechten Kunst- und Musikgeschmack, ganz zu schweigen von Stimmungsschwankungen, Eßgewohnheiten, Vorlieben, Hobbys, Allergien, emotionalen Fixierungen und Einstellungen, die in keiner Weise mit den korrekten, nämlich den eigenen, übereinstimmen. Natürlich dachte ich nicht ernsthaft in diesem Sinne an Robert Dietz, aber sowie er meine Wohnung betreten hatte, hatte ich ein störendes »Anderssein« an ihm festgestellt. Nicht daß er aufdringlich, unverschämt oder schlampig gewesen wäre. Er war nur einfach da, und seine Anwesenheit wirkte wie ein Reizstoff auf mich. Ich meine, wohin sollte das führen? Meiner Erfahrung nach nirgendwohin. Ich hätte mich gerade an ihn gewöhnt, wenn er sich wieder auf die Socken machen würde. Also warum sollte ich mir erst die Mühe machen, mich anzupassen, wenn seine Anwesenheit ohnehin nicht von Dauer war? Ich persönlich halte Flexibilität für keinen besonders wünschenswerten Charakterzug.
Ich hörte, wie sich ein Schlüssel im Schloß drehte, und stellte erschrocken fest, daß ich eingedöst war. Ich setzte mich auf und blinzelte verwirrt. Eine Etage unter mir machte Dietz die Lichter an. Ich hörte das Knistern von Papier. Ich stand auf, ging ans Treppengeländer hinüber und sah zu ihm hinab. Er stellte das Radio an. Ich stopfte mir die Finger in die Ohren, damit ich Elvis nicht dabei zuhören mußte, wie er herzzerreißend von der Liebe sang. Wer braucht diesen Scheiß schon? Dietz war ein großer Fan von Country-Musik, und ich hoffte, er würde den Sender wechseln und nach etwas Fetzigerem und weniger Anzüglichem suchen. Er spürte meine Gegenwart und drehte sein Gesicht in meine Richtung. »Gut. Du bist zu Hause. Ich habe dein Auto draußen gar nicht gesehen«, sagte er. »Ich habe ein paar Lebensmittel eingekauft. Hilfst du mir auspacken?«
»Ich komme in einer Minute.« Ich machte einen kurzen Abstecher ins Badezimmer, wo ich mir mit dem Kamm durch die Haare fuhr und die Zähne putzte. Ich hatte ganz vergessen, wie häuslich Dietz sein konnte. Wenn ich an diesen Mann dachte, fiel mir immer als erstes ein, daß er Experte für Personenschutz war. Ich tappte auf Socken die Treppe hinunter. »Woher hast du denn gewußt, was wir brauchen?«
»Ich habe nachgesehen. Große Überraschung. Die Schränke waren leer.« Er hatte die Kühlschranktür geöffnet und legte Eier, Speck, Butter, Fleisch und verschiedene andere Waren mit viel Fett und hohem Cholesteringehalt in die Fächer. Auf dem Tresen standen ein Sechserpack Bier, zwei Flaschen Chardonnay, Erdnußbutter mit extra viel Nußstückchen, mehrere Konservendosen und verschiedene Gewürze sowie ein Laib Brot. Er hatte sogar an Papierservietten, Küchenkrepp, Toilettenpapier und Spülmittel gedacht. Ich legte die Konserven in den Vorratsschrank und stellte das Radio aus. Falls es Dietz auffiel, sagte er nichts.
Über die Schulter fragte er: »Wie ist das Gespräch gelaufen?«
»Gut«, antwortete ich. »Ich habe nicht die geringsten Fortschritte gemacht, aber irgendwo muß man ja anfangen.«
»Was ist dein nächster Schritt?«
»Ich lasse Darcy über die Versicherung, für die ich früher gearbeitet habe, eine Anfrage bei der Zulassungsstelle machen. Sie hofft, daß sie morgen früh etwas für mich hat. Dann sehen wir weiter. Ich habe zwar noch andere Ansatzpunkte, aber sie ist bis jetzt meine beste Chance.«
»Du arbeitest nicht mehr für California Fidelity?«
»Offen gestanden nein. Sie haben meinen Arsch vor die Tür gesetzt, weil ich niemandem in seinen kriechen wollte. Ich habe ein Büro in einer Anwaltskanzlei gemietet. Es läuft besser so.«
Ich sah ihm an, daß er noch andere Fragen auf Lager hatte, aber er kam wohl zu dem Schluß, daß es besser war, wenn er so wenig wie möglich sagte.
Er wechselte das Thema. »Kann ich dich dazu überreden, essen zu gehen?«
»An was hast du denn gedacht?«
»An etwas, wo man zu Fuß hingehen kann und wo wir uns nicht in Schale werfen müssen.«
Ich sah ihn einen Augenblick lang an und empfand einen seltsamen Widerwillen dagegen, zuzustimmen. »Wie geht’s dem alten Freund?«
Dietz unterdrückte ein Lächeln. »Gut. Ist es das, was dich bedrückt?«
»Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin schon seit Wochen deprimiert und habe es jetzt erst eingesehen. Außerdem bin ich nervös wegen des Auftrags. Ich arbeite für meine Cousine Tasha, was ich vermutlich lieber lassen sollte.«
»Eine Cousine? Das ist mir neu. Wo kommt die denn her?«
»Mann, du bist ja wirklich nicht auf dem laufenden.«
»Schnapp dir eine Jacke und laß uns gehen. Du kannst mir beim Essen davon erzählen und mich auf den neuesten Stand bringen.«
Wir gingen zu Fuß von meiner Wohnung zu einem Restaurant am Wellenbrecher, drei lange Häuserblöcke weit, und sprachen dabei wenig. Der Abend war sehr kalt, und die Lichter über dem Hafen sahen aus wie übriggebliebene Weihnachtsdekorationen. Über das leise Rauschen der Brandung hinweg konnte ich das Bimmeln einer Boje hören, deren blechernes Geräusch sich mit dem sachten Klatschen des Wassers gegen die im Jachthafen liegenden Boote vermischte. Viele Schiffe waren erleuchtet, und ihre Bewohner, die gelegentlich in mein Blickfeld gerieten, ließen mich an einen Wohnwagenpark denken, eine Gemeinschaft behaglicher Räume, die von außen Geborgenheit vermittelten. Dietz ging sehr schnell. Er hielt den Kopf gebeugt, hatte die Hände in die Taschen gesteckt, und seine Absätze klickten auf dem Bürgersteig. Ich hielt mit ihm Schritt, und in Gedanken ging ich durch, was ich über ihn wußte.
Er war unter seltsamen Umständen groß geworden. Wie er mir erzählt hatte, war er auf einer Straße bei Detroit in einem Wohnmobil zur Welt gekommen. Seine Mutter lag in den Wehen, und sein Vater war zu ungeduldig gewesen, um eine Klinik aufzusuchen. Sein Vater war ein Raufbold und Schläger, der auf den Ölfeldern arbeitete und seine Familie von einer Stadt in die nächste verschleppte, wenn ihm gerade der Sinn danach stand. Dietz’ Großmutter, die Mutter seiner Mutter, reiste im jeweils vorhandenen Fahrzeug mit ihnen – einem Lastwagen, einem Wohnmobil oder einem Kleinbus, allesamt aus zweiter Hand und stets in Gefahr, liegenzubleiben oder eilig verkauft zu werden, wenn das Geld ausging. Dietz war mit Hilfe einer Sammlung alter Schulbücher unterrichtet worden, während seine Mutter und seine Großmutter Biere kippten und die Dosen aus dem Fenster auf den Highway warfen. Seine Abneigung gegen förmlichen Schulunterricht war etwas, das wir gemeinsam hatten. Da er so wenig Erfahrung mit Institutionen hatte, war er extrem aufsässig. Er ignorierte Vorschriften, weil er davon ausging, daß sie ihn nicht betrafen. Mir gefiel sein rebellisches Wesen. Aber gleichzeitig war ich auf der Hut. Ich war für Vorsicht und Kontrolle. Er war für Anarchie.
Wir erreichten das Restaurant, den Tramp Steamer, ein enges und überheiztes Lokal, das eine schmale Treppe hoch in einem grauen Holzhaus lag. Man hatte sich ansatzweise darum bemüht, dem Lokal einen seemännischen Anstrich zu geben, aber die wirkliche Attraktion war das Essen: frische Austern, fritierte Garnelen, pfeffrige Muschelsuppe und selbstgebackenes Brot. Gleich neben dem Eingang gab es eine komplett ausgestattete Bar, doch der Großteil der Kundschaft bevorzugte Bier. Die Luft war erfüllt vom Geruch des Hopfens und von Zigarettenrauch. Bei der dröhnenden Musikbox, dem heiseren Gelächter und den Gesprächen konnte man den Lärm fast mit Händen greifen. Dietz sah sich nach Sitzplätzen um, drückte dann eine Seitentür auf und fand einen Tisch für uns auf der Veranda, die auf den Jachthafen hinausging. Draußen war es ruhiger, und die kalte Luft wurde vom roten Glühen der an den Wänden befestigten Propangasstrahler abgewehrt. Der salzige Geruch des Ozeans kam mir hier oben intensiver vor als unten. Ich holte tief Luft und sog sie in meine Lungen wie Äther. Sie besaß die gleiche beruhigende Wirkung, und ich merkte, wie ich mich entspannte.
»Möchtest du einen Chardonnay?« fragte er.
»Gerne.«
Ich blieb am Tisch sitzen, als er wieder hinein an die Bar ging. Ich sah ihm durchs Fenster dabei zu, wie er mit dem Barkeeper sprach. Während er auf die Getränke wartete, wanderte sein Blick ruhelos über die Gäste hinweg. Er ging zur Musikbox hinüber und studierte die Auswahl. Dietz war der Typ Mann, der auf und ab geht und mit den Fingern klopft, weil in ihm ständig eine unterschwellige Energie brodelt und an die Oberfläche drängt. Ich sah ihn selten ein Buch lesen, weil er nicht so lange still sitzen konnte. Wenn er jedoch las, war er nicht ansprechbar und blieb völlig in seine Lektüre versunken, bis er fertig war. Er mochte Wettkämpfe. Er mochte Schußwaffen. Er mochte Maschinen. Er mochte Werkzeuge. Er mochte Bergsteigen. Seine Grundeinstellung war: »Wofür sparst du dich auf?« Meine Grundeinstellung war: »Nur nichts überstürzen.«
Dietz spazierte wieder an die Bar zurück, stellte sich hin und klimperte mit dem Kleingeld in seiner Hosentasche. Der Barkeeper stellte einen Krug Bier und ein Glas Wein auf den Tresen. Dietz blätterte ein paar Scheine hin und kam wieder auf die Veranda heraus. Der Geruch von Zigarettenrauch wehte hinter ihm drein wie ein seltsames Rasierwasser. Er sagte: »Die Bedienung ist lahm. Hoffentlich ist das Essen gut.« Wir stießen miteinander an, bevor wir tranken, obwohl ich nicht wußte, worauf.
Ich klappte die Speisekarte auf und überflog die Auswahl. Eigentlich hatte ich keinen richtigen Hunger. Vielleicht einen Salat oder eine Suppe. Abends esse ich meist nicht viel.
»Ich hab die Jungs angerufen«, bemerkte er.
»Und wie geht’s ihnen?« fragte ich. Ich hatte seine beiden Söhne nie kennengelernt, aber er sprach mit Zuneigung von ihnen.
»Prima. Es sind tolle Jungs«, sagte er. »Nick wird am vierzehnten einundzwanzig. Er ist in seinem letzten Jahr in Santa Cruz, aber er hat gerade sein Hauptfach gewechselt, also wird er vermutlich noch ein Jahr dort bleiben. Graham ist neunzehn und hat sein erstes Jahr hinter sich. Sie teilen sich derzeit eine Wohnung mit ein paar anderen Typen. Das College gefällt ihnen, und sie scheinen motiviert zu sein. Mehr als ich je war. Naomi hat gute Arbeit geleistet, ohne viel Beistand meinerseits. Ich habe sie finanziell unterstützt, aber ich kann nicht behaupten, daß ich mich häufig bei ihnen gezeigt hätte. Deswegen habe ich zwar ein schlechtes Gewissen, aber du kennst mich ja. Ich bin immer auf Achse. Ich kann es nicht ändern. Ich könnte mich nie irgendwo niederlassen, ein Haus kaufen und von neun bis fünf arbeiten. Damit käme ich nicht klar.«
»Wo ist Naomi?«
»In San Francisco. Sie hat Jura studiert. Ich habe ihr das Studium bezahlt – in der Hinsicht bin ich anständig –, aber die harte Arbeit hat sie allein bewältigt. Die Jungs sagen, sie heiratet demnächst dort oben einen Anwalt.«
»Gut für sie.«
»Und du? Was hast du gemacht?«
»Nicht viel. Vor allem gearbeitet. Ich fahre nicht in Urlaub, also bin ich nirgendwo gewesen, außer wenn ich jemanden beobachtet oder Erkundigungen eingezogen habe. Ich habe einen tollen Unterhaltungswert.«
»Du solltest mal lernen, dich zu amüsieren.«
»Ich sollte eine ganze Menge lernen.«
Die Kellnerin kam von einem anderen Tisch auf der Veranda zu uns herüber. »Haben Sie gewählt?« Sie war schätzungsweise Ende Zwanzig, honigblond mit einem Jungenhaarschnitt und einer Zahnspange. Sie trug schwarze Shorts und ein dazu passendes schwarzes Top, als hätten wir August und nicht den achten Januar.
»Einen Moment noch«, sagte Dietz.
Schließlich teilten wir uns eine große Schüssel gedämpfter Muscheln, die in einer gut gewürzten Tomatensoße lagen. Als Hauptgang hatte Dietz ein Steak und ich einen üppigen Salat. Wir aßen beide wie um die Wette. Früher hatten wir es beim Sex genauso gemacht, als wäre es ein Wettbewerb, bei dem es darum ging, wer zuerst ans Ziel kam.
»Erzähl mir von deiner Depression«, sagte er, nachdem er seinen Teller beiseite geschoben hatte.
Ich machte eine abwehrende Handbewegung. »Vergiß es. Ich habe keine Lust, herumzusitzen und mir selbst leid zu tun.«
»Komm schon. Du darfst.«
»Ich weiß, daß ich darf, aber was soll das?« sagte ich. »Ich kann dir nicht mal sagen, woran es liegt. Vielleicht stimmt mein Serotoningehalt nicht.«
»Das sowieso, aber was noch?«
»Das Übliche vermutlich. Ich meine, an manchen Tagen kapiere ich einfach nicht, was wir auf diesem Planeten treiben. Ich lese die Zeitung, und es ist hoffnungslos. Armut und Seuchen, der ganze Schwachsinn von den Politikern, die dir alles erzählen würden, nur um gewählt zu werden. Dazu noch das Ozonloch und die Zerstörung der Regenwälder. Was soll ich das denn alles hintun? Ich weiß, daß es nicht meine Aufgabe ist, die Probleme der Welt zu lösen, aber ich würde gern daran glauben, daß es irgendwo eine verborgene Ordnung gibt.«
»Viel Glück.«
»Allerdings, viel Glück. Auf jeden Fall bin ich auf der Suche nach Antworten. Die meiste Zeit nehme ich das Leben einfach als selbstverständlich hin. Ich tue, was ich tue, und es scheint einen Sinn zu haben. Hin und wieder verliere ich aus den Augen, wo mein Platz ist. Ich weiß, das klingt lahm, aber es ist die Wahrheit.«
»Wie kommst du darauf, daß es überhaupt Antworten gibt?« sagte er. »Man tut eben sein Bestes.«
»Woraus auch immer das besteht«, bemerkte ich.
»Da liegt ja der Hase im Pfeffer.« Er lächelte. »Und was ist mit der Arbeit? Was macht dir daran angst?«
»Vor einer großen Sache stehe ich immer unter Strom. Irgendwann versage ich einmal, und dieser Gedanke behagt mir nicht. Es ist wie Lampenfieber.«
»Wo kommt eigentlich diese Cousine her? Ich dachte, du hättest keine Verwandten?«
»Schön wär’s«, sagte ich. »Es hat sich rausgestellt, daß ich in Lompoc mehrere Cousinen habe. Mir wäre es lieber, wenn ich nichts mit ihnen zu tun hätte, aber sie tauchen immer wieder auf. Ich bin zu alt, um mit Zusammengehörigkeit klarzukommen.«
»Du Lügnerin«, sagte er liebevoll, beließ es aber dabei.
Die Kellnerin kam wieder. Wir verzichteten auf Nachtisch und Kaffee. Dietz bat um die Rechnung, die sie aus einem Bündel hervorholte, das sie sich in den Rücken gesteckt hatte. Sie brauchte nur wenige Sekunden, um alles zusammenzuzählen. Ihre gelben Socken und die schwarzen Turnschuhe mit dem hohen Schaft gaben ihrer Kluft wirklich Klasse. Sie legte die Rechnung umgedreht auf den Tisch, ein wenig näher zu Dietz’ Seite als zu meiner. Das war vermutlich ihre Taktik, um keinen Fehler zu machen, für den Fall, daß wir ein Paar waren, das die Rollen vertauscht hatte.
»Lassen Sie sich nur Zeit«, sagte sie und ging davon, um Ketchup an einen anderen Tisch zu bringen. Sie mußte den Stoffwechsel eines Vogels haben. Die Kälte rief bei ihr nicht mal eine Gänsehaut hervor.
Dietz warf einen kurzen Blick auf die Rechnung und kontrollierte alles in Windeseile noch einmal nach. Er lehnte sich zur Seite, um seine Geldbörse herauszuholen, entnahm ihr ein paar Scheine und schob sie unter seinen Teller. »Können wir?«
»Jederzeit.«
Wir gingen auf Umwegen nach Hause. Es schien leichter zu sein, im Dunkeln zu reden, ohne einander anzusehen. Das Gespräch war oberflächlich. Ich bin Expertin dafür, Worte zu benutzen, die andere Menschen auf Distanz halten. Als wir nach Hause kamen, sorgte ich dafür, daß Dietz alles hatte, was er brauchte: Bettwäsche, zwei Kopfkissen, eine Extradecke, einen kleinen Wecker und ein frisches Handtuch – all die kleinen Dinge, die das Leben angenehm machen. Abgesehen von mir.
Ich ließ ihn unten zurück und stieg die Wendeltreppe hinauf. Oben angekommen, beugte ich mich übers Geländer. »Bei deinem kaputten Knie wirst du morgen wohl nicht mit mir joggen gehen.«
»Leider nein. Tut mir leid. Das fehlt mir wirklich.«
»Ich werde versuchen, dich nicht aufzuwecken. Danke für das Abendessen.«
»Gern geschehen. Schlaf gut.«
»Nimm deinen Eisbeutel.«
»Ja, Ma’am.«
Ich schlief wesentlich früher ein als er. Dietz war eine Nachteule. Ich weiß nicht, womit er sich die Zeit vertrieb. Vielleicht hat er seine Stiefel poliert oder seine Pistole gereinigt. Womöglich hat er sich das Nachtprogramm im Fernsehen mit gedämpfter Lautstärke angesehen. Auf jeden Fall habe ich nichts von ihm gehört. Ab und zu fiel mir beim Umdrehen auf, daß das Licht im Wohnzimmer immer noch brannte. Es hatte etwas so Väterliches an sich, daß er in meiner Wohnung war. Ein Aspekt des Singledaseins ist, daß man sich selten beschützt fühlt. Man neigt dazu, beim Schlafen im Geist die Schuhe anzubehalten, bereit, beim geringsten Geräusch aufzuspringen und zur Waffe zu greifen. Solange Dietz Wache hielt, schaffte ich es sogar, ein paar Runden REM-Schlaf hinter mich zu bringen und träumte bis zu dem Sekundenbruchteil, bevor mein Wecker losging. Ich schlug die Augen auf, streckte den Arm aus und erwischte ihn gerade noch, bevor er zu plärren anfing.
Ich erledigte meine morgendlichen Waschungen hinter verschlossenen Türen, damit das Geräusch des laufenden Wassers nicht hinausdrang. Mit den Schuhen in der Hand schlich ich mich auf Strümpfen die Treppe hinunter und auf Zehenspitzen zur Tür hinaus, ohne ihn aufzuwecken. Ich band meine Schuhe zu, machte ein paar Stretching-Übungen und marschierte mit schnellem Schritt los, um warm zu werden. Die Nacht war von Pechschwarz zu Anthrazitgrau übergegangen, und als ich den Cabana erreichte, begann sich die Dunkelheit zu lichten. Der Sonnenaufgang malte blasse Aquarelltöne in den frühmorgendlichen Himmel. Das Meer war silberblau, und der Himmel ging von einem rauchigen Mauve zu einem sanften Pfirsichton über. Die Ölbohrtürme tupften den Horizont wie irisierende Pailletten. Ich liebte das Geräusch der Brandung zu dieser Stunde, das Kreischen der Möwen, das leise Gurren der Tauben, die bereits auf dem Weg entlangstolzierten. Eine Platinblonde und ein schwarzer Pudel kamen auf mich zu, ein Paar, das ich an den meisten Morgen sah, wenn ich hier draußen war.
Das Laufen tat mir gut. Oft sind die drei Meilen eine einzige Plage, etwas, das ich tue, weil ich weiß, daß ich es tun muß. Diesmal war ich dankbar dafür, körperlich in Form zu sein. Ich käme nicht gut mit einer Verletzung zurecht, wie Dietz sie hatte, die einen vom Training abhielt. Ich werde nie in irgend etwas Höchstleistungen vollbringen, aber zum Bekämpfen von Depressionen gibt es wirklich nichts Besseres. Ich machte am East Beach kehrt und lief zurück, jetzt ein bißchen schneller. Hinter mir ging die Sonne auf und goß Bäche gelben Lichts über den Himmel. Als ich verschwitzt und außer Atem wieder nach Hause ging, war ich guter Laune und fühlte mich wohl.
Dietz stand unter der Dusche, als ich hereinkam. Er hatte die Zeitung geholt und auf den Küchentresen gelegt. Er hatte das Bettzeug weggeräumt, das Sofa wieder hochgeklappt und die Kissen irgendwo verstaut. Ich setzte Kaffee auf, ging nach oben und wartete, bis er die Dusche wieder abgestellt hatte, bevor ich meine andrehte. Um fünf nach halb neun war ich angezogen, hatte gefrühstückt und sammelte meine Jacke und meine Autoschlüssel zusammen. Dietz saß immer noch mit seiner zweiten Tasse Kaffee am Küchentresen, die Morgenzeitung ausgebreitet.
»Bis später«, sagte ich.
»Mach’s gut«, erwiderte er.
Auf dem Weg in die Stadt machte ich an einer Wohnanlage in der Nähe halt, die beiden Vorladungen in der Hand. Ich übergab beide ohne Zwischenfall, obwohl der Typ und seine Freundin sich wohl kaum über meinen Besuch gefreut haben dürften. Gelegentlich habe ich es mit Leuten zu tun, die zu absurden Manövern greifen, um der Zustellung zu entgehen, aber meistens ergeben sie sich ihrem Schicksal. Wenn jemand protestiert oder ekelhaft wird, reagiere ich meistens mit der gleichen Entgegnung: »Tut mir leid, Freundchen, aber ich bin wie eine Kellnerin. Ich braue den Ärger nicht zusammen, ich serviere ihn nur. Schönen Tag noch.«
Zur Abwechslung parkte ich auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber dem Gericht und ging die zwei Häuserblocks zur Arbeit zu Fuß. Mein derzeitiges Büro ist der frühere Besprechungsraum der Kanzlei Kingman und Ives, mitten in Santa Teresa. Von meiner Wohnung aus braucht man bei den üblichen Verkehrsverhältnissen mit dem Auto etwa zehn Minuten dorthin. Das Kingman-Haus wirkt wie ein ganz normales dreistöckiges Gebäude, aber das Erdgeschoß ist eine Illusion. Hinter einer Fassade aus Naturstein mit vergitterten Fenstern und Fensterläden befindet sich in Wirklichkeit ein kleiner Parkplatz mit zwölf namentlich zugeordneten Parkplätzen. Die meisten Büroangestellten und weniger bedeutenden Mieter im Haus sind gezwungen, ihre Autos woanders unterzubringen. In der Umgebung stehen zwar keine Parkuhren, aber es ist verboten, länger als maximal neunzig Minuten zu parken, und die meisten von uns bekommen mindestens einen Strafzettel im Monat. An manchen Vormittagen hat es schon etwas Komisches, uns hin und her fahren zu sehen, während wir versuchen, uns gegenseitig die vorhandenen Parkplätze wegzuschnappen.
Ich stieg die zwei Stockwerke hinauf und verzichtete auf die Freuden des Aufzugs, der klein ist und ewig braucht und häufig den Eindruck macht, als werde er gleich steckenbleiben. Im Büro angekommen, tauschte ich Freundlichkeiten mit Alison, der Empfangsdame, und Lonnie Kingmans Sekretärin Ida Ruth aus. Ich sehe Lonnie selten, da er entweder bei Gericht ist oder eisern hinter geschlossenen Türen arbeitet. Ich betrat mein Büro und notierte kurz Datum, Uhrzeit und eine kurze Beschreibung des Pärchens, dem ich die Vorladungen zugestellt hatte. Ich tippte rasch eine Rechnung und griff mir dann das Telefon, während ich mich auf meinem Drehstuhl zurücklehnte und den Papierkram in meinen Ausgangskorb warf. California Fidelity machte erst gegen neun Uhr auf, aber Darcy kam meist früher.
»He, Darcy. Ich bin’s«, sagte ich, als sie am anderen Ende abnahm.
»Oh, hallo, Kinsey. Bleib mal kurz dran. Ich bin nicht an meinem Platz.« Sie warf mich aus der Leitung, und ich lauschte nicht mehr ganz taufrischen Weihnachtsliedern, während ich einigermaßen optimistisch gestimmt wartete. Ich nahm an, wenn sie nichts gefunden hätte, hätte sie das gleich gesagt.
Eine halbe Minute verging, bis sie sich wieder meldete. »Okay. Guy David Malek besitzt im Bundesstaat Kalifornien keinen gültigen Führerschein. Seiner wurde 1968 eingezogen und offenbar nie neu ausgestellt.«
»Tja, Scheiße«, sagte ich.
Darcy lachte. »Würdest du bitte warten? Ständig ziehst du vorschnelle Schlüsse. Ich habe doch nur gesagt, daß er nicht Auto fährt. Er hat aber einen kalifornischen Personalausweis, und daher habe ich meine Informationen. Seine Anschrift lautet Route I, Box 600, Marcella, Kalifornien 93456. Das ist vermutlich identisch mit seiner Wohnadresse. Klingt wie eine Ranch oder eine Farm. Möchtest du das Bild sehen?«
»Du hast ein aktuelles Bild von ihm? Das ist ja toll. Nicht zu fassen! Du kannst wohl zaubern.«
»He, du hast es mit einem Profi zu tun«, sagte sie. »Was hast du für eine Faxnummer?«
Ich nannte ihr Lonnies Faxnummer, während ich nach dem Telefonbuch griff. »Bist du sicher, daß er in Marcella wohnt? Das ist ja nicht mal hundert Meilen weit weg.«
»Den Unterlagen der Zulassungsstelle nach schon. Das dürfte dir die Arbeit ziemlich erleichtern.«
»Allerdings. Was schulde ich dir?«
»Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Ich mußte ein paar Formulare fälschen, damit die Anfrage legitim aussah, aber das wird niemand nachprüfen. Hat kaum eine Minute gedauert.«
»Du bist ein Schatz. Herzlichen Dank. Ich melde mich wieder, und dann gehen wir Mittag essen. Auf meine Rechnung.«
Darcy lachte. »Ich nehme dich beim Wort.«
Ich legte den Hörer auf und durchblätterte das Telefonbuch auf der Suche nach der Vorwahl für Marcella, Kalifornien. Es lag sogar innerhalb des Gebiets mit 805, genau wie Santa Teresa. Ich versuchte es bei der Auskunft, indem ich Guy Maleks Namen angab. Unter der Adresse, die Darcy mir genannt hatte, war kein Telefonanschluß eingetragen. »Haben Sie einen anderen Eintrag für Guy Malek in der Gegend? G. Malek? Irgendeinen Malek?«
»Nein, Ma’am.«
»In Ordnung. Danke.«
Ich trottete gerade rechtzeitig den Flur hinunter zum Faxgerät, um eine Kopie von Guy Maleks Ausweisfoto herauskommen zu sehen. Die Schwarzweiß-Wiedergabe war fleckig, doch sie bestätigte seine persönlichen Daten: GESCHLECHT: M; HAARFARBE: BLOND; AUGENFARBE: GRÜN; GRÖSSE: 1,73: GEWICHT: 70 KG; GEBURTSDATUM: 02.03.42. Er sah bedeutend besser aus als in seinem High-School-Jahrbuch. Ein dreifaches Hurra auf ihn. Ich gestehe, daß ich mir gut vorkam, als ich mich wieder an meinen Schreibtisch setzte, während sich die kleine Angeberin in mir selbst auf die Schultern klopfte.
Ich rief in Tashas Büro an und nannte ihrer Sekretärin meinen Namen, als sie den Hörer abnahm. »Tasha ist in einer Besprechung, aber ich werde ihr sagen, daß Sie es sind«, erklärte sie. »Sie kann bestimmt kurz ans Telefon gehen, wenn es wichtig ist.«
»Glauben Sie mir, das ist es.«
»Können Sie warten?«
»Klar.« Während ich wartete, legte ich eine Patience aus. Eine Karte aufgedeckt und sechs mit dem Gesicht nach unten. Irgendwie tat es mir leid, daß sich alles so schnell geklärt hatte. Ich wollte nicht, daß Donovan dächte, er müsse für etwas bezahlen, das er ohne weiteres selbst hätte machen können – obwohl es in Wirklichkeit so war. In öffentlichen Unterlagen sind sehr viele Daten zu finden. Die meisten Leute haben nur nicht die Zeit oder das Interesse, die Kleinarbeit zu machen. Sie sind nur allzu froh, wenn ihnen ein Privatdetektiv das abnimmt, und so haben im Endeffekt alle etwas davon. Trotzdem war diese Aufgabe fast zu leicht, vor allem weil ich mir nicht sicher war, ob die Familie zu dem Schluß kommen würde, daß ihren wahren Interessen durch meine Entdeckung gedient war. Ich drehte die nächste Karte auf dem zweiten Stapel um und legte weitere fünf Karten darunter.
Als sich Tasha meldete, klang sie angespannt und nicht bei der Sache. »Hi, Kinsey. Was gibt’s? Ich hoffe, es ist wichtig, ich stecke nämlich bis über beide Ohren in Arbeit.«
»Ich habe die Adresse von Guy Malek. Ich dachte, ich sage es am besten zuerst dir.«
Sie schwieg kurz, während sie diese Information verarbeitete. »Das ging ja schnell. Wie hast du das geschafft?«
Ich schmunzelte über ihren Tonfall, der eine perfekte Mischung aus Erstaunen und Respekt war. »Ich habe so meine Methoden«, sagte ich. Ach, wie verführerisch ist doch die Befriedigung, wenn wir denken, wir hätten andere mit unserer Klugheit beeindruckt. Es ist eine der Perversionen der menschlichen Natur, daß wir mehr an der Bewunderung unserer Feinde interessiert sind als an der Anerkennung unserer Freunde. »Hast du einen Stift?«
»Natürlich. Wo wohnt er?«
»Nicht weit.« Ich nannte ihr die Adresse. »Es ist kein Telefon eingetragen. Entweder hat er keins, oder es läuft auf den Namen von jemand anderem.«
»Erstaunlich«, sagte sie. »Laß mich Donovan davon berichten und hören, was er als nächstes tun möchte. Er wird sicher hocherfreut sein.«
»Das bezweifle ich. Ich hatte den Eindruck, daß sie alle glücklicher wären, wenn Guy sich als tot entpuppte.«
»Unsinn. Sie sind doch eine Familie. Ich bin sicher, es wird sich alles klären. Ich sage ihm, daß er dich anrufen soll.«
Innerhalb von fünfzehn Minuten klingelte es. Donovan war am Apparat. »Gute Arbeit«, sagte er. »Ich bin überrascht, wie schnell es ging. Ich dachte, die Suche würde Wochen dauern.«
»Es ist nicht immer so leicht. Wir hatten Glück«, sagte ich. »Brauchen Sie sonst noch etwas?«
»Darüber haben Tasha und ich gerade geplaudert. Ich habe vorgeschlagen, Sie persönlich dorthin zu schicken. Tasha könnte zwar brieflich Kontakt zu ihm aufnehmen, aber manchmal reagieren Leute merkwürdig auf Post von Anwälten. Sie fühlen sich bedroht, bevor sie den Umschlag aufmachen. Wir möchten nicht den falschen Ton anschlagen.«
»Sicher, ich kann mit ihm sprechen«, sagte ich, wobei ich mich verwirrt fragte, was wohl der richtige Ton wäre.
»Ich hätte gerne einen Bericht aus erster Hand über Guys momentane Lebensumstände. Haben Sie irgendwann in den nächsten zwei Tagen Zeit?«
Ich sah in meinen Kalender. »Ich kann heute nachmittag hinfahren, wenn Sie möchten.«
»Je früher, desto besser. Ich möchte, daß diese Sache mit Glacehandschuhen angefaßt wird. Ich habe keine Ahnung, ob er von Dads Tod erfahren hat, aber er könnte trotz der Entfremdung bestürzt sein. Außerdem ist das Geld eine heikle Angelegenheit. Wer weiß, wie er reagiert.«
»Möchten Sie, daß ich ihm von dem Testament erzähle?«
»Ich wüßte nicht, was dagegen spräche. Er erfährt es sowieso irgendwann.«