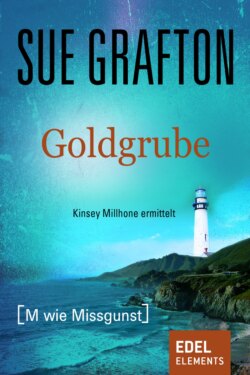Читать книгу Goldgrube - Sue Grafton - Страница 9
5
ОглавлениеIch sah auf meine Uhr. Da ich keine Termine hatte, konnte ich mich genausogut gleich auf den Weg machen. Es war gerade erst halb zehn. Eine Fahrt nach Marcella und zurück würde jeweils eine gute Stunde dauern. Wenn ich mir eine Stunde dafür zugestand, Guy Malek aufzuspüren, hätte ich immer noch Zeit, einen Happen zu Mittag zu essen und nachmittags wieder zurück zu sein. Ich zog die unterste Schreibtischschublade auf und holte meine Landkarte von Kalifornien heraus. Marcella lag ungefähr achtzig Meilen weiter nördlich und hatte wohl eine Bevölkerung von etwa fünfzehnhundert Seelen. Ich nahm an, daß es nicht mal eine Stunde dauern würde, ihn zu finden, wenn ich erst vor Ort war – vorausgesetzt, er lebte noch dort. Das Gespräch selbst würde vermutlich nicht länger als eine halbe Stunde dauern, was hieß, daß ich diesen ganzen Auftrag bis heute abend abschließen konnte.
Ich rief Dietz an und berichtete ihm von den Ereignissen. Im Hintergrund konnte ich den Fernseher laufen hören, eine dieser endlosen Nachrichtensendungen, die von Werbespots durchsetzt sind. Nach Ablauf einer Stunde weiß man mehr über Hundefutter als über das Weltgeschehen. Dietz ließ durchblicken, daß er nichts Besonderes vorhätte. Ich fragte mich, ob er womöglich auf eine Einladung, mich zu begleiten, aus war, aber da er die Frage nicht stellte, beantwortete ich sie auch nicht. Ich wollte mich ohnehin nicht für seine Unterhaltung verantwortlich fühlen. Ich erklärte ihm, daß ich gegen drei zurück wäre und nicht mehr ins Büro gehen, sondern gleich nach Hause kommen würde. Pläne fürs Abendessen konnten wir schmieden, wenn ich dann eingetroffen war.
Ich tankte meinen VW voll und fuhr auf der 101 in Richtung Norden. Wo die Landstraße sich an der Küste entlangschlängelte, war Nebel aufgekommen, und der Himmel erschien nun milchigweiß von bauschigen Wolken. Am Straßenrand hoben sich die immergrünen Gewächse in den verschiedensten dunklen Silhouetten bis zum Horizont ab. Der Verkehr floß zügig voran, überwiegend Autos mit nur einem Insassen und gelegentlich ein Pferdeanhänger, der vermutlich ins Santa Ynez Valley unterwegs war, das gleich nördlich von uns lag. Wir hatten nicht viel Regen gehabt, und die Hügel sahen aus wie stumpfe heufarbene Wälle, zwischen denen hin und wieder ein Ölbohrturm seine regelmäßigen, unterwürfigen Verbeugungen zur Erde hin vollführte.
Die Straße wand sich ins Landesinnere, und binnen einer Stunde hatten sich die Wolken wieder aufgelöst und waren einem blaßblauen Himmel gewichen, den noch vereinzelte Schwaden durchzogen, so zart wie Gänsedaunen. Kurz vor Santa Maria nahm ich die 166 in Richtung Osten und fuhr zehn Meilen auf der zweispurigen Straße, die parallel zum Cuyama River verlief. Die Wärme der Januarsonne war hier oben kaum zu spüren. Die Erde in den Tälern und Cañons roch trocken, und vor mir erhob sich eine Kette kahler brauner Hügel. Man hatte Regen vorhergesagt, aber das Wetter schien zu flirten und uns mit hohen Wolken und der Andeutung einer Brise zu necken.
Die Ortschaft Marcella lag im Schatten des Los Coches Mountain. Beim Fahren war ich mir der unsichtbaren Gegenwart des großen San-Andreas-Grabens bewußt, der 750 Meilen langen Verwerfung, die sich an der kalifornischen Küste hinaufschlängelt, von der mexikanischen Grenze bis zu dem dreifachen Berührungspunkt bei Mendocino, wo die pazifische und die nordamerikanische Platte sich seit Anbeginn der Zeit gegeneinanderreiben. Unter den dünnen Schichten aus Granit und . Meeresablagerungen ist die Erdkruste so brüchig wie ein Totenschädel. In dieser Gegend wird der San-Andreas-Graben vom Santa-Ynez-Graben gekreuzt, und White Wolf und Garlock liegen nicht weit entfernt. Es wird spekuliert, daß die Berge in diesem Teil des Bundesstaates früher einmal in Nord-Süd-Richtung verliefen, genau wie andere Bergketten entlang der Küste. Der Theorie zufolge wurde die Südspitze dieser Kette vor vielen Millionen Jahren von der pazifischen Platte gekappt und beim Vorüberziehen zur Seite gezerrt, womit die Berge in ihre heutige Ost-West-Ausrichtung gebracht wurden. Ich war einmal während eines kleineren Bebens mit dem Auto unterwegs gewesen, und es war ein Gefühl, als wäre der VW soeben von einem rasenden, achtzehnrädrigen Lastwagen überholt worden. Es gab einen Ruck nach rechts, als wäre das Auto plötzlich in ein Vakuum gesogen worden. In Kalifornien, wo sich das Wetter so wenig wandelt, suchen wir die Dramatik, die woanders Wirbelstürme und Orkane mit sich bringen, in Erdbeben.
An einer Straßenkreuzung entdeckte ich einen unauffälligen Wegweiser und bog in südlicher Richtung nach Marcella ab. Die Straßen waren sechsspurig und kaum befahren. Hin und wieder hatte man eine Palme oder einen Wacholderbusch am Straßenrand gepflanzt. Hier gab es keine Gebäude, die über zwei Stockwerke hoch waren, und wenn ich mich umblickte, sah ich einen Gemischtwarenladen mit eisernen Gitterstäben an den Fenstern, ein Hotel, drei Motels, eine Immobilienfirma und ein großes viktorianisches Haus, das von einem Gerüst umgeben war. Die einzige Bar befand sich in einem Gebäude, das wirkte, als wäre es einmal ein Postamt gewesen, dem aber jetzt jede amtliche Funktion genommen war. Im Fenster hing eine Budweiser-Werbung. Wovon lebten die Einwohner Marcellas, und warum hatten sie sich hier niedergelassen? Es gab meilenweit keinen anderen Ort, und die Geschäfte hier schienen in erster Linie auf Biertrinken und anschließendes Zubettgehen eingerichtet zu sein. Wenn man Fast Food oder Ersatzteile fürs Auto wollte, wenn man ein rezeptpflichtiges Medikament, ein Kino, ein Fitneßcenter oder ein Brautkleid brauchte, mußte man nach Santa Maria fahren oder auf der 101 weiter Richtung Norden nach Atascadero und Paso Robles. Das Land um den Ort herum wirkte unfruchtbar. Ich hatte nichts gesehen, das auch nur halbwegs einer Zitrusplantage oder einem gepflügten Feld geähnelt hätte. Vielleicht war die Landschaft ja für Weideflächen, Bergbau oder Autorennen reserviert. Vielleicht lebten die Menschen hier, um der Hektik von San Luis Obispo zu entkommen.
In einer Seitenstraße sah ich eine Tankstelle und hielt dort an, um nach dem Weg zu fragen. Der Junge, der herauskam, war vielleicht siebzehn. Er war mager, hatte blasse Augen, bis fast an die Ohren geschorene Haare und ein Gewirr schiefer Zähne. Er erinnerte mich an eine Figur aus einer der ersten Folgen von Unheimliche Geschichten. Ich sagte: »Hi. Ich suche einen Freund von mir. Er heißt Guy Malek. Ich glaube, er wohnt hier irgendwo auf der Route 1, aber er hat mir nicht genau gesagt, wo.« Nun gut. Ich schwatzte dummes Zeug, aber es war nicht direkt gelogen. Ich wäre ja mit Guy befreundet, wenn er erst die Neuigkeiten über die fünf Millionen Dollar hörte.
Der Junge sagte nichts, aber er wies die Richtung mit einem zitternden Finger wie ein Schloßgespenst.
Ich blickte über meine Schulter. »Zurück da runter?«
»Das ist das Haus.«
Ich drehte mich um und starrte erstaunt. Das Grundstück war von einem Maschendrahtzaun umgeben. Hinter einem Rolltor aus Hühnerdraht konnte ich ein kleines Haus erkennen, einen Schuppen, eine große Scheune mit Seitenwänden aus Wellblech, einen alten gelben Schulbus, eine alleinstehende Zapfsäule und ein Schild, das zu verblichen war, als daß ich es aus der Entfernung hätte lesen können. Das Tor stand offen. »Oh. Gut, danke. Wissen Sie, ob er zu Hause ist?«
»Nein.«
»Er ist nicht da?«
»Nein. Ich weiß es nicht. Ich hab ihn heute zumindest noch nicht gesehen.«
»Ah. Na, dann klopfe ich wohl mal bei ihm.«
»Das könnten Sie machen«, sagte er.
Ich fuhr aus der Tankstelle heraus und über die Straße. Ich manövrierte den VW durch das offene Tor und parkte auf einem Streifen nackter Erde, den ich für eine Einfahrt hielt. Dann stieg ich aus. Der Vorplatz bestand aus weißem Sand mit einem Saum aus braunem Gras. Das Holzhaus war früher einmal weiß gestrichen gewesen und besaß nur ein einziges Stockwerk, dem eine hölzerne Veranda vorgebaut war. Ein Spalier, das die Fenster zur Linken schützte, wies nur eine einzige kahle Ranke auf, die sich durch das Gitterwerk wand wie eine Boa Constrictor. Ein ebensolches Spalier auf der rechten Seite war unter seiner Bürde ausgetrockneter brauner Vegetation zusammengebrochen. Mehrere Kabel kamen vom Dach herunter und versorgten die Bewohner mit Telefon, Fernsehen und Elektrizität.
Ich erklomm die hölzernen Stufen und klopfte an die verwitterte Fliegentür. Die Tür war geschlossen, und es war kein Hinweis auf Leben zu sehen. Überall lag eine feine Rußschicht, als stünde das Haus im Windschatten eines Hochofens. Der Boden der Veranda begann auf eine Art zu zittern, die darauf schließen ließ, daß jemand den Holzboden im Inneren des Hauses durchschritt. Die Tür ging auf, und ich stand dem Mann gegenüber, in dem ich Guy Malek vermutete. Abgesehen von einem Dreitagebart sah er für sein Alter äußerst jung aus. Sein Haar wirkte dunkler und glatter als in seinem High-School-Jahrbuch, aber seine Gesichtszüge waren nach wie vor jungenhaft: khakigrüne Augen, umringt von dunklen Wimpern, eine kleine, gerade Nase und ein großzügiger Mund. Sein Teint war rein, und er hatte eine gute Farbe. Die Jahre hatten feine Linien um seine Augen gegraben, und seine Kinnpartie begann ein wenig schlaff zu werden, aber ich hätte ihn trotzdem auf Mitte Dreißig geschätzt. Mit fünfzig und sechzig würde er zweifellos immer noch genauso aussehen, da die Jahre sein gutes Aussehen nur geringfügig verändern konnten. Er trug eine Jeans-Latzhose und war gerade dabei gewesen, eine Jeansjacke anzuziehen, als er an die Tür kam, und so blieb er stehen, um den Kragen hinten zurechtzurücken, bevor er »Hallo« sagte.
Als Jugendlicher hatte Guy Malek genauso bescheuert ausgesehen wie wir alle. Er war der böse Junge gewesen, gesetzlos und selbstzerstörerisch, eine der verlorenen Seelen des Lebens. Er mußte anziehend gewirkt haben, weil er so sehr der Rettung bedurfte. Frauen können Männern nicht widerstehen, die gerettet werden müssen. Nun hatte sich sein Schutzengel offenbar auf Dauer bei ihm eingerichtet und verlieh seinem Gesicht ein heiteres Aussehen. Es war seltsam, daß seine Brüder so anders gealtert waren. Bereits jetzt mochte ich diesen Mann lieber als seine Geschwister. Von der Schmuddeligkeit abgesehen erweckte nichts den Eindruck, als würde er irgendwelche Substanzen schnupfen, schnüffeln oder spritzen.
»Sind Sie Guy Malek?«
Sein Lächeln kam zögernd, als könnte ich jemand sein, den er schon einmal getroffen hatte und an dessen Namen er sich gern erinnern würde. »Ja.«
»Ich heiße Kinsey Millhone. Ich bin Privatdetektivin aus Santa Teresa.« Ich reichte ihm eine Visitenkarte. Er studierte die Karte, bot mir aber keinen Händedruck an. Seine Hände waren so verschmutzt wie bei einem Automechaniker. Ich konnte sehen, wie ein Muskel in seinem Kiefer arbeitete.
Er richtete seinen Blick auf mich, und sein gesamter Körper erstarrte. Das Lächeln schwand. »Hat meine Familie Sie engagiert?«
»Nun, ja«, sagte ich. Ich wollte gerade zu einem diplomatischen Bericht über den Tod seines Vaters ansetzen, als ich Tränen in seinen Augen aufsteigen sah, die das klare Grün seines Blicks trübten. Blinzelnd sah er nach oben und holte tief Luft, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder mir zuwandte. Er wischte sich hastig über die Wangen und lachte verlegen auf.
Er sagte »Wow« und preßte sich die Finger der einen Hand gegen die Augen. Dann schüttelte er den Kopf und versuchte sich zu fassen. »Tut mir leid. Sie haben mich völlig überrascht. Ich hätte nie gedacht, daß es mir etwas ausmacht, aber das tut es wohl doch. Ich habe mir immer gewünscht, sie würden jemanden schicken, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Wie haben Sie mich gefunden?«
»So schwer war das nicht. Ich habe bei der Kfz-Zulassungsstelle nachgeforscht und bin auf Ihren kalifornischen Personalausweis gestoßen. Dann habe ich es bei der Telefonauskunft versucht, aber Sie waren nicht eingetragen. Sie haben wohl kein Telefon?«
»Kann mir keins leisten«, antwortete er. »Möchten Sie reinkommen?« Seine Art war linkisch, und er wirkte unsicher. Er wandte den Blick von mir ab und sah mich dann erneut an.
»Gern«, sagte ich.
Er trat einen Schritt zurück, um mich hereinzulassen, und ich betrat einen Raum, der genauso aussah, wie ich es erwartet hatte. Der Innenausbau war dürftig, breite, unbehandelte Holzdielen und Fenster, die nicht richtig schlossen. Mehrere alte Möbelstücke, vermutlich beim Sperrmüll – falls es so etwas hier gab – ergattert, waren ins Zimmer gestellt worden. Wo immer auch Platz war, stapelten sich Bücher, Zeitschriften und schmutzige Wäsche, Töpfe, Pfannen, Konservendosen und Werkzeuge. Außerdem lagen eine Menge Dinge herum, die wie landwirtschaftliche Geräte aussahen, deren Funktion mir aber unklar war. In einer Zimmerecke standen ein Turm aus gebrauchten Autoreifen und ein Klosett, das an nichts angeschlossen zu sein schien. Guy fing meinen verwunderten Blick auf. »Ich bewahre das für einen Bekannten auf. Da hinten habe ich ein richtiges Badezimmer«, sagte er mit einem schüchternen Lächeln.
»Das freut mich zu hören«, sagte ich und lächelte ihn an.
»Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Es ist Pulverkaffee, aber er ist nicht schlecht.«
»Nein, danke. Wollten Sie gerade weg?«
»Was? Ach ja, aber machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Setzen Sie sich doch.« Er zog ein Taschentuch hervor und schneuzte sich. Ich merkte, wie sich in meinem Brustkorb ein beklommenes Gefühl breitmachte. Seine Offenheit hatte etwas Rührendes. Er wies auf ein zerschlissenes, klobiges Sofa, durch dessen Polster eine Sprungfeder stach. Ich hockte mich auf die Kante und hoffte, meine zartesten Körperteile nicht zu beschädigen. Mein Unbehagen hing damit zusammen, daß Guy Malek offenbar dachte, seine Familie hätte mich aus emotionalen Gründen mit der Suche nach ihm beauftragt. Ich wußte es besser. Ich überlegte, wie ich mich verhalten sollte, und beschloß, aufrichtig zu ihm zu sein. Was auch immer das Ergebnis unseres Gesprächs war, es wäre allzu demütigend für ihn, wenn ich ihn im falschen Glauben ließe.
Er zog einen hölzernen Stuhl heran und setzte sich mir direkt gegenüber, wobei er sich hin und wieder die Augen wischte. Er entschuldigte sich nicht für die Tränen, die ihm immer noch über die Wangen liefen. »Sie wissen nicht, wie sehr ich darum gebetet habe«, sagte er mit zitternden Lippen. Er sah auf seine Hände herab und begann das Taschentuch zusammenzufalten. »Der Pastor meiner Kirche... er hat Stein und Bein geschworen, daß es passieren würde, wenn es so bestimmt sei. Beten ist zwecklos, wenn es nicht Gottes Wille ist, hat er gesagt. Und ich habe immer wieder gesagt: ›Mann, eigentlich hätten sie mich doch inzwischen finden können, wenn ihnen genug daran läge, oder?‹«
Mir fiel auf, daß seine Situation der meinen seltsam ähnelte, da wir beide versuchten, zerbrochene Familienbande zu verarbeiten. Zumindest hieß er seine Verwandten willkommen, obwohl er den Zweck meines Besuches mißverstand. Ich fühlte mich alles andere als wohl, weil ich ihn korrigieren mußte. »Guy, offen gestanden ist die Sache komplizierter. Ich habe schlechte Nachrichten«, begann ich.
»Mein Vater ist gestorben?«
»Vor zwei Wochen. Ich weiß das genaue Datum nicht. Soweit ich weiß, hatte er einen Schlaganfall und litt außerdem an Krebs. Er hat eine Menge durchgemacht, und ich glaube, sein Körper ließ ihn einfach im Stich.«
Er schwieg einen Augenblick und starrte ins Weite. »Tja. Eigentlich überrascht mich das nicht«, sagte er. »Hat er... wissen Sie, ob er es war, der nach mir gefragt hat?«
»Ich habe keine Ahnung. Ich bin erst gestern engagiert worden. Die Testamentseröffnung wird gerade eingeleitet. Von Gesetzes wegen müssen Sie benachrichtigt werden, da Sie einer der Begünstigten sind.«
Er wandte sich mir zu und begriff es endlich. »Ach. Sie sind in offiziellem Auftrag hier, und das ist alles, stimmt’s?«
»Mehr oder weniger.«
Ich beobachtete, wie ihm langsam die Farbe in die Wangen stieg. »Ich Blödmann«, sagte er. »Da habe ich mir doch allen Ernstes eingebildet, Sie wären von jemandem geschickt worden, der tatsächlich einen Funken Interesse hat.«
»Es tut mir leid.«
»Ist nicht Ihre Schuld«, sagte er. »Was noch?«
»Was noch?«
»Ich wollte wissen, ob Sie mir noch etwas anderes mitzuteilen haben.«
»Eigentlich nicht.« Falls er mitbekommen hatte, daß er Geld erben würde, so ließ er es sich nicht anmerken.
»Es ist vermutlich völlig abwegig, daß mein Vater nach mir gefragt haben könnte.«
»Ich wünschte, ich könnte Ihnen weiterhelfen, aber man hat mir keine Einzelheiten genannt. Möglich ist es schon, aber vielleicht erfahren Sie es nie. Sie können die Anwältin frage, wenn Sie mit ihr sprechen. Sie weiß wesentlich mehr als ich über die Umstände seines Todes.«
Er lächelte schwach. »Dad hat eine Frau engagiert? Das klingt nicht nach ihm.«
»Donovan hat sie engagiert. Sie hat mit seiner Frau studiert.«
»Was ist mit Bennet und Jack? Sind sie verheiratet?« Er sprach die Namen aus, als hätte er sie seit Jahren nicht mehr im Mund gehabt.
»Nein. Nur Donovan. Soweit ich weiß, haben Christie und er noch keine Kinder. Er leitet die Firma, die meines Wissens mittlerweile die drittgrößte Baufirma in Kalifornien ist.«
»Gut für ihn. Donnie war schon immer vom Geschäft besessen«, sagte er. »Haben Sie auch mit den anderen beiden gesprochen?«
»Kurz.«
Sein Gesichtsausdruck hatte sich komplett gewandelt, während wir sprachen. Was mit so großer Beglücktheit begonnen hatte, war nun zu schmerzhafter Erkenntnis geworden. »Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber ich habe den Eindruck, daß sie nicht ernsthaft an mir interessiert sind. Die Anwältin hat gesagt, daß sie das tun müssen, also tun sie es. Ist es so? Ich meine, die drei sind nicht eben von warmen, sentimentalen Gefühlen beseelt, was mich betrifft, oder?«
»Das stimmt, aber das rührt wahrscheinlich von der Situation her, in der Sie weggegangen sind. Ich habe gehört, Sie hatten eine Menge Ärger, also sind ihre Erinnerungen an Sie nicht gerade schmeichelhaft.«
»Wohl nicht. Ebensowenig wie meine an sie, wenn ich es mir recht überlege.«
»Außerdem hat niemand ernsthaft geglaubt, daß ich Sie finden würde. Wie lange ist es jetzt her – siebzehn Jahre?«
»Ungefähr. Offenbar nicht lange genug aus ihrer Sicht.«
»Wohin sind Sie denn gegangen, als Sie das Haus verlassen haben? Stört es Sie, wenn ich frage?«
»Warum sollte mich das stören? Es war nichts Großartiges. Ich bin zur Landstraße gegangen, um zu trampen. Ich wollte nach San Francisco, war voll auf Acid und total high. Der Typ, der mich aufgelesen hat, war ein Pfarrer, der bei einer Kirche etwa eine Meile von hier angestellt worden war. Er hat mich aufgenommen. Ich war dermaßen vollgedröhnt, daß ich nicht einmal wußte, wo ich war.«
»Und Sie sind die ganze Zeit hier gewesen?«
»Nicht ganz«, antwortete er. »Ich bin ja nicht im Handumdrehen von selbst auf Entzug gegangen und clean geworden. Ich habe mehr als einmal Mist gebaut. Ich hatte Rückfälle... Sie wissen schon, ich hab mich betrunken und bin losgezogen... aber Pete und seine Frau haben mich jedesmal gefunden und wieder zurückgebracht. Schließlich habe ich kapiert, daß ich sie nicht abschütteln konnte. Ganz egal, was ich machte. Sie klebten an mir wie Leim. Dann habe ich mich besonnen und Jesus in meinem Herzen gefunden. Das hat wirklich mein ganzes Leben umgekrempelt.«
»Und Sie haben sich nie bei Ihrer Familie gemeldet?« sagte ich.
Mit einem bitteren Lächeln schüttelte er den Kopf. »Sie haben ja auch nicht gerade nach mir geschrien.«
»Vielleicht ändert sich das, wenn ich mit ihnen spreche. Was kann ich ihnen sonst noch sagen? Arbeiten Sie?«
»Sicher arbeite ich. Ich erledige Instandhaltungsarbeiten an der Kirche und verrichtete alle möglichen Jobs im Ort. Anstreichen, Reparaturen, Installationen, Elektrik. Was man eben so braucht. Meistens zum Mindestlohn, aber ich bin der einzige hier, der so was macht, also habe ich immer zu tun.«
»Klingt, als hätten Sie sich ganz gut eingerichtet.«
Er sah sich um. »Tja, ich besitze nur wenig, aber ich brauche auch nicht viel. Das Haus gehört mir nicht«, sagte er. »Die Kirche bezahlt meine Unterkunft, aber ich verdiene genug fürs Nötigste. Essen, Wasser, Strom und dergleichen. Ich fahre nicht Auto, aber ich habe ein Fahrrad, und in einem Ort von dieser Größe kommt man damit überallhin.«
»Sie haben sich ziemlich verändert.«
»Sonst wäre ich schon tot.« Er sah kurz auf die Uhr. »Hören Sie, ich möchte Sie nicht drängen, aber ich sollte mich wohl langsam auf den Weg hinüber in die Kirche machen.«
»Dann will ich Sie nicht aufhalten. Danke, daß Sie sich die Zeit genommen haben. Kann ich Sie mitnehmen?«
»Klar. Wir können unterwegs reden.«
Als wir im Auto saßen, dirigierte er mich zurück zur Landstraße. Wir bogen nach rechts auf die 166 ein, wieder in Richtung Osten. Eine Weile fuhren wir in freundschaftlichem Schweigen dahin. Dann warf er mir einen Blick zu. »Worin besteht eigentlich Ihr Auftrag? Mich finden und Bericht erstatten?«
»So in etwa«, antwortete ich. »Jetzt, wo wir eine gültige Adresse haben, wird Ihnen Tasha Howard, die Anwältin, eine Benachrichtigung über die Testamentseröffnung zuschicken.«
»Oh, genau. Das habe ich ganz vergessen. Ich bin ja ein Begünstigter, haben Sie gesagt.« Sein Tonfall war heiter und nahezu spöttisch geworden.
»Das interessiert Sie nicht?«
»Nicht besonders. Ich dachte, ich bräuchte etwas von diesen Leuten, aber es hat sich herausgestellt, daß dem doch nicht so ist.« Er wies auf eine herannahende Kreuzung, und ich bog nach rechts auf eine kleine Nebenstraße ab. Der Straßenbelag hatte sich von Asphalt zu losem Kies verwandelt, und ich konnte beim Weiterfahren die weißen Staubwolken in meiner Heckscheibe aufwirbeln sehen. Die Kirche lag am Rand einer Weide etwa eine halbe Meile weit entfernt. Auf einem Schild stand: JUBILEE EVANGELICAL CHURCH.
»Sie können hier rechts ranfahren«, sagte er. »Möchten Sie mit reinkommen und die Kirche sehen? Wenn Sie nach Stunden bezahlt werden, können Sie sich doch ruhig alles anschauen. Ich bin sicher, Donnie kann es sich leisten.«
Ich zögerte ein wenig. »Na gut.«
Er legte den Kopf schief. »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich werde nicht versuchen, Sie zu bekehren.«
Ich parkte, und wir stiegen aus. Er gab zwar keine feierliche Erklärung ab, aber ich merkte ihm an, daß er stolz auf diesen Ort war. Er zog einen Schlüsselbund heraus und schloß auf.
Die Kirche war klein und aus Holz gebaut. Ihr unscheinbares Äußeres vermittelte den Eindruck von Redlichkeit. Die Buntglasfenster waren schlicht. Jedes war in sechs blaßgoldene Scheiben unterteilt, an deren unterem Rand jeweils eine Inschrift eingraviert war. Vorne, links von einer erhöhten, mit Teppichen ausgelegten Plattform, stand eine schmucklose hölzerne Kanzel. Zur Rechten erhob sich eine Orgel, vor der drei Stuhlreihen für den Chor aufgestellt waren. Der Blumenschmuck vom vergangenen Sonntag beschränkte sich auf einen Zweig weißer Gladiolen. »Vor zehn Jahren ist das hier alles von einem Feuer zerstört worden. Die Gemeinde hat alles von Grund auf wieder aufgebaut.«
Ich sagte: »Wie haben Sie zu sich gefunden? Das muß schwer gewesen sein.«
Er setzte sich auf eine der vorderen Kirchenbänke, und ich bemerkte, daß er sich umblickte und diesen Ort vielleicht so sah wie ich. »Ich schreibe es unserem Herrn zu, obwohl Pete immer sagt, daß ich die Arbeit selbst gemacht hätte«, antwortete er. »Ich bin ohne viel Betreuung aufgewachsen, ohne irgendwelche Werte. Ich mache niemandem einen Vorwurf. Es war eben so. Meine Eltern waren anständige Leute. Sie haben nicht getrunken oder mich geschlagen oder irgend so was, aber sie haben nie von Gott und ihren religiösen Überzeugungen gesprochen, vorausgesetzt, sie hatten welche, was vermutlich nicht der Fall war. Meine Brüder und ich... sogar als wir noch ganz klein waren... sind nie zur Sonntagsschule oder in die Kirche gegangen.
Meine Eltern hatten etwas gegen ›organisierte Religion‹. Ich weiß nicht, was dieser Begriff für sie bedeutete oder was ihre Auffassung war, aber sie waren stolz darauf, daß keiner von uns je damit in Berührung kam. Als wäre es eine Art Krankheit. Ich weiß noch, daß sie ein Buch von diesem Typen namens Philip Wylie hatten. Generation of Vipers. Er setzte die Lehre der Kirche mit intellektueller Korruption gleich, mit der Verkrüppelung junger Geister.«
»Manche Leute sind dieser Ansicht«, sagte ich.
»Ja, ich weiß. Ich kapiere es zwar nicht, aber ich stoße drauβen in der Welt immer wieder darauf. Die Leute meinen anscheinend, daß man nicht sehr helle sein kann, wenn man zur Kirche geht. Ich meine, nur weil ich ein Wiedergeborener bin, heißt das nicht, daß ich IQ-Punkte eingebüßt habe.«
»Bestimmt nicht.«
»Es ist eben so, daß ich ohne moralischen Kompaß aufgewachsen bin. Ich habe kein Gefühl dafür gekriegt, welche Regeln galten, also habe ich es einfach darauf angelegt. Ich habe immer wieder die Grenze überschritten und darauf gewartet, daß jemand käme und mir sagte, wo Schluß ist.«
»Aber soweit ich gehört habe, sind Sie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Sie müssen die Regeln gekannt haben, denn jedesmal, wenn Sie eine gebrochen haben, sind Sie vor Gericht gelandet. Donovan sagt, Sie hätten mehr Zeit in Besserungsanstalten verbracht als zu Hause.«
Er lächelte verlegen. »Das stimmt, aber wissen Sie, was seltsam ist? Ich fand die Anstalt gar nicht so schlimm. Da konnte ich wenigstens mit Kids zusammensein, die genauso verkorkst waren wie ich. Mann, war ich abgedreht! Ich bin einfach ausgerastet. Ich war ein Irrer, in jeder Hinsicht ausgeflippt. Es ist nicht leicht, heute darüber nachzudenken. Mir fällt es schwer, mich in mich selbst einzufühlen und in den, der ich damals war. Ich weiß, was passiert ist. Ich meine, ich weiß, was ich gemacht habe, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, daß ich es gemacht habe. Ich wollte mich gut fühlen. Ich habe viel über das alles nachgedacht, und das ist die einzige Erklärung, die mir bisher eingefallen ist. Ich habe mich schlecht gefühlt und wollte, daß es mir besserginge. Kam mir eben so vor, als wäre Dope der schnellste Weg dorthin. Ich habe seit über fünfzehn Jahren keine Drogen oder harten Getränke mehr angerührt. Ich trinke zwar ab und zu ein Bier, aber ich rauche nicht, spiele nicht Karten und gehe nicht tanzen. Ich führe den Namen des Herrn nicht unnütz im Munde und fluche nicht... besonders oft. Wenn ich mir den Zeh anstoße, kann ich fürchterlich toben, aber ich vermeide Schimpfwörter.«
»Tja, das ist gut.«
»Für mich schon. Damals wankte ich ständig am Abgrund entlang. Ich glaube, ich habe darauf gehofft, daß meine Eltern endlich einen Schlußstrich ziehen und dabei bleiben würden. Daß sie sagen würden: ›He, jetzt reicht’s. Diesmal hast du’s wirklich zu weit getrieben.‹ Aber wissen Sie was? Mein Dad war zu nachgiebig. Er hat immer nur gelabert. Sogar wenn er mir einen Riesenarschtritt versetzt hat, sogar als er mich vor die Tür gesetzt hat, hat er noch gesagt: ›Denk drüber nach, mein Sohn. Du kannst wiederkommen, wenn du es begriffen hast.‹ Aber wie denn? Wenn ich was begriffen habe? Ich hatte keine Ahnung. Ich war völlig orientierungslos. Ich war wie ein Boot, das mit Volldampf fährt, aber ohne sinnvolle Richtung, das nur lärmend große Kreise zieht. Wissen Sie, was ich meine?«
»Sicher. Auf der High School war ich selbst eine Chaotin. Schließlich bin ich Polizistin geworden, bevor ich das hier angefangen habe.«
Er lächelte. »Ohne Witz? Sie haben getrunken und Dope geraucht?«
»Unter anderem«, sagte ich bescheiden.
»Kommen Sie. Was zum Beispiel?«
»Ich weiß nicht. Die anderen in meiner Klasse waren alle anständig, aber ich nicht. Ich war wild. Ich hab die Schule geschwänzt. Ich habe mich mit abgestürzten Typen herumgetrieben, und es hat mir gefallen. Die haben mir gefallen«, sagte ich. »Ich war eine Außenseiterin, genau wie Sie, schätze ich.«
»Auf welche High School sind Sie denn gegangen?«
»Santa Teresa High.«
Er lachte. »Sie waren eine Mauerratte?«
»Allerdings«, sagte ich. Mauerratten waren die Kids, die immer auf einer niedrigen Mauer hockten, die hinten um das Schulgelände verlief. Es wurde viel geraucht, alle trugen ausgefallene Klamotten und hatten wasserstoffblonde Haare.
Guy lachte. »He, das ist ja toll!«
»Ich weiß nicht, wie toll es war, aber ich hab’s eben gemacht.«
»Wie haben Sie zu sich gefunden?«
»Wer sagt, daß ich es geschafft habe?«
Er erhob sich, als hätte er eine Entscheidung getroffen. »Kommen Sie mit rüber ins Pfarrhaus, dann können Sie Peter und Winnie kennenlernen«, sagte er. »Zu dieser Zeit sind sie immer in der Küche und kochen das Essen für die Bibelstunde am Donnerstag abend.«
Ich folgte ihm den Mittelgang entlang und durch eine Tür an der Hinterseite. Ich merkte, wie sich in mir leiser Widerstand zu regen begann. Ich wollte nicht, daß jemand mich zu bekehren versuchte. In meinen Augen ist zuviel Tugend ein ebensolches Laster wie Verdorbenheit.