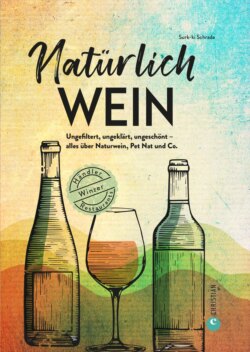Читать книгу Natürlich Wein! - Surk-ki Schrade - Страница 6
WEINSOZIALISIERUNG
ОглавлениеWo wurde man selbst »weinsozialisiert«? Eine zunächst komisch klingende Frage, es lohnt aber, dieser nachzugehen. »Ich trinke nur Weine aus Italien« – »Nein, ich trinke nur Merlot.« Die Entscheidungen für die eine oder andere Sorte liegen oft im sozialen Gefüge. Der eine hat ein Ferienhaus im Ausland und holt sich mit einer Flasche von dort ein Stück Urlaub in die düstere Heimat. Die andere wächst in einem Weingebiet auf, Reben drum herum, so weit das Auge reicht, und bleibt dort verwurzelt. Der Nächste trinkt auf jeden Fall etwas anderes als seine Eltern, aus Abnabelungsgründen.
Die eigene Weinvorliebe lässt sich mit einer Art Verein vergleichen: Je nach dem, was man trinkt, gehört man zu einem Kreis mit eigenen Spielregeln. Ob Frankophile, Alt-68er oder Hipster – die Mitglieder definieren sich und ihre Freunde über ein bevorzugtes Getränk. Die Gruppendynamik bestimmt das Anrecht auf Zugehörigkeit und Mitspracherecht. Fatal wird es, wenn man sich seiner Gruppe nicht bewusst ist oder durch Mitmenschen hineingezogen wird, ohne das selbst entschieden zu haben.
DIE VINO-TRINKER*INNEN: Vino ist das italienische Wort für Wein. Auch in Deutschland spricht man von »amore«, »passione« und »la dolce vita« und meint die großen Gefühle. Eine hochgegriffene Erwartung an ein Getränk. Verbunden wird sie mit Urlaub, Ferien, Sonne, Meer, Aperitivo, leichter Kleidung und einer lauen Brise, die sanft durchs Haar weht. Kurzum, das absolute Gegenteil davon, was jeder von uns in seinem Alltag lebt. Vino steht für Flucht, Auszeit und Nichtdeutsch.
DIE »PETIT-ROUGE«-TRINKER*INNEN: Viele Alt-68er sind früher gern durch Südfrankreich getrampt. Rotwein aus dem Zapfkanister ist eine echte Waffe gegen den Kapitalismus und der Liter darf nicht mehr als 2 Euro kosten, so wie damals in jenem kleinen Dorf bei der Kooperative. Dass Zeiten sich ändern und ein 2-Euro-Wein heute kein Dorf mehr ernährt, wird gerne ausgeblendet. Bordeaux ist gleich Snobismus und daher verpönt. Alternativ zum kleinen Ballonglas geht auch das mallorquinische Weingläschen, das wie ein Wasserglas aussieht. Denn das Weinglas mit Stiel gehört in die Bonzen-Ecke.
DIE PUNKTE-JONGLIERER*INNEN: In der Weinwelt herrschen Rankings, die berühmtesten sind die erwähnten Punkte von Robert Parker. Er hat sich in den 1990ern als internationaler Weinkritiker etabliert und führt nun sein System als Markenzeichen, er selbst arbeitet nicht mehr, er lässt arbeiten. Seine Macht reichte eine Weile lang bis zum Bankrott mancher Güter, wenn sein Daumen nach unten ging. »Der Wein hat 96 Parker-Punkte, dann muss er ja gut sein.« Hier lautet die Spielregel: blindlings glauben, nicht infrage stellen, trinken und behaupten, es schmecke großartig. Erst wenn man sich die Mühe macht, solche Weine unbeeinflusst selbst zu beurteilen, und dann erfahrungsbasiert zu dem Schluss kommt, dass sie einem wirklich schmecken, können die Parker-Punkte Orientierung geben. Wer mitreden will, sollte das ausprobieren. Mehr dazu und gut zusammengefasst unter www.webweinschule.de.
DIE LAGENBEZEICHNER*INNEN: Gerade in Deutschland unterscheidet man Weine nach deren Lage, also der geografischen Stelle, wo die Trauben wachsen. Sie heißt mal Hölle, mal Sonnenberg, hier Brotwasser, dort Pulvermächer oder Feuerstein, von Schlossberg bis Sonnenuhr gibt es unzählige mehr. Worin sich Lagen unterscheiden, wird ab Seite 68 untersucht.
DIE SAMMLER*INNEN: Hauptsache besitzen, ist hier das Motto. Man mietet sich vielleicht ein Fach in einer »Winebank«. Solche Orte bieten die richtigen Lagerbedingungen. Man führt Listen über die Schätze und ja, manchmal öffnet man auch einen. Vorrangig geht es aber darum, Weinflaschen wie Kunst zu behandeln. Je rarer, desto teurer, desto wertvoller. Wenn dann auf dem Etikett sogar noch handschriftlich so etwas steht wie »N° 67 von 376«, weiß man, dass es maximal noch 375 andere Flaschen von diesem Jahrgang auf der ganzen Welt gibt und das verschafft einem ein gutes Gefühl.
DIE ETIKETTENTRINKER*INNEN: Wem der ganze Schnickschnack um Rebsorten, Herkunft und Qualität zu undurchsichtig und wenig verständlich ist, der greift oft auch zu schönen Etiketten. Schön ist wieder Geschmackssache. Ob klassisch à la Château mit Schnörkelschrift, schlicht und modern oder extravagant künstlerisch gestaltet – Etiketten sind Kaufmagneten. Das haben Marketingagenturen erkannt und toppen sich gegenseitig darin, Lebensgefühle durch Humor und Wortspielereien zu vermitteln. Und tatsächlich schmeckt der Wein dann wegen des Etiketts meistens gut.
DIE KRITIKEN-LESER*INNEN: In einer Zeitschrift oder in einem Magazin wird ein Wein empfohlen, also wird er gekauft. Wer diesen Beitrag geschrieben hat, weiß man erstmal nicht, kennt diesen Menschen nicht persönlich. Dazu muss man wissen, dass bei bestimmten Presseerzeugnissen Weingüter dafür bezahlen müssen, dass ihre Produkte überhaupt besprochen und verpunktet werden. Wie bei Literatur- oder Filmkritikern empfiehlt es sich, über einen längeren Zeitraum stichprobenartig kritisch zu testen, ob man die Sprache, den Geschmack, den Stil der Weinempfehlung nachvollziehen kann und sich darin wiederfindet.
DIE WEINHÄNDLER-TREUEN: Weinhändler*in, Hausärzt*in oder Anwält*in – sie alle zählen zum Sammelsurium an notwendigen Menschen, die das eigene soziale Leben bereichern können. Den kleinen Laden im eigenen Viertel unterstützt man gerne. Man kennt sich schon länger, hat auch schon mal zusammen Weine probiert, ein Vertrauensverhältnis wurde aufgebaut. Man schätzt die Fachberatung und lässt sich gerne auch mal auf eine neue Geschmacksrichtung ein. Gute Händler*innen holen ihre Kunden*innen ab und orientieren sie je nach Neugier und Vorlieben. Da ist man gut aufgehoben, braucht allerdings etwas Zeit zum Kennenlernen.
DIE NATURWEINTRINKER*INNEN: Manche langweilen sich in der normalen Weinwelt und wollen geschmacklich überrascht werden, andere achten auf alles, was sie konsumieren, und landen aus Nachhaltigkeitsgründen beim Naturwein. Allergiker*innen finden sich ein, die Schwefel oder andere Zusatzstoffe nicht vertragen und endlich wieder Wein genießen wollen, ohne dafür mit rotem Ausschlag im Dekolleté oder verstopfter Nase zu bezahlen. Diese Gattung ist neu und entwickelt sich weiter. Ihre Anhänger sind jung und alt, reich und arm, erfahrene Weintrinker oder Novizen. Eine Charaktereigenschaft haben sie gemeinsam: Sie sind neugierig. Jungen Menschen fällt der Zugang zu Wein über Naturwein leichter, da kein großes Wissen vorausgesetzt wird, der Gaumen noch nicht formatiert ist und die Szene eher gelassen und in Partystimmung daherkommt. Hier darf jede*r frei entscheiden, was schmeckt. Hier gibt es keine Lobby, keine Punkte oder Medaillen. Hypes in sozialen Medien feiern allerdings auch schon manche Weingüter und Weine wie Rockstars.
| Naturwein ist … ist die spannendste, vielseitigste und konsequenteste Art von Wein. |
– Johannes / frohnatur NATURWEINE
FAZIT
Jede Art des Weintrinkens bietet eine Orientierung in der Weinauswahl. Sicherlich existieren noch andere Charaktere und Mischtypen. Um mündig zu werden, empfiehlt sich eine bewusste eigene Entscheidung, in welche Richtung der Genuss gehen soll, eine selbst gefundene Definition, was man unter einem guten Wein für sich versteht, was man erwartet und was er denn können muss. Frei und je nach Neugierde und Wissensstand kann sich dann der eigene Geschmack auch immer wieder verändern und weiterentwickeln.
KOOPERATIVE oder auch »Cave cooperative« – so nennt man eine Winzergenossenschaft. Viele Weinbauern in einem Dorf, einer Gegend ernten Trauben, bringen diese an einen gemeinschaftlichen Ort, an dem dann der Wein für alle gemacht wird, und darüber hinaus auch verkauft wird.