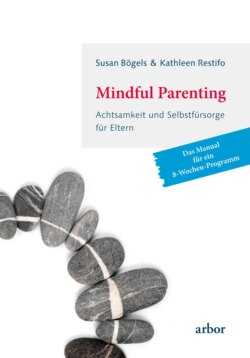Читать книгу Mindful Parenting - Susan Bögels - Страница 8
ОглавлениеKAPITEL 2
Elternverhalten und elterlicher Stress aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive
2.1 Einleitung: Warum ein evolutionsgeschichtlicher Blick auf Elternschaft und Achtsamkeit lohnt
Eltern zu sein, ein Kind zu erziehen – mit all den Anstrengungen, die erforderlich sind, bis ein Menschenkind erwachsen ist – kann eine der größten Freuden des Lebens sein. Doch für viele Väter und Mütter bringt das Elternsein auch neue Belastungen mit sich (Cohen et al. 1997). Insbesondere Eltern, die an psychischen Problemen wie Depressionen oder Ängsten leiden oder Kinder mit Entwicklungsstörungen oder emotionalen Schwierigkeiten haben, stehen häufig unter großem Stress (Deater-Deckard 1998). Angesichts der scheinbar allgegenwärtigen Belastungen, die mit dem Elternsein verbunden sind, stellte sich uns die Frage, ob der Stress, den wir als Eltern erleben, vielleicht evolutionäre Grundlagen hat. Um die Anthropologin Sarah Hrdy zu paraphrasieren: Gibt es möglicherweise ein „Primatenrecht“ auf elterlichen Stress (Hrdy 2009; dt. 2010, S. 184)? Mit anderen Worten: Kann uns eine evolutionsbiologische Perspektive helfen, die Belastungen, mit denen heutige Eltern konfrontiert sind, besser zu verstehen? Und inwiefern kann Achtsamkeit hier eine Hilfe sein?
Unser Verhalten als Eltern ist zweifellos durch natürliche Selektion geformt worden (Hrdy 1999). In der Geschichte der menschlichen Evolution wurden elterliche Eigenschaften und Verhaltensweisen, die die Chancen eines Kindes erhöhten, das Erwachsenenalter zu erreichen, auch mit höherer Wahrscheinlichkeit an die folgende Generation weitergegeben. So gerne wir glauben würden, unser Erziehungsstil sei ein Ergebnis bewusster Entscheidungen, unserer eigenen Kindheitserfahrungen und der Kultur, in der wir leben, könnte der größte Teil dessen, was uns als Eltern auszeichnet, in unserer gemeinsamen evolutionären Vergangenheit liegen. „Wir sind von der Evolution geprägte Wesen“, schreibt der Psychologe Paul Gilbert (Gilbert 2009; dt. 2011, S. 41), und wir könnten hinzufügen: Wir sind von der Evolution geprägte Eltern.
Welche Bedeutung hat die Evolutionstheorie im Hinblick auf die Belastungen, denen wir uns heute als Eltern gegenübersehen? Viele Eltern verurteilen sich wegen ihres vermeintlichen Versagens bei der Erziehung ihrer Kinder oder wegen der Schwierigkeiten, die ihre Kinder haben. Aber aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive könnten viele Eigenschaften, die wir heute als hinderlich erleben, genau jene Eigenschaften gewesen sein, die unseren Vorfahren das Überleben ermöglicht haben.
Wie kann Achtsamkeit uns helfen, besser mit Eigenschaften und Verhaltensweisen umzugehen, die in unserer heutigen Umwelt nicht mehr hilfreich sind? Durch die Praxis der Achtsamkeit lernen wir, mit unseren Erfahrungen – positiven wie negativen – gegenwärtig zu sein, sie wahrzunehmen und zu akzeptieren. Wenn wir unsere Reaktionen als Eltern wahrnehmen und als das annehmen, was sie sind, können wir eine freundlichere und mitfühlendere Haltung uns selbst und unseren Kindern gegenüber entwickeln. So paradox es klingt: Je besser wir in der Lage sind, unsere Situation klar zu sehen und zu akzeptieren, desto eher sind wir in der Lage, sie zu verändern.
In diesem Kapitel werden wir uns mit den evolutionären Grundlagen des Elternseins und der damit verbundenen Stressbelastungen sowie mit der Evolution von Bindung, Empathie und Mitgefühl beschäftigen. Wir werden untersuchen, inwiefern diese Perspektive für unsere Erfahrung als Eltern im 21. Jahrhundert bedeutsam ist und wie Achtsamkeit uns helfen kann, weiser mit unseren ererbten Reaktionsweisen umzugehen.
2.2 Die Quellen elterlicher Stressbelastung
Was macht das Elternsein so belastend? Aus evolutionsbiologischer Perspektive gibt es mindestens vier Quellen elterlichen Stresses: die enorme Menge an Ressourcen, die nötig ist, um ein Menschenkind großzuziehen; die Tatsache, dass sich unser heutiges familiäres Umfeld stark von dem Umfeld unterscheidet, in dem sich unsere Vorfahren entwickelt haben; unser ererbtes Affektregulationssystem und unser ererbtes Bindungssystem.
2.2.1 Viele Ressourcen sind nötig, um ein Menschenkind großzuziehen
Erziehung ist mit einem enormen Ressourceneinsatz verbunden. Keine andere Spezies investiert so viel Zeit und Ressourcen in die Aufzucht des Nachwuchses wie der Mensch. Selbst im Vergleich mit unseren engsten Primatenverwandten, den Menschenaffen, die vier bis sieben Jahre lang für ihre Nachkommen sorgen, ist die Last für menschliche Eltern bedeutend größer: 18 Jahre und länger umsorgen und ernähren wir unsere Kinder (die Kosten für ein Studium nicht einmal eingerechnet …) (Hrdy 2009). Trotzdem sehen und würdigen wir die ungeheure Größe dieser Last nur selten. Stattdessen sehen wir uns oft mit idealisierten Bildern des Elternseins, insbesondere des Mutterseins, konfrontiert, was dazu führen kann, dass Eltern, denen es nicht gelingt, diesen unrealistischen Maßstäben zu entsprechen, sich schuldig oder unzulänglich fühlen.
Tatsächlich erfordern Mutter- und Vaterschaft jedoch schon seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte einen ständigen Ausgleich zwischen den Ressourcen, die ein Elternteil braucht, um für sich selbst zu sorgen, und den enormen Ressourcen, die nötig sind, um den Nachwuchs aufzuziehen. Reichen die Ressourcen nicht aus, dann beeinträchtige dies, so betont Sarah Hrdy, auch „mütterliche Instinkte“ wie die Motivation und die Fähigkeit, hingebungsvoll für Kinder zu sorgen. So stellt Hrdy fest, dass die evolutionäre Entwicklung im Hinblick auf Schwangerschaft und Kindeserziehung auf die Sicherstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den zur Kinderaufzucht benötigten Ressourcen und den Ressourcen, die der Mutter selbst zur Verfügung stehen, zielte. Bei unseren Jäger-Sammler-Vorfahren wurde die Zahl der Nachkommen, die eine Frau gebar, durch ein fein austariertes Gleichgewicht zwischen den Umweltbedingungen und der weiblichen Physiologie reguliert. Die erste Regelblutung (Menarche) beispielsweise setzt erst dann ein, wenn der Körper einer Heranwachsenden bestimmte Proportionen aufweist. Im Pleistozän, jener Phase der Erdgeschichte, in der der moderne Mensch sich entwickelte, erreichten nur Mädchen, die in einer Umgebung mit guten Nahrungsgrundlagen heranwuchsen und von ihren Müttern oder anderen Pflegepersonen ernährt wurden, das fortpflanzungsfähige Alter. Diese natürliche Selektion sorgte dafür, dass junge Frauen, die schwanger wurden, ihre Kinder in einem Umfeld zur Welt brachten, das sie bei der Versorgung dieser Kinder unterstützte, d. h. reich an Ressourcen und Betreuungspersonen war. Das Stillen war eine weitere Form der Geburtenkontrolle: Während der in jener Zeit üblicherweise zwei bis vier Jahre dauernden Stillphase hatte eine Frau keinen Eisprung und konnte deshalb in der Regel auch nicht erneut schwanger werden. Dies bewahrte Mütter davor, für zu viele Säuglinge oder Kleinkinder gleichzeitig sorgen zu müssen (Hrdy 1999). Diese natürlichen Einflussfaktoren auf die Zahl der Geburten existieren heute nicht mehr. Ein ausreichender Körperfettanteil als Voraussetzung für die Menarche ist nicht länger gleichbedeutend mit dem Vorhandensein ausreichender Ressourcen für die Aufzucht eines Kindes und die meisten Frauen stillen nicht lange genug, um von dem natürlichen Schutz vor Empfängnis zu profitieren, den das Stillen bietet.
2.2.2 Geteilte Fürsorge: Schon immer brauchten Mütter Hilfe bei der Aufzucht ihrer Kinder
Eine weitere Stressquelle heutiger Eltern resultiert daraus, dass sich die Umgebung, in der wir heute leben, radikal von der Umgebung unserer Jäger-Sammler-Vorfahren unterscheidet, in der sich die menschliche Evolution zu über 90 Prozent abspielte (Konner 2010). Für die längste Zeit unserer evolutionären Geschichte war nicht das Konzept der Kernfamilie – Eltern und Kinder leben für sich unter einem Dach –, sondern das Leben in der Gemeinschaft die Norm. Anthropologen, die heutige Jäger-Sammler-Kulturen in Afrika und Südamerika untersuchten, um so mehr darüber herauszufinden, wie unsere Vorfahren gelebt haben, schlossen aus der systematischen Beobachtung vieler solcher Gesellschaften, dass die Fürsorge für die Nachkommen als „kooperative Aufzucht“ (cooperative breeding) stattgefunden haben muss (Hrdy 2009; Konner 2010). Mit anderen Worten: Mütter erhielten Unterstützung von anderen.
Bei Spezies, die in kooperativer Aufzucht für ihre Jungen sorgen, sind nicht nur die Mütter, sondern auch andere Individuen, sogenannte Allomütter, zu denen Väter, Großeltern, ältere Geschwister und Tanten, aber auch nicht mit der Mutter verwandte Mitglieder der Gemeinschaft gerechnet werden können, in die Kinderbetreuung und -versorgung involviert. Obwohl diese Form der Aufzucht schon für viele andere Spezies von Bienen bis hin zu einigen Hunde- und Primatenspezies beschrieben wurde, haben Evolutionstheoretiker erst vor Kurzem ihre Bedeutung für die menschliche Evolution erkannt. Die Befunde der Evolutionsforschung lassen darauf schließen, dass Mütter während der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte bei der Aufzucht ihrer Kinder von vielen anderen Pflegepersonen unterstützt wurden (Hrdy 2009; Konner 2010). Die in der westlichen Kultur gehegte Erwartung, dass sich Mütter exklusiv und ohne Inanspruchnahme anderer Personen um ihre Säuglinge und Kleinkinder zu kümmern hätten, passt einfach nicht zur Geschichte der menschlichen Evolution und Anpassung.
2.2.2.1 Schlussfolgerungen für heutige Eltern
Aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive ist die Kernfamilie eher eine Abweichung als eine „naturgegebene“ Regel. Sarah Hrdy zufolge entstand das Ideal der Kernfamilie in den 1950er Jahren und sah vor, dass ein Elternteil arbeiten ging und die Familie ernährte, während der andere sich ausschließlich um Haushalt und Kinder kümmerte, was nur während des Wirtschaftsbooms der Nachkriegszeit möglich war. So gesehen ist die Kernfamilie also kaum ein Wimpernschlag in der langen Geschichte der Menschheit (Hrdy 2009). Doch gerade der gehobene Lebensstandard, den die westlichen Industrienationen heute genießen, fordert einen hohen Preis von den Müttern: Denn nun lastet eine Aufgabe, die früher von vielen nah verwandten, vertrauten und hoch motivierten Pflegepersonen wie Großmüttern, Tanten und Cousinen gemeinsam bewältigt wurde, fast ganz auf den Schultern der Mütter (und in manchen Fällen der Väter). Obwohl die meisten westlichen Frauen heute so frei wie nie zuvor in der Geschichte über die Anzahl und den Zeitpunkt ihrer Schwangerschaften bestimmen können, folgen diese nicht selten in viel kürzeren Abständen aufeinander als bei unseren Ahninnen im Pleistozän. Wenn man berücksichtigt, dass die meisten Mütter und Väter in industrialisierten Gesellschaften außer Haus arbeiten und dass es an guten und bezahlbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten mangelt, überrascht es nicht mehr, dass viele Eltern unter Stress leiden. Einfach ausgedrückt: Verglichen mit unseren Jäger-Sammler-Vorfahren tragen wir bei der Aufzucht unserer Kinder eine größere Last (unsere Kinder folgen dichter aufeinander), verfügen aber über geringere Ressourcen (wir bekommen weniger Unterstützung von anderen Pflegepersonen, sind sozial relativ isoliert und haben wegen unserer beruflichen Verpflichtungen weniger Zeit für unsere Kinder). Auch wenn wir unsere Vorfahren bei einem Modewettbewerb in den Schatten stellen dürften: Wenn es um die Qualität des Elternalltags geht, tragen sie klar den Sieg davon.
2.2.2.2 Wie kann Achtsamkeit helfen?
Aus der menschlichen Evolutionsgeschichte können wir lernen, dass wir schon immer ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen des Elternseins und der Fürsorge für uns selbst herstellen mussten, und dass wir nur dann für unsere Kinder sorgen können, wenn uns genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um für uns und für sie zu sorgen. Auch wenn Eltern genug Geld haben, um ihre Kinder zu ernähren, kann es schwierig und mühsam sein, die Bedürfnisse der Kinder und der Familie mit beruflichen Anforderungen zu vereinbaren. Wenn die mit dem Elternsein verbundenen körperlichen und emotionalen Beanspruchungen unsere Belastungsgrenze überschreiten, fühlen wir uns vielleicht gestresst, erschöpft und unzulänglich, sind deprimiert oder sehr selbstkritisch. In unserer modernen westlichen Gesellschaft gilt es als erstrebenswert, sein Möglichstes zu tun, und das Akzeptieren der eigenen Grenzen wird oft als Schwäche angesehen. Doch in unserer evolutionären Geschichte hatten Kinder bessere Überlebenschancen, wenn ihre Eltern über genügend Ressourcen zu ihrer Aufzucht verfügten, und dazu zählte die Unterstützung anderer (Hrdy 2009).
In der ersten Sitzung eines Mindful-Parenting-Kurses laden wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, sich der mit dem Elternsein verbundenen Stressbelastungen, wie sie sie in ihrem Körper, ihren Gedanken und Gefühlen erleben, bewusst zu werden. Wir gestehen uns ein, dass es sehr anstrengend ist, Vater oder Mutter zu sein, und sprechen darüber, dass die menschliche Spezies sich ursprünglich in einer Umgebung entwickelte, in der die Gemeinschaft Eltern bei dieser Aufgabe stärker unterstützte. Dies kann Eltern helfen, den Stress zu erkennen, unter dem sie stehen, und ihn mit Selbstmitgefühl zu akzeptieren. Es ermutigt sie außerdem, ihren eigenen Bedürfnissen mehr Raum zu geben, indem sie sich die Frage stellen: „Was brauche ich?“ statt: „Was stimmt nicht mit mir?“ Wir können beginnen, die Ausgewogenheit unserer Lebensbereiche zu überprüfen und uns zu fragen, wie wir besser für uns selbst sorgen und zusätzliche Ressourcen und Unterstützung mobilisieren können.
2.2.2.3 Die Evolution der geteilten Fürsorge
Wie und warum entwickelte sich das System der gemeinsamen Aufzucht, und was bedeutet das für unser Elternsein, für die kindliche Entwicklung und für die menschliche Natur? Diese und andere Fragen stellte sich Sarah Hrdy in ihrer Untersuchung über die evolutionären Grundlagen der Mutter- und Elternschaft. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, beginnt Hrdy mit einer weiteren Frage: Wie war eine Entwicklung möglich, die dazu geführt hat, dass unsere Spezies Nachkommen mit derartig großen Gehirnen hervorbringt, die nach ihrer Geburt vollständig von elterlicher Fürsorge abhängig sind und so langsam heranwachsen, dass sie viele Jahre lang von ihren Eltern ernährt und umsorgt werden müssen? Die Beantwortung dieser Frage wird noch schwieriger, wenn man berücksichtigt, dass der Grad der Einbeziehung von Vätern in die Kinderaufzucht zwar beim Menschen höher war als bei den meisten anderen Primaten, aber im Laufe der Evolution bis hin zur Gegenwart extrem schwankte (Hrdy 2009).
Hrdy geht davon aus, dass Mütter bei der Aufzucht ihrer Kinder immer schon auf Hilfe angewiesen waren, denn dies war die einzige Möglichkeit, um in der Phase der Evolution, in der der moderne Mensch sich entwickelte, langsam heranreifende, investitionsintensive und abhängige Nachkommen bis ins Erwachsenenalter durchzubringen. Menschenkinder benötigen enorm viele Kalorien und sehr viel Fürsorge, um zu überleben und heranzureifen – sehr viel mehr als die Nachkommen unserer nächsten Verwandten aus dem Reich der Affen. Dennoch folgen die Geburten bei menschlichen Müttern in kürzeren Abständen aufeinander als bei Menschenaffenmüttern (heutige Jäger-Sammler-Mütter bringen ungefähr alle drei bis vier Jahre ein Kind zur Welt, während Menschenaffenmütter in Intervallen von etwa sechs Jahren gebären). Wie also war es möglich, dass Menschen sich trotz der hohen „Kosten“ der Kinderaufzucht erfolgreicher vermehrten als andere Große Menschenaffen? Hrdys Antwort ist simpel: Sie hatten genügend Helfer. Die These von der kooperativen Aufzucht könnte erklären, weshalb unsere Vorfahren in der Lage waren, sich zahlreicher zu vermehren als ihre Menschenaffenverwandten und die Welt zu bevölkern (Hrdy 2009).
2.2.2.4 Wer half den Müttern, ihre Kinder aufzuziehen?
Wenn unsere Vorfahren also Hilfe benötigten, um ihre kostspieligen und lange von ihnen abhängigen Jungen aufzuziehen, wer half ihnen dann? Eine Antwort lautet: die Väter, und tatsächlich engagieren sich Menschenväter, verglichen mit den Vätern der meisten anderen Säugetiere und Primaten, ungewöhnlich stark. Dennoch ist die Schwankungsbreite der väterlichen Beteiligung an der Kinderaufzucht bei den bislang untersuchten menschlichen Populationen extrem hoch: An einem Ende des Spektrums stehen Väter, die nach der Befruchtung keinerlei Kontakt zu ihren Nachkommen haben, am anderen die stark involvierten Väter einiger Jäger-Sammler-Gesellschaften und die „Hausmänner“ in westlichen Industriegesellschaften (Hrdy 2009; Hewlett 2004; Konner 2010). Das heißt nicht, dass Väter nicht wichtig wären – das sind und waren sie auch aus evolutionärer Perspektive. Rätselhaft bleibt jedoch, wie es unseren Vorfahren gelingen konnte, sich so viel erfolgreicher zu vermehren als andere Primaten und sich unter den unterschiedlichsten Umweltbedingungen überall auf der Erde anzusiedeln, wenn die Mütter ihren Nachwuchs nicht allein aufziehen und auch nicht zuverlässig auf die Hilfe der Väter setzen konnten.
Vor einigen Jahrzehnten begannen sich ein paar Anthropologen zu fragen, wer außer den Vätern in der langen Geschichte der menschlichen Evolution den Müttern geholfen haben könnte, für ihre Kinder zu sorgen. Ihre Antwort auf diese Frage lautet: die Großmütter. Die Anthropologin Kristen Hawkes und ihre Kollegen, die in einer modernen Jäger-Sammler-Gesellschaft systematisch alles Essbare wogen, das jede Einzelperson von der Nahrungssuche zurückbrachte, stellten fest, dass die Großmütter weit größere Mengen an Wurzeln, Knollen und Nüssen sammelten, als man bis dahin angenommen hatte (Hawkes et al. 1989). Die Männer hingegen kamen bei Wildknappheit oft mit leeren Händen zurück. Während frühere Evolutionstheoretiker die Jagdbeute der Väter noch für die wichtigste Nahrungsquelle der Kinder gehalten hatten, zeigten Hawkes Forschungsergebnisse, dass die von den Großmüttern beigesteuerten Wurzeln und Nüsse für die tägliche Ernährung der Population unverzichtbar waren, wenn die Jagd erfolglos blieb. Mit ihrer Studie lieferten Hawkes und ihre Kollegen die empirische Untermauerung für die Annahme, dass in frühen Jäger-Sammler-Gesellschaften die Großmütter bei der Nahrungsbeschaffung und damit bei der Erhöhung der Überlebenschancen ihrer Enkel eine wesentliche Rolle gespielt haben dürften.
Dieser Befund könnte helfen, das ansonsten rätselhafte Phänomen zu erklären, dass Frauen die einzigen weiblichen Säugetiere sind, die nach der Menopause noch eine beträchtliche Anzahl von Lebensjahren vor sich haben. Hawkes vermutete, dass das Teilen von Nahrung zwischen Mutter und Kind zur Entwicklung einer verlängerten postmenopausalen Lebensspanne geführt haben könnte. Auch nach der Entwöhnung sind Menschenkinder noch nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Dass die Mütter schwer zugängliche Nahrungspflanzen wie Wurzeln und Knollen mit ihren Kindern teilten, dürfte von entscheidender Bedeutung für das Überleben der Nachkommen gewesen sein. (Es mag zwar naheliegend erscheinen, dass Mütter Nahrung mit ihren Kindern teilen, doch bei unseren nächsten Verwandten, den großen Menschenaffen, ist das Teilen von Nahrung nach der Entwöhnung selten.) Eine ältere Frau, die ihrer Tochter beim Sammeln von Pflanzen und der Ernährung der Enkelkinder half, erhöhte den Fortpflanzungserfolg ihrer Tochter, weil diese sich auf die Versorgung eines Neugeborenen konzentrieren konnte, während die älteren, aber noch immer abhängigen Geschwister von ihrer Großmutter miternährt wurden. Das könnte im Laufe der Zeit dazu geführt haben, dass das längere Überleben von Frauen nach der Menopause von der Selektion begünstigt wurde, weil es die Überlebenschancen ihrer Töchter, Enkelinnen und Nichten vergrößerte (Hawkes et al. 1998). Diese These wird durch Untersuchungen heutiger Jäger-Sammler-Kulturen gestützt, die zeigen, dass die Anwesenheit einer Großmutter mütterlicherseits die Überlebenswahrscheinlichkeit von Kindern erhöht (Hrdy 2009). Während moderne westliche Gesellschaften der Sorge der jüngeren für die ältere Generation einen hohen moralischen Wert beimessen, betont Hawkes, dass die Verhältnisse in der Geschichte der menschlichen Evolution andersherum lagen: Postmenopausale Frauen hätten nur dann überlebt, wenn ihre Anwesenheit den Fortpflanzungserfolg ihrer Töchter und die Überlebensrate ihrer Enkelinnen und Nichten steigerte.
Ein letztes Rätsel in der Evolution der kooperativen Aufzucht ist die Frage, warum unsere Vorfahren irgend jemand anderem den eigenen Nachwuchs anvertraut haben sollten. Wild lebende Menschenaffenmütter lassen so gut wie niemals zu, dass andere Gruppenmitglieder ihr Junges auch nur halten, geschweige denn als „Babysitter“ einspringen. Das liegt an der sehr realen Gefahr, dass Jungtiere von Männchen einer anderen Gruppe getötet oder von einer übereifrigen Babysitterin gekidnappt werden. Sarah Hrdy stellte sich die Frage, welche Umstände eine Primatenmutter dazu gebracht haben könnten, das Risiko einzugehen und anderen ihr Junges anzuvertrauen. Sie vermutet, dass zwei Faktoren wichtig gewesen sein können: Erstens könnten weibliche Menschenaffen, die in der Nähe ihrer eigenen Mutter lebten, genügend Vertrauen zu dieser gehabt haben, um ihr Zugang zu ihren Jungen zu gewähren. Jüngste Forschungen stützen diese Vermutung: Zumindest einige unserer Vorfahren hatten flexible Wohnsitzregeln, die zuließen, dass Mütter vor der Geburt ihrer Nachkommen zu ihrer eigenen Mutter zurückkehrten oder dass Großmütter zu ihren Töchtern zogen, um ihnen nach der Geburt zu helfen. Zweitens dürften Mütter dank wachsender kognitiver Fähigkeiten im Laufe der Evolution in der Lage gewesen sein, Risiko-Nutzen-Abwägungen anzustellen. So konnte eine Mutter abschätzen, ob ihrem Baby vielleicht mehr Gefahr drohte, wenn sie es allein zurückließ, als wenn sie es in die Obhut einer Verwandten gab, der sie vertraute. In dem Maße, in dem die Bereitschaft von Müttern, einer anderen Person ihr Kind anzuvertrauen, ihren Fortpflanzungserfolg und die Überlebenschancen ihrer Nachkommen erhöhte, wurde dieses Merkmal evolutionär begünstigt (Hrdy 2009).
Tatsächlich gewähren Menschenmütter im Gegensatz zu Affenmüttern anderen Artgenossen bereitwillig Zugang zu ihrem Baby (Hrdy 2009). Denken Sie nur an das, was heute in vielen Kulturen geschieht, wenn ein neues Familienmitglied geboren wird: Alle kommen zu Besuch, und jeder will das Baby halten, vor allem Oma und Opa! Ich erinnere mich bis heute an das Lächeln auf dem Gesicht meiner Mutter, als sie meine neugeborene Tochter zum ersten Mal in den Armen hielt. Was für ein wunderbarer Moment, ein Neugeborenes auf dem Arm zu haben! Bei manchen Familienzusammenkünften wird das Baby so viel herumgereicht, dass die Mutter kaum Gelegenheit hat, es selbst zu halten, so schnell wandert es von einem eifrigen Verwandten zum nächsten. In manchen modernen Jäger-Sammler-Gesellschaften ist das Abgeben von Neugeborenen an andere Gruppenmitglieder sogar noch weiter verbreitet. Bei den Hadza z. B. werden Neugeborene in den ersten Tagen nach der Geburt 85 Prozent der Zeit von Alloeltern gehalten – Großmüttern, Großtanten, älteren Geschwistern oder Vätern. Efe- und Akafrauen geben ihr neugeborenes Kind in die Obhut weiblicher Verwandter und lassen sogar zu, dass diese es stillen, bis die Milch bei der Mutter selbst einschießt. Bei den Efe haben Neugeborene in den ersten Lebenstagen durchschnittlich 14 verschiedene Betreuer. Bei allen untersuchten Jäger-Sammler-Gesellschaften werden Babys vom Tag ihrer Geburt an von vielen anderen Gruppenmitgliedern gehalten, versorgt und ernährt. Diese Fürsorge wird wesentlich dazu beigetragen haben, dass Mütter ihre über viele Jahre abhängigen Kinder ernähren konnten, insbesondere nach der Entwöhnung (Hrdy 2009).
Die im Vergleich zu Menschenaffen weit größere Bereitschaft menschlicher Mütter, anderen die Sorge für ihre Neugeborenen anzuvertrauen, erklärt Sarah Hrdy mit dem Wissen der Mütter, bei der Aufzucht ihrer Kinder auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen zu sein:
„Das Wissen, dass sie beim Aufziehen ihrer Babys auf Hilfe angewiesen sind, macht menschliche Mütter kritischer gegenüber dem Neugeborenen. Mütter wissen auch, wie förderlich es für das Wohl eines Babys ist, in eine soziale Gemeinschaft eingeführt zu werden. Indem sie andere in die Betreuung ihres Babys einbeziehen, senden Mütter ein deutliches Signal, dass sowohl sie als auch ihr Nachwuchs auf die Unterstützung durch die Sippe zählen. Indem die Mutter Alloeltern dem Anblick, den Lauten und dem Geruch ihres verführerischen kleinen Schützlings aussetzt, legt sie die Grundlagen für emotionale Bindungen zwischen ihrem Baby und potentiellen Betreuern und umgekehrt. … Wenn Menschenmütter nach der Niederkunft eine größere Toleranz gegenüber anderen zeigen, dann bedeutet das zwangsläufig, dass sie stärker von den wohlmeinenden Absichten anderer überzeugt sind. Ihr Vertrauen ist so stark, dass es die zwanghafte Hypervigilanz, die man bei allen frischgebackenen Menschenaffenmüttern antrifft, überwindet.“ (Hrdy 2009; dt. 2010, S. 115)
Die Nähe zu Angehörigen, denen sie vertrauen konnten – der eigenen Mutter, Schwestern, Tanten usw. – könnte unseren frühen Vorfahrinnen das erforderliche Maß an Vertrauen und Sicherheit gegeben haben, um das Risiko einzugehen, auch andere Gruppenmitglieder für das eigene Baby sorgen zu lassen, und so dazu beigetragen haben, der Evolution der geteilten Fürsorge den Weg zu bahnen (Hrdy 2009).
2.2.2.5 Soziale Unterstützung und mütterliche Ambivalenz
Die Notwendigkeit, geeignete Helfer für die Aufzucht der Nachkommen zu finden, hatte unter anderem zur Folge, dass unsere Spezies im Laufe der Evolution besonders feine Antennen für das Vorhandensein oder Fehlen sozialer Unterstützung entwickelt hat. Im Pleistozän, dem Zeitabschnitt, in dem sich der in anatomischer Hinsicht moderne Mensch zu entwickeln begann, betrug die Säuglingssterblichkeit bis zu 50 Prozent. Eine Mutter wird damals fast sicher die Hilfe anderer benötigt haben, damit ihre Kinder überlebten. In unserer Evolutionsgeschichte musste eine schwangere Frau sich also die Frage stellen: Wer wird mir helfen, dieses Baby aufzuziehen? Die Fähigkeit einer Mutter, zutreffend einzuschätzen, wer für diese Aufgabe in Frage kam – und keine Gefahr für das Kind darstellte –, war stark selektionsbegünstigt (Hrdy 2009).
Allerdings hat unsere Empfänglichkeit für Signale sozialer Unterstützung, wie Hrdy betont, auch eine Schattenseite. Wenn eine Menschenmutter nämlich wahrnimmt, dass die Aussichten auf Hilfe bei der Aufzucht ihres Neugeborenen schlecht sind, kann dies ihre Bereitschaft, für ihr Kind zu sorgen, ernsthaft beeinträchtigen. Anders als unsere Menschenaffenverwandten zeichnen wir Menschenmütter uns daher durch eine hohe mütterliche Ambivalenz aus. Während es bei Menschenaffenmüttern praktisch keine Fälle von Vernachlässigung oder Kindstötung gibt, kommt dies bei Menschenmüttern durchaus vor, wenngleich selten. Meist ist dies der letzte Ausweg und ein sehr schmerzhafter Schritt für die Mutter.
Im Gegensatz zu Affenmüttern besitzt eine Menschenmutter die kognitive Fähigkeit, ihre Situation einzuschätzen und sich die Zukunft vorzustellen. Sie weiß, dass sie ihr Kind nicht ohne Unterstützung aufziehen kann. Ihre Ambivalenz entsteht aus der Notwendigkeit, die Überlebensaussichten ihres Kindes vor dem Hintergrund der voraussichtlich verfügbaren Hilfe zu beurteilen. Für eine Menschenaffenmutter ist die Wahrnehmung verfügbarer Unterstützung schlicht unwichtig. Weder ist sie auf gemeinsame Fürsorge angewiesen, noch würde sie ihr Junges anderen anvertrauen, weil die Risiken zu hoch wären. Aus diesen Gründen ist die wahrgenommene soziale Unterstützung extrem wichtig für das Engagement und die Fürsorgebereitschaft einer Menschenmutter (Hrdy 2009).
2.2.2.6 Schlussfolgerungen für heutige Eltern: soziale Unterstützung und mütterliche Ambivalenz
Was bedeutet all dies für heutige Mütter und Väter? Als Mütter haben wir im Laufe der Evolution ein feines Gespür für die Verfügbarkeit von Hilfe und Unterstützung bei der Sorge für unsere Kinder entwickelt. In gewisser Weise schätzen wir ständig ab, wer als Unterstützer in Frage kommt, ob unser Kind sicher und gut versorgt sein wird und wie wir bei Bedarf weitere Unterstützung mobilisieren können. Folglich überrascht es nicht, dass sowohl materielle als auch emotionale Unterstützung mit positivem mütterlichem Verhalten in Zusammenhang gebracht wurden (Konner 2010). Das Maß an wahrgenommener sozialer Unterstützung hat sich auch im Hinblick auf die Qualität der Mutter-Kind-Bindung als Einflussfaktor erwiesen, und zwar sowohl in Studien über westliche als auch in Untersuchungen nichtwestlicher Kulturen (Belsky 1999). In Anbetracht unserer Empfänglichkeit für Unterstützungssignale erscheint es logisch, dass wir, was die Bürde unserer Erziehungsaufgaben und unser mütterliches Engagement betrifft, Stress, Angstgefühle und vielleicht Ambivalenz entwickeln, wenn wir spüren, dass wir nicht genügend unterstützt werden. Möglicherweise vermitteln wir diese Gefühle auch unserem Kind, worunter wiederum unsere Bindungsbeziehung und andere Aspekte unseres Elternseins leiden können.
2.2.2.7 Wie kann Achtsamkeit helfen?
In unseren Mindful-Parenting-Gruppen ist soziale Unterstützung bei der Erziehung ein wichtiges Thema. Viele Mütter glauben, dass sie in der Lage sein sollten, mit den Anforderungen der Elternrolle fertigzuwerden, gleichgültig, wie viel Hilfe sie dabei bekommen und wie hoch ihre Belastung durch andere Aufgaben ist. So war Linda, die Mutter eines Säuglings und zwei weiterer Kleinkinder, enttäuscht von sich, weil sie es nicht schaffte, das Zusammensein mit ihren Kindern mehr zu genießen, und weil es sie so erschöpfte, für sie zu sorgen. Sie hatte ihre anspruchsvolle Berufstätigkeit wieder aufgenommen und glaubte, auch die damit verbundenen Anforderungen problemlos bewältigen zu müssen. Es fiel ihr schwer zu akzeptieren, dass das Muttersein manchmal sehr anstrengend war. Stattdessen sagte sie sich: „Es ist doch gar nicht so schlimm, ich werde schon damit fertig.“ Und doch war sie emotional erschöpft und unzufrieden mit sich. Diese Art der inneren Spaltung – einerseits zu denken: „Ich werde schon damit fertig“, aber sich andererseits überfordert, traurig, deprimiert oder schuldig zu fühlen – kommt in unseren Gruppen oft zur Sprache. Auf der Verstandesebene haben die betroffenen Mütter die Botschaft verinnerlicht, dass sie in der Lage sein sollten, sämtliche Anforderungen – der Kindeserziehung wie der Karriere – klaglos zu bewältigen. Doch ihr Körper und ihre Gefühle erzählen eine andere Geschichte und das hängt mit ihrem Gespür für die Notwendigkeit emotionaler und praktischer Unterstützung zusammen. Unserer Ansicht nach ist es kein Zeichen für eine Störung, wenn wir uns gestresst, müde, ängstlich, deprimiert oder ambivalent fühlen, sondern eher ein Zeichen dafür, dass wir mehr Aufmerksamkeit für unsere Situation und unsere Bedürfnisse entwickeln sollten. Deshalb ermutigen wir Eltern, sich nicht die Frage zu stellen „Was stimmt nicht mit mir?“ oder „Warum schaffe ich das nicht?“, sondern sich vielmehr zu fragen: „Was brauche ich jetzt, in diesem Moment? Welche Form der Unterstützung würde mir helfen?“
2.2.2.8 Was bedeutet das Prinzip der geteilten Fürsorge für eine moderne westliche Gesellschaft?
Welche Relevanz hat die in unserer evolutionären Geschichte verankerte kooperative Aufzucht für den Alltag heutiger Eltern, die meist getrennt von anderen Familienmitgliedern leben und nur begrenzte Möglichkeiten haben, die Last der Erziehung mit anderen zu teilen? Evolutionsgeschichtlich betrachtet haben Mütter immer nach Unterstützung bei der Aufzucht ihrer Kinder gesucht, doch heute ist es schwieriger geworden, solche Helfer zu finden. Unser westlicher Lebensstil hat dazu geführt, dass die Kindeserziehung viel stärker auf den Schultern der Eltern lastet. Selbstverständliche Entlastung bei der Kinderbetreuung durch Familienangehörige oder Wahlverwandte ist selten (obwohl es mich beeindruckt, wie viele meiner Freundinnen versuchen, in die Nähe ihrer Mütter zu ziehen, sobald sie Kinder haben). Doch für die meisten von uns, die ihre Kinder in einem westlichen Land und weit entfernt von der eigenen Familie aufziehen, hat bezahlte und/oder institutionalisierte Hilfe – Babysitter, Tagesmütter, Kindertagesstätten, Schulen und Horte – die Unterstützung durch Verwandte ersetzt. Eine der damit verbundenen praktischen Fragen ist, wie sich die Verfügbarkeit und Qualität der Kinderbetreuung gewährleisten lässt, die eher in der Verantwortung von Politikern und kommunalen Behörden liegt. In der Geschichte unserer Evolution haben Mütter versucht, die bestmögliche Pflege und Betreuung für ihre Kinder sicherzustellen, indem sie Väter und andere vertrauenswürdige nahe Verwandte wie Großmütter, Tanten und ältere Geschwister dafür gewannen. Sie konnten außerdem darauf zählen, dass diese Familienmitglieder motiviert waren, in die Fürsorge für ihre Kinder zu investieren. Heute haben Eltern oft wenig Wahlmöglichkeiten und Kontrolle darüber, wer ihre Kinder umsorgt. Obwohl z. B. ein Zusammenhang zwischen der Sensitivität der betreuenden Personen und der Bindungsfähigkeit der Kinder festgestellt wurde (s. z. B. NICHD Early Child Care Research Network 2003) , haben viele Eltern – insbesondere Eltern mit geringem Einkommen – keinen Zugang zu guter Kinderbetreuung. Hinzu kommt, dass nichtverwandte Personen vermutlich nicht im gleichen Maße motiviert sind, in ein Kind zu investieren, wie nahe Verwandte. Mütter erzählen häufig, dass sie sich in Bezug auf die Betreuungslösung, die sie für ihre Kinder gewählt haben, Sorgen machen oder Schuldgefühle haben, doch das ist keineswegs ein neues Problem! Schon immer waren wir auf zuverlässige Helfer angewiesen, um unsere Kinder aufzuziehen.
Ein interessantes Phänomen ist die Entwicklung verwandtschaftsähnlicher Beziehungen. Wenn Eltern keine biologischen Verwandten in der Nähe haben, versuchen sie häufig, ein Netz verwandtschaftsähnlicher Beziehungen zu knüpfen, die vielfach dieselben Funktionen erfüllen, wie soziale Unterstützung und geteilte Fürsorge (Bailey & Wood 1998). Davon zu lesen faszinierte mich, denn auch ich hatte mir, ohne mir dessen bewusst zu sein, mein eigenes Ersatzfamilien-Unterstützungssystem geschaffen, als meine Kinder klein waren und wir weit entfernt von nahen Angehörigen in New York City lebten. Brooklyn war (und ist bis heute) ein Paradies für junge Eltern. Die Wohnungen sind winzig und frischgebackene Eltern halten sich gerne draußen auf, um ihren engen Wohnzimmern zu entkommen und auf einem der Spielplätze andere Eltern zu treffen. Was uns an Wohnraum fehlte – wir lebten auf rund 80 Quadratmetern im dritten Stock ohne Fahrstuhl und Garten – wurde mehr als wettgemacht durch diese Gemeinschaft, die direkt vor der Haustür auf uns wartete. Überall sah man Gruppen junger Mütter, die sich auf Parkbänken und in Starbucks-Cafés versammelten, ihre kleinen Kinder im Schlepptau oder im Tragesitz. Schon bald hatte ich eine Schar neuer Freundinnen, allesamt frischgebackene Mütter, deren Kinder nur ein paar Wochen vor oder nach meinem eigenen geboren waren. Diese Mütter unterstützten einander sowohl emotional – durch ein aufmunterndes Schulterklopfen, wenn man sich erschöpft, inkompetent, ängstlich oder unsicher fühlte – als auch praktisch, indem sie einem das Baby für ein paar Minuten abnahmen, damit man zur Toilette gehen konnte, und sich später, falls nötig, auch mal einen ganzen Vormittag lang um die Kinder der anderen kümmerten. Das war für jede von uns wie ein warmes Bad und die Tatsache, dass viele von uns erst kurze Zeit in New York lebten und keine Angehörigen in greifbarer Nähe hatten, half uns dabei, Beziehungen untereinander aufzubauen, als wären wir eine Familie. Wenn ich daran zurückdenke, verblüfft mich die Erkenntnis, wie gut die neuen, familienähnlichen Beziehungen zwischen Eltern in die lange evolutionäre Geschichte der gemeinsamen Fürsorge passen.
2.2.2.9 Und was ist mit den Vätern?
Mittlerweile dürften sich viele Leser – insbesondere die Väter – fragen, welche Rolle die Väter bei all dem spielen. Michael Lamb hat sich jahrzehntelang wissenschaftlich mit der Bedeutung von Vätern für die kindliche Entwicklung befasst und die positiven Wirkungen von Vätern auf die soziale und emotionale Entwicklung sowie die Bildungsbiografie von Kindern dokumentiert (Lamb & Tamis-Lemonda 2004). Aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive betrachtet, zeigt sich jedoch, dass Väter für das Überleben von Kindern nicht immer notwendig waren und dass das Ausmaß ihrer Beteiligung an der Kinderaufzucht höchst unterschiedlich ausfiel. In einigen Jäger-Sammler-Gesellschaften konnte die Beteiligung der Väter z. B. nicht mit einer höheren Überlebensrate der Kinder assoziiert werden (Marlowe 2000). Wie lässt sich das erklären?
In der Fachliteratur zur Beteiligung der Väter taucht überall der Schlüsselbegriff Variabilität auf. Verglichen mit den meisten anderen Säugetier- und Primatenspezies, beteiligen sich Menschenväter deutlich stärker an der Aufzucht des Nachwuchses (Konner 2010). Ungeachtet dessen weist die väterliche Teilnahme am Leben der Kinder in der Evolutionsgeschichte wie auch in modernen industrialisierten und nichtindustrialisierten Gesellschaften schon immer eine große Schwankungsbreite auf, die von keinerlei Beteiligung ab dem Zeitpunkt der Befruchtung bis zu dem ausgeprägten Engagement von Aka-Pygmäen-Vätern (Hewlett 2004) und den Vollzeit-Vätern und -Hausmännern in unserer Kultur reicht. Die Geschichte der menschlichen Evolution hat uns gelehrt, dass die Beteiligung der Väter an der Aufzucht der Kinder zwar die Überlebenschancen der Kinder häufig erhöhte, aber nicht immer gegeben war. Deshalb mussten clevere Mütter sich nach zusätzlicher Unterstützung umsehen. Die Flexibilität, die Mütter bei dieser Suche bewiesen, war vielleicht eines der stärksten Selektionsmerkmale in Bezug auf die erfolgreiche Aufzucht des Nachwuchses. Das heißt nicht, dass Mütter auf die Einbeziehung der Väter verzichten wollten oder konnten. Im Gegenteil: Menschenmütter haben alle möglichen Wege gefunden, um Väter in die Kinderaufzucht einzubeziehen (Hrdy 1999). Doch falls die Väter nicht verfügbar waren, halfen Flexibilität und Findigkeit den Müttern bei der Suche nach anderen vertrauenswürdigen Helfern: Großmütter, ältere Geschwister, Tanten, sogar nichtverwandte Mitglieder der Gruppe (Hrdy 2009). Dieser Punkt ist bis heute wichtig, denn wie gut die Absichten aller Beteiligten auch sein mögen: Beziehungen enden, Ehen zerbrechen, und es gibt keine Garantie dafür, dass ein Kind während seiner gesamten Kindheit und Jugend einen engagierten Vater – oder überhaupt einen Vater – in seiner Nähe haben wird.
Welche Faktoren führen dazu, dass Väter sich intensiver um ihre Kinder kümmern? Der Anthropologe Barry Hewlett, der die Vater-Kind-Beziehungen in Jäger-Sammler-Gesellschaften erforscht, vertritt die Auffassung, dass räumliche Nähe Impulse der Fürsorge und Liebe bei Vätern fördert. Hewlett hat unter den Aka-Pygmäen gelebt, einer Wildbeutergesellschaft, die den höchsten Grad an väterlicher Beteiligung aufweist, der je in einer Gesellschaft festgestellt wurde. Er beobachtete, dass Aka-Väter sich häufig in unmittelbarer Nähe ihrer Kinder aufhielten und diese häufiger küssten oder umarmten als Aka-Mütter. Und während Vater-Kind-Interaktionen in urbanen industrialisierten Gesellschaften vor allem von Kampf- und Tobespielen geprägt sind, spielten die Aka-Väter seltener in einer derart kraftbetonten, stark stimulierenden Weise mit ihren Kindern. Diese Unterschiede zwischen Aka- und westlichen Vätern erklärt Hewlett damit, dass Aka-Väter ihre Kinder durch die größere physische Nähe sehr genau kennen und deren Signale leichter deuten könnten (Hewlett 2004). Dies ermögliche es ihnen, auf eine ruhigere Weise mit ihren Kindern zu interagieren, statt auf kraft- und körperbetonte Spiele zurückzugreifen:
„Aka-Väter interagierten weniger kraftvoll, weil sie ihre Kinder durch ihr starkes Engagement bei der Kinderbetreuung genau kannten. Weil sie ihre Kinder so gut kannten, benötigten sie keine kraftbetonten Spiele zur Initialisierung von Kommunikation oder anderen Interaktionen mit ihnen. Sie hatten andere Wege, um mit ihren Kindern zu kommunizieren oder ihre Zuneigung auszudrücken. Häufig wurden Kommunikationsprozesse von den Kindern selbst initiiert, und die Aka-Väter wussten die verbalen und nonverbalen (z. B. durch Berührung) Signale ihrer Kinder zu deuten. Väter (oder Mütter), die einen weniger nahen Kontakt zu ihren Kindern haben, sind häufig weniger gut in der Lage, die Signale ihrer Kinder zu lesen und zu verstehen, und initiieren daher mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst Kommunikationsvorgänge, oft durch körperliche Stimulation und körperbetonte Spiele.“ (Hewlett 2004, S. 189)
Hewlett stellte außerdem fest, dass bei den Aka Mütter, Väter und Kinder an der Netzjagd teilnehmen. Durch die gemeinsame Jagd bleiben Aka-Väter in engem Kontakt mit ihren Kindern, was erklären könnte, warum sie ihren Nachwuchs so gut kennen (Hewlett 2004). Auch Sarah Hrdy betont die Bedeutung von physischer Nähe und Erfahrung als Auslöser väterlicher Fürsorgeimpulse. Wenn Väter Gelegenheit haben, nah bei ihren Kindern zu sein, und unmittelbar in deren Betreuung einbezogen werden, können sie starke väterliche Gefühle und eine intensive Bindung entwickeln. Einige Untersuchungen zeigen, dass sich der männliche Hormonhaushalt durch die Anwesenheit von schwangeren Frauen und Babys verändert (Konner 2010). Hrdy glaubt, dass väterliche Fürsorge, auch wenn ihr Ausmaß in der Geschichte der Evolution stark schwankt, vermutlich schon im Pleistozän existierte (Hrdy 2009).
Die These, dass körperliche Nähe eine enge Vater-Kind-Beziehung fördert, erinnerte mich an die Zeit, als mein Mann sich um unsere neugeborene Tochter kümmerte. Er hatte einen Job mit flexiblen Arbeitszeiten und war deshalb jeden Donnerstag allein für unsere Tochter verantwortlich. An diesem Tag hatte ich außer Reichweite zu sein, damit er die einzige Bezugsperson sein konnte, ohne dass ich mich einmischte. Diese gemeinsame Zeit war entscheidend für den Aufbau ihrer Bindung, denn ich war weder zum Stillen noch zum Trösten verfügbar. Stattdessen gab mein Mann unserer Tochter abgepumpte Muttermilch zu trinken, wechselte ihr die Windeln, tröstete sie, legte sie schlafen und tat alles, was sonst noch zu tun war. An diesen Donnertagen suchte er die Nähe anderer Väter, die ihre Kinder schaukelten oder sich – meist getrennt von den Müttern – auf den Spielplätzen aufhielten. Ziemlich schnell hatte er erst einen, dann zwei, dann drei andere Väter mit flexiblen Arbeitszeiten gefunden, die ebenfalls kleine Töchter hatten. Bald trafen sie sich jeden Donnerstag auch ohne feste Verabredung, und oft lasen sie weitere zukünftige Mitglieder ihrer Gruppe im Park auf. Es dauerte nicht lange, und die Vätergruppe hatte acht bis zehn regelmäßige Teilnehmer, die sich gemeinsam um ihre Babys kümmerten, mit ihnen spielten und sich zum Frühstück in einem nahe gelegenen Café trafen, wo das typischerweise junge und weibliche Personal sie vor lauter Entzücken über den Anblick von acht Kerlen mit acht winzigen Töchtern in Tragesitzen und Buggys mit größter Zuvorkommenheit zu bedienen pflegte. Was mir heute an dieser Zeit, die mein Mann allein mit unserer Tochter verbrachte, bemerkenswert erscheint, ist nicht nur die Nähe zwischen ihnen, sondern auch die Tatsache, dass er an diesen Tagen wirklich allein für sie verantwortlich war. Genau wie ich musste er lernen, ihre Signale zu deuten, musste herausfinden, wie er sie zum Einschlafen bringen konnte, wann sie hungrig war, eine frische Windel brauchte usw. So entwickelte er die Zuversicht, dass er dazu ebenso gut in der Lage war wie ich.
2.2.2.10 .Vor welchen Herausforderungen stehen moderne Väter?
In mancher Hinsicht waren die Erwartungen an Väter noch nie so groß wie heute. In postindustriellen Gesellschaften werden der Erfolg eines Vaters und der soziale Status seiner Familie vor allem mit ökonomischen Maßstäben gemessen. Gleichzeitig erwartet man von Männern, dass sie sich stärker als je zuvor an der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder beteiligen, Windeln wechseln, den Abwasch erledigen und sich als einfühlsame Väter zeigen – und außerdem nach wie vor ihren finanziellen Verpflichtungen als Ernährer nachkommen (Lamb & Tamis-Lemonda 2004). Diese Erwartungen können miteinander in Konflikt geraten. Oft würden Väter tatsächlich gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, doch der Druck, finanziell für die Familie sorgen zu müssen, erweist sich häufig als größer.
Eine zweite Herausforderung resultiert daraus, dass Männer extrem unterschiedliche Erfahrungen mit ihren eigenen Vätern in die Vaterschaft einbringen. Das Spektrum reicht von Männern, die ihren Vater nie kennengelernt haben, bis zu Männern, die in einer engen Beziehung zu einem fürsorglichen und emotional präsenten Vater aufgewachsen sind. Manche Väter beschreiben ihre Vaterbeziehung so: „Mein Vater wusste nicht, wie er einen emotionalen Zugang zu mir finden sollte. Er arbeitete hart, er bezahlte die Rechnungen, doch wenn ich jemanden brauchte, wandte ich mich an meine Mutter. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, meinen Kindern der Vater zu sein, der ich sein will.“
2.2.2.11 Achtsam Vater sein: Wie kann Achtsamkeit helfen?
Häufig äußern Väter uns gegenüber, dass sie sich sehnlichst wünschen, sie wären fähig gewesen, eine Beziehung zu ihrem Vater aufzubauen, oder dass sie für ihre eigenen Kinder so gerne emotional präsent wären. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg, der Vater zu werden, der sie sein wollen. Denn wenn sie sich der emotionalen Auswirkungen ihrer eigenen Kindheitserfahrungen bewusst werden, können Väter diese Erfahrungen in ein kohärentes Bild von sich selbst integrieren. Außerdem können Väter auf Beziehungen zu anderen Vaterfiguren zurückgreifen, die in emotionaler Hinsicht vielleicht mehr für sie da waren – ein Onkel, ein Lehrer, der Stiefvater usw. Und Väter, die eine enge Beziehung zu ihrer Mutter oder einer anderen weiblichen Bezugsperson hatten, können sich an dieser Erfahrung orientieren. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Väterforschung ist, dass die Eigenschaften eines Vaters und seine Beziehung zu seinem Kind eine größere Rolle spielen als das Geschlecht. Qualitäten wie väterliche Wärme und Nähe sind für Kinder ebenso wichtig wie mütterliche Wärme und Nähe (Lamb & Tamis-Lemonda 2004). Bindungsforscher haben außerdem gezeigt, dass die Existenz mehrerer sicherer Bindungen für die kindliche Entwicklung optimal ist – auch deshalb ist eine sichere Vater-Kind-Beziehung für Kinder von Vorteil (van IJzendoorn et al. 1992).
Väter können nicht nur wie Mütter Wärme und Nähe spenden, sie können auch andere, nichtmütterliche Verhaltensweisen zeigen, die eine wichtige Funktion in der Erziehung haben. Einige Forscher vermuten, dass die bei Vätern häufigeren Kampf- und Tobespiele und die größere Neigung von Vätern, ihre Kinder herauszufordern und mit ihnen zu wetteifern, dazu beitragen könnten, Kinder „abzuhärten“ und auf die Auseinandersetzung mit der Außenwelt vorzubereiten (Lamb 2004; Paquette 2004). Bögels und Kollegen nehmen an, dass die evolutionsbedingt größere Erfahrung im Umgang mit bestimmten Herausforderungen der Außenwelt und im Eingehen von Risiken Väter in besonderer Weise befähigt, ihren Kindern bei der Überwindung von Ängsten und der Entwicklung von Zuversicht zu helfen (Bögels & Perotti 2011; Bögels & Phares 2008; Möller et al. 2013).
Wie also lautet unsere Botschaft an die Väter? Was die Forschung betrifft, ist die Botschaft klar: Als Vater können Sie im Leben Ihrer Kinder eine entscheidende Rolle spielen. Doch die wichtigste Botschaft besteht möglicherweise in der Frage: „Was hätten Sie sich von Ihrem Vater gewünscht, und was hätten Sie von ihm gebraucht?“ oder „Was hat Ihnen Ihr Vater mitgegeben, das wichtig für Sie war?“ und, am allerwichtigsten: „Was wollen Sie Ihren eigenen Kindern mitgeben?“ Indem Väter sich mit ihren eigenen Erfahrungen verbinden, können sie die Bedeutung und das Gewicht ihrer Rolle im Leben ihrer Kinder spüren.
2.2.3 Die Evolution unserer Affektregulationssysteme: Bedrohung, Antrieb, Besänftigung
Ein weiterer Grund für den Stress, den Eltern heute so oft erleben, liegt darin, dass unser Gehirn und unser Hormonsystem, die für viele unserer automatischen und emotionalen Reaktionen verantwortlich sind, sich vor langer Zeit und unter völlig anderen Umweltbedingungen und Bedrohungen herausbildeten. Der anatomisch moderne Mensch entwickelte sich vor etwa 10.000 bis 100.000 Jahren. Seitdem haben sich das Leben, das wir führen, unsere Umwelt und die Gefahren für unser Überleben dramatisch verändert (Konner 2010). Eines der Ziele der Achtsamkeitspraxis besteht darin, automatische Reaktionen in Erziehungs-situationen durch nichtreaktives Gewahrsein zu ersetzen. Dennoch ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass die biologischen Systeme, die sich im Dienste unserer Gefühls- und Verhaltensreaktionen entwickelt haben, auf automatisches Reagieren eingerichtet sind, und diese Reaktionen können durch Situationen ausgelöst – oder „getriggert“ – werden, die sich stark von den Situationen unterscheiden, mit denen unsere Vorfahren konfrontiert waren. Deshalb ist konsequentes und bewusstes Bemühen erforderlich, wenn wir lernen wollen, anders auf eine Situation zu antworten. Ebenso folgt daraus, dass wir für unsere Reaktivität nicht gänzlich verantwortlich gemacht werden können.
Paul Gilberts Modell der drei Affektregulationssysteme – das Bedrohungs- und Selbstschutzsystem, das anreiz- und belohnungssuchende Antriebserregungssystem und das Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem – ermöglicht es uns, unsere automatischen elterlichen Reaktionen in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Gilbert beschreibt, wie sich diese drei Systeme gemeinsam entwickelten, um das menschliche Gefühlsleben und Verhalten zu regulieren. Das Antriebserregungssystem motiviert uns, nach Belohnungen, Ressourcen, Partnern und Erfolgen zu streben, und ist mit Lustgefühlen verbunden. Doch bei vielen von uns ist dieses System überaktiv. Ständig wollen wir etwas tun, haben und erreichen, und wenn wir einmal nichts tun, fühlen wir uns leer und erschöpft oder verurteilen uns selbst. Unser Bedrohungsund Selbstschutzsystem ist ebenfalls überaktiv, wird heute allerdings eher durch zwischenmenschliche Konflikte ausgelöst als durch echte Bedrohungen für Leib und Leben. Gilbert zufolge interagiert unser Antriebserregungssystem mit unserem Bedrohungs- und Selbstschutzsystem. So streben wir vielleicht nach Erfolgen und Zielen, um Unterlegenheitsgefühle oder Ablehnung durch andere zu vermeiden, oder wir glauben, dass wir etwas Bestimmtes tun „sollten“, um zu vermeiden, dass wir Scham oder Schuldgefühle empfinden oder uns schlecht fühlen. Das dritte System in diesem Modell, das der Besänftigung und Zufriedenheit, hat sich aus dem Bindungssystem entwickelt. Während das Antriebserregungssystem mit aufgeladenen, aufgeregten, lustvollen Gefühlen assoziiert ist, ist das Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem durch Gefühle der Ruhe, Zufriedenheit, Friedlichkeit und Sicherheit gekennzeichnet (Gilbert 2009). Oxytozin, ein Hormon, das während des Stillens, beim Liebesakt und anderen Bindungserfahrungen ausgeschüttet wird, ist mit diesem System assoziiert. Oxytozin ist auch an der Beruhigung des autonomen Nervensystems nach einer mit Stress verbundenen Erfahrung beteiligt und hilft uns, in Stressphasen enge emotionale Bindungen aufzubauen (Carter 1998). Durch unseren modernen Lebensstil wird dieses System oft unzureichend stimuliert.
2.2.3.1 Schlussfolgerungen für heutige Eltern
Wie Gilbert hervorhebt, haben sich diese Systeme entwickelt, um uns beim Überleben zu helfen, und wir brauchen alle drei noch immer. Doch wenn diese Systeme aus dem Gleichgewicht geraten, leiden wir. Wenn unser Antriebserregungssystem zu stark wird, sind wir zu oft im Aktions-Modus; wenn unser Bedrohungs- und Selbstschutzsystem überaktiv ist, sind unsere Reaktionen von Angst und Feindseligkeit geprägt. Unser Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem, das unser Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen unterstützt und uns dazu befähigt, uns ruhig, zufrieden und getröstet zu fühlen, ist in westlichen Industriegesellschaften häufig unterrepräsentiert (Gilbert 2009). Dies kann dazu führen, dass wir uns von unserem Leistungsstreben und unseren automatischen Stressreaktionen getrieben fühlen. Doch die Forschung liefert immer mehr Hinweise darauf, dass sichere Bindungen nicht nur psychologische Gewinne wie Gefühle der Sicherheit und des Vertrauens mit sich bringen, sondern auch in physiologischer und neurochemischer Hinsicht von Vorteil sind (Carter 1998).
2.2.3.2 Wie kann Achtsamkeit helfen?
Die Achtsamkeitspraxis zielt nicht auf die Beseitigung eines dieser Systeme ab, sondern auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen ihnen. Durch Achtsamkeit lernen wir, unserer Erfahrung gewahr zu sein, zu bemerken, dass wir im Aktions-Modus sind oder dass wir furchtsam und feindselig reagieren. Wir lernen, diese Erfahrungen als Teil unserer menschlichen Natur zu akzeptieren, statt sie abzulehnen oder uns selbst für solche Reaktionen zu kritisieren. Wir können mitfühlender mit uns umgehen, wenn wir unsere Reaktionen im Kontext unseres evolutionären Erbes sehen können. Wir können die Absicht entwickeln, anders auf unsere automatischen Reaktionen zu antworten, indem wir innehalten und den Dingen einfach erlauben, so zu sein, wie sie sind.
Mit Hilfe der Achtsamkeitspraxis schalten wir vom Aktions-Modus in den Seins-Modus und dämpfen so die hektische Aktivität unseres Antriebserregungssystems und unseres Bedrohungs- und Selbstschutzsystems. Wir stärken außerdem unser natürliches Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem, um die negativen Auswirkungen der beiden anderen Systeme zu reduzieren und mehr positive Gefühle der Ruhe und Zufriedenheit zu erleben. Wenn wir z. B. einfach Zeit mit unseren Kindern verbringen und mit unserer ganzen Aufmerksamkeit präsent sind, statt das Gefühl zu haben, etwas erreichen zu müssen, kann uns das helfen, unser Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem zu aktivieren und eine stärkere Bindung an unsere Kinder zu entwickeln. Auch Meditationspraktiken zur Kultivierung von Mitgefühl stärken dieses System, dämpfen die Aktivität des Bedrohungs- und Selbstschutzsystems und führen zu mehr Gleichgewicht. Es gibt immer mehr Forschungsresultate, die belegen, dass Achtsamkeits- und Mitgefühlsmeditation Veränderungen der Gehirnaktivität bewirken, die mit positiven emotionalen Zuständen assoziiert sind (Davidson & Begley 2012).
2.2.2.3 Reaktives Elternverhalten aus evolutionsbiologischer Perspektive: unser Bedrohungs- und Selbstschutzsystem
Aus unserer eigenen Erfahrung als Eltern und aus unseren Elterngruppen wissen wir, dass wir besonders gegenüber unseren Kindern und unseren Partnern zu starken, manchmal sogar explosiven emotionalen Reaktionen neigen. Warum sollten wir uns zu einer Spezies entwickelt haben, die mit höherer Wahrscheinlichkeit genau in den Situationen „ausrastet“, in denen dies am meisten Schaden anrichten kann – im Zusammensein mit unseren Kindern oder anderen Menschen, die wir lieben? Aus der Perspektive der Evolution betrachtet, könnte sich elterliche Reaktivität deshalb entwickelt haben, weil sie höhere kortikale Funktionen gewissermaßen kurzschließt und so kostbare Sekunden spart, die in Situationen, in denen es für unsere Vorfahren um Leben und Tod ging, entscheidend sein konnten. Bei drohender Gefahr dürfte sofortiges Reagieren ohne Nachdenken die Strategie gewesen sein, die am erfolgreichsten war und deshalb mit der Zeit selektiert wurde.
Wenn wir Angst vom evolutionsbiologischen Standpunkt aus betrachten, wird schnell begreiflich, dass reaktives, ängstliches oder überbehütendes Elternverhalten unseren Vorfahren im Pleistozän geholfen hat zu überleben. Wie Joseph LeDoux Forschung zu den Gehirnmechanismen, die der Angst zugrunde liegen, zeigen, haben wir uns zu wirklich guten Gefahrendetektoren entwickelt. Einfach ausgedrückt: In der Umwelt unserer Vorfahren war es durchaus von Vorteil, ein bisschen paranoid zu sein. Individuen, die über ein Gehirn verfügten, das potentielle Gefahren rasch identifizieren und automatisch auf sie reagieren konnte, hatten bessere Chancen, zu überleben und Nachkommen zu zeugen. LeDoux verdeutlicht dies am Beispiel eines Wanderers, der einen auf dem Weg liegenden Stock für eine Schlange hält und automatisch reagiert, indem er zur Seite springt. Diese sogenannte „Low-Road“-Reaktion – eine schnelle, automatische Reaktion auf wahrgenommene Gefahr, die unter Umgehung höherer kortikaler Funktionen direkt vom limbischen System ausgelöst wird – war zu einer Zeit, in der wir unter Raubtieren lebten, sicherlich vorteilhaft. Unser moderner Wanderer wird nach seiner anfänglichen Schockreaktion sicher ein bisschen verlegen über seine Fehlinterpretation lachen, doch unseren Vorfahren verschaffte die Fähigkeit, bei Gefahr sofort zu handeln und später zu denken, einen wichtigen Vorteil im Überlebenskampf (LeDoux 1996). „Vorsicht ist besser als Nachsicht“, nennt Paul Gilbert diese Arbeitsweise unseres Gehirns, die dazu führen kann, dass wir eine Gefahr falsch einschätzen (P. Gilbert, persönl. Kommunikation, 23. Juni 2012). Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie verletzlich und gefährdet Säuglinge und Kinder sind, wird uns klar, dass eine Mutter, die sich „überbehütend“ und „ängstlich“ verhielt, mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebende Nachkommen hatte, die genau diese Merkmale dann weitergaben.
2.2.3.4 Schlussfolgerungen für heutige Eltern
Wieder resultiert das Problem aus der Tatsache, dass sich die Welt, in der wir leben, seit dem Pleistozän radikal verändert hat, ohne dass unser Affektregulationssystem mit dieser Entwicklung hätte Schritt halten können. Es ist immer noch auf „höchste Alarmstufe“ eingestellt, obwohl direkte Gefahr für Leib und Leben nicht länger die größte Bedrohung für unser Überleben darstellt. Als Eltern verfügen wir über hoch entwickelte Fürsorge- und Schutzimpulse in Bezug auf unsere Kinder, was in einer echten Gefahrensituation immer noch sehr nützlich sein kann. Wenn mein kleiner Sohn auf die Straße rannte, ohne auf den Verkehr zu achten, war meine automatische Reaktion – hinterherzulaufen, „Bleib stehen!“ zu schreien und ihn zu packen – sicherlich seinem Überleben dienlich. Doch wir verdanken auch einige der schlimmsten Momente in unserem Dasein als Eltern unseren automatischen Reaktionen, wenn wir eine Gefahr für uns oder unsere Kinder wittern. Wenn wir gestresst sind, neigen wir zu emotionalen Überreaktionen, und wenn wir Angst haben, zu Überbehütung.
Heute sind die Auslöser, die dafür sorgen, dass wir uns bedroht fühlen, eher sozialer Art: Da genügt es, wenn unser Kind nicht zu einer Geburtstagsparty eingeladen wird, oder wenn wir bei einer anstehenden Beförderung übergangen werden. Es faszinierte mich, bei Sarah Hrdy zu lesen, dass ranghohe Pavianmütter ihren sozialen Status auf ihre Töchter übertragen, wodurch sich deren Fortpflanzungserfolg und die Überlebensrate ihrer Nachkommen erhöhen (Hrdy 1999). Danach verstand ich besser, warum ich mich manchmal in meine eigene Schulzeit zurückversetzt fühle, wenn ich meine Kinder von der Schule abhole. Ich ertappe mich dann nicht nur dabei, dass ich das Geschehen auf dem Schulhof beobachte, um einzuschätzen, welche Kinder „in“ oder „out“ sind, ich stelle auch fest, dass die anderen Mütter genau dasselbe tun! Während uns heute die Sorgen einer Mutter um ihren sozialen Status oder den ihres Kindes pathologisch erscheinen mögen, könnten sie in der Welt unserer Vorfahren entscheidend für das Überleben ihrer Kinder gewesen sein.
2.2.3.5 Wie kann Achtsamkeit helfen?
Aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive betrachtet, sind die Ängste, die wir als Eltern haben, und unsere automatischen Reaktionen keineswegs anormal oder pathologisch (S. Hrdy, persönl. Kommunikation, 1. Juli 2012), sondern Teil unseres evolutionären Erbes, ebenso wie der aufrechte Gang und die Sprache. Diese Perspektive kann uns helfen, eine größere Akzeptanz für unsere menschliche Natur zu entwickeln. Die Achtsamkeitspraxis bietet uns die Möglichkeit, mit zunehmendem Gewahrsein unsere automatischen Reaktionen gewissermaßen abzubremsen, indem wir auf das achten, was unser Körper uns sagt, und einen Moment innehalten, bevor wir unseren gewohnten automatischen Reaktionen erlauben, abzulaufen. Wir können bewusst entscheiden, wie wir reagieren wollen, oder die Entscheidung treffen, nicht zu reagieren.
2.3 Bindung aus evolutionärer Perspektive
Unser Bindungssystem hat sich als vorteilhaft für unser Überleben und unsere Fortpflanzungschancen erwiesen. John Bowlby definierte Bindung als „die Neigung menschlicher Wesen, starke emotionale Bande zu bestimmten anderen Menschen zu knüpfen“ (Bowlby 1977, S. 201). Auch wenn Bindungsverhalten bei den meisten Säugetieren auftritt, ist es angesichts der langen Abhängigkeit des Nachwuchses für uns Menschen überlebenswichtig. Insbesondere der kindliche Drang, vor allem in Gefahrensituationen die Nähe der Mutter zu suchen, hatte für unsere Vorfahren klare Überlebensvorteile. Bindungsverhalten wird durch Bedrohungsoder Stresssituationen getriggert: Wenn eine Mutter oder ein Kleinkind sich bedroht fühlten, war die Suche nach der Nähe anderer oft die beste Überlebensstrategie. Bowlby sah im kindlichen Bindungsverhalten eine normale, evolutionär adaptive Reaktion auf die Trennung von der Mutter oder die Bedrohung durch Raubfeinde. Ein Kind, das schreit, wenn es von seiner Mutter getrennt wird, oder Angst vor lauten Geräuschen oder der Dunkelheit hat, verhält sich nicht pathologisch, da Trennungssituationen und laute Geräusche in unserer evolutionären Vergangenheit Gefahrensignale waren. Es ist ganz natürlich, dass ein Kind, das Kummer hat, die Nähe seiner Mutter sucht. Wenn diese es getröstet hat, kann das Kind sich wieder lösen und seine Umwelt erforschen (Bowlby 1971, 1977). Kinder, die nach einer kurzen Trennung von Mutter oder Vater dazu in der Lage sind, gelten als „sicher gebunden“ und zeigen eine bessere soziale, emotionale und kognitive Entwicklung als unsicher gebundene Kinder (Bretherton 1992). Wenn eine Mutter einfühlsam auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingeht – z. B. Schutz und Trost bietet, wenn es ängstlich ist –, fühlt es sich bestärkt und erfährt auch die Beziehung zur Mutter als sicher. Es lernt außerdem, dass es sich bei Angst oder Verzweiflung an seine Mutter wenden kann (Stams et al. 2002).
Bindungsverhalten hat sich auch deshalb entwickelt, weil es die mütterliche Bereitschaft zum Teilen von Ressourcen mit ihrem Kind sicherzustellen half (Hrdy 2009). Wie wir gesehen haben, ist diese Bereitschaft bei Menschenmüttern nicht zwangsläufig vorhanden. Schon vor der Geburt ihres Kindes hat das Bindungssystem einer Mutter vielfältige hormonelle und biochemische Veränderungen durchlaufen, die ihre Investitionsbereitschaft, ihre Fürsorge und Liebe für ihr Kind fördern. Nach der Geburt triggert auch das kindliche Verhalten das Bindungssystem der Mutter. So führt beispielsweise das Saugen an der mütterlichen Brust zur Freisetzung von Oxytozin im Körper der Mutter und bewirkt so Gefühle der Entspannung und Ruhe, reduziert Angst und fördert die Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung (Carter 1998). Bei Vätern kommt es als Reaktion auf die Geburt ihres Kindes zu ähnlichen, wenngleich weniger starken hormonellen Veränderungen (Carter 2006).
2.3.1 Die neuroendokrinen Grundlagen der Bindung
Unser Bindungssystem und die ihm zugrunde liegenden neuroendokrinen Prozesse sorgen mit dafür, dass wir uns in unser Baby verlieben. Sie motivieren uns, für es zu sorgen, und bewirken, dass wir uns glücklich, sicher und ruhig fühlen, wenn wir eine Bindung zu ihm aufbauen. Oxytozin, das Neuropeptid, das mit diesem System assoziiert ist, ist gewissermaßen der Liebestrank von Mutter Natur, und er kostet keinen Cent, ist hundertprozentig naturbelassen und hat keinerlei negative Nebenwirkungen (abgesehen von einer Verminderung der Produktivität – S. unten)! Die Ausschüttung von Oxytozin regt die Wehentätigkeit an, reduziert den Geburtsstress und fördert Gefühle von Ruhe und Entspannung nach der Geburt. Oxytozin unterstützt auch das Bonding zwischen Mutter und Kind: Es stimuliert den Milchflussreflex der stillenden Mutter und sorgt dafür, dass sie sich nach dem Stillen ruhig und entspannt fühlt. Oxytozin dämpft außerdem unsere Reaktion auf Stressreize, z. B., indem es die Reaktivität des autonomen Nervensystems reduziert, die mit Stressreaktionen wie erhöhter Herzfrequenz und steigendem Blutdruck verbunden ist. Nach einem Stresserlebnis sorgt Oxytozin dafür, dass wir in einen Zustand der Ruhe, Sicherheit und des Vertrauens zurückfinden, und hilft Müttern wie Kindern so, sich nach einer belastenden Erfahrung aneinander zu binden (Carter 1998, 2006).
Ich erinnere mich bis heute an das leicht benommene, glückliche und zufriedene Gefühl, das mich immer dann erfüllte, wenn ich meine neugeborene Tochter gestillt hatte, was in ihren ersten Lebenstagen meine Hauptbeschäftigung zu sein schien. Während sie an meiner Brust zufrieden einschlief, unternahm mein Gehirn den schwachen Versuch, mich davon zu überzeugen, dass ich aufstehen und etwas Nützliches tun sollte: eine Ladung Wäsche in die Maschine stopfen, endlich aufräumen oder wenigstens duschen. Doch mein Geist schien wie in Zeitlupe zu arbeiten und mein Körper lockte: Warum nicht einfach noch ein bisschen hier sitzen, sie ansehen, ihren Duft einatmen, neben ihr einschlafen? Rückblickend wünschte ich, ich hätte diesen kostbaren Zustand mehr genießen und die Lautstärke, mit der mein Geist mir immer wieder erklärte, was alles zu tun sei, herunterregeln können. Denn in Wirklichkeit tat ich bereits alles, was ich zu tun hatte.
2.3.2 Schlussfolgerungen für heutige Eltern
Unser Bindungssystem ist verantwortlich dafür, dass wir uns auf viele Arten und Weisen mit unseren Kindern verbinden und für sie sorgen und die ihm zugrunde liegenden neuroendokrinen Reaktionen bewirken, dass sich ein großer Teil dieser Prozesse unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle vollzieht. Mit ihm besitzen wir ein erstaunliches, gewissermaßen vorinstalliertes System, das automatisch anspringt, wenn wir uns mit unserem Baby oder mit anderen Menschen verbinden, und uns dabei hilft, uns besänftigt, getröstet, ruhig und sicher zu fühlen. Wir alle verfügen über diese Fähigkeit, und das Schöne daran ist, dass Bindungsreaktionen oft automatisch stattfinden, ohne dass wir darüber nachdenken müssten. Wenn unser Kind leidet oder etwas braucht, reagieren wir häufig sofort, indem wir es trösten – das ist unser ererbtes Bindungssystem in Aktion.
2.3.3 Wie kann Achtsamkeit helfen?
Alles, was wir tun müssen, um dieses System weiterzuentwickeln, ist, es zu benutzen. Auch wenn das vielleicht zu vereinfacht klingt, ist das Grundprinzip durch Forschungsergebnisse belegt. Wenn wir Zeit mit unseren Kindern verbringen, eine Freundin trösten, mitfühlend handeln oder jemanden umsorgen, aktivieren wir unser Bindungssystem. Der Tastsinn ist die bei der Geburt am weitesten entwickelte Sinnesmodalität, und entsprechend wichtig sind Berührungen in der Pflege und bei der Bindungsentwicklung. Körperliche Berührung bewirkt die Ausschüttung von Oxytozin, senkt den Spiegel des Stresshormons Kortisol und die Aktivität in Gehirnarealen, die mit Stress in Verbindung stehen. Immer wenn wir uns wohltuenden Aktivitäten hingeben, insbesondere solchen, die sanfte Berührungen beinhalten, wie ein Kind in unseren Armen zu halten, es zu trösten oder uns selbst zu trösten, wenn wir Kummer haben, aktivieren wir dieses System, das uns hilft, uns ruhig und zufrieden zu fühlen (Gilbert 2009; Goetz et al. 2010; Neff 2011).
Wir können dieses System aber offenbar auch durch Mitgefühls- und Liebende-Güte-Meditation stärken. Richard Davidson und seine Kollegen haben die Wirkung von Meditation auf das Gehirn untersucht und festgestellt, dass die Achtsamkeits- und Liebende-Güte-Praxis im Gehirn ein Aktivitätsmuster erzeugt, das mit positiven Gefühlszuständen assoziiert ist (Davidson et al. 2003).
2.3.4 Transgenerationale Weitergabe von Bindungsmustern
Leider haben unsere automatischen Bindungsreaktionen auch eine Kehrseite: Wir neigen dazu, die automatischen Bindungs- und Elterninteraktionen zu wiederholen, die wir in unserer eigenen Kindheit erlebt haben (van IJzendoorn 1995). Wenn wir weniger gute Erfahrungen mit unseren Eltern gemacht haben, kann dies den Aufbau einer sicheren Bindung zwischen uns und unserem Kind erschweren. So sind Eltern, die als Kinder Opfer von physischer oder psychischer Gewalt oder Missbrauch wurden, eher in Gefahr, ihre Kinder ebenfalls zu misshandeln oder zu missbrauchen, auch wenn die meisten Eltern mit solchen Kindheitserfahrungen später nicht zu Tätern werden (Egeland et al. 1988). Denken Sie an Ihre eigenen Erfahrungen als Eltern: Wie oft haben Sie sich in der Hitze des Gefechts schon dabei ertappt, dass Sie etwas gesagt oder getan haben, das Ihre Mutter oder Ihr Vater früher genau so gesagt oder getan haben, obwohl Sie sich geschworen hatten, dass Ihnen dies niemals passieren würde?
Marinus van IJzendoorn hat untersucht, auf welche Weise Bindungsstile von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Seine umfassende Metaanalyse (eine systematische Auswertung zahlreicher Einzelstudien) ergab, dass die Einschätzung, die eine Mutter von ihren eigenen Bindungsbeziehungen hatte, am zuverlässigsten vorhersagte, ob ihr Kind sicher oder unsicher an sie gebunden war – zuverlässiger als beobachtete Interaktionen zwischen ihr und ihrem Kind. Denken Sie einen Moment darüber nach: Was für die Qualität der Bindung Ihres Kindes an Sie am meisten zählt – mehr als das, was Sie als Vater oder Mutter tatsächlich tun –, ist Ihr eigenes Bindungsmodell, d. h. das, was Sie über Ihre wichtigsten Bindungsbeziehungen verinnerlicht haben. Van IJzendoorn spricht in diesem Zusammenhang von einer „Transmissionslücke“, da wir nicht exakt erfassen können, wie solche mentalen Bindungsrepräsentationen zu dem beobachteten kindlichen Bindungsverhalten führen (van IJzendoorn 1995). Diese Transmissionslücke könnte erklären, weshalb manche Eltern auf verhaltenstherapeutische Elterntrainings, die auf die Vermittlung grundlegender elterlicher Kompetenzen abzielen, nicht gut ansprechen. Für Eltern, die selbst unsicher gebunden waren oder sind, ist das „Tun“ all der richtigen Dinge möglicherweise nicht ausreichend, wenn ihre eigenen Bindungsbeziehungen in der Vergangenheit andere Gefühle in ihnen auslösen. Was wir nonverbal, auf einer emotionalen Ebene, kommunizieren, ist für unsere Kinder womöglich wichtiger als das, was wir sagen oder tun, insbesondere, wenn es um die Qualität der Bindung geht (Siegel & Hartzell 2003). Wie wir sehen werden, haben Menschenbabys im Laufe der Evolution gelernt, die Intentionen ihrer Mütter und anderer Pflegepersonen sehr genau zu erfassen – schließlich hing ihr Überleben von deren Fürsorge und Engagement ab (Hrdy 2009). Daher überrascht es auch nicht, dass Menschenkinder auf nonverbale Bindungsinformationen sensibler reagieren als auf das, was Eltern sagen.
2.3.5 Schlussfolgerungen aus der Bindungsforschung: ein Silberstreif am Horizont?
Die Erkenntnisse über die Weitergabe von Bindungsmustern von einer Generation zur nächsten bedeuten so etwas wie einen Silberstreif am Horizont. Die erwähnten Studien erfassen die Bindungsrepräsentanzen der Mütter, d. h., wie Mütter ihre Bindungserfahrungen auf kohärente und emotional integrierte Weise deuten. Dies ist unabhängig davon, ob eine Mutter sicher oder unsicher an ihre Eltern gebunden war. Tatsächlich weisen die Forschungsergebnisse darauf hin, dass auch ehemals unsicher gebundene Erwachsene Bindungssicherheit „erwerben“ können, indem sie ihre Bindungserfahrungen reflektieren und deren emotionale Auswirkungen auf aktuelle Beziehungen verstehen.
Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass Bindungsbeziehungen sich über die gesamte Lebensspanne hinweg entwickeln und verändern. So stellte der Entwicklungspsychologe Alan Sroufe fest, dass Kinder, die in ihrer frühen Kindheit als unsicher und im Jugendalter als sicher gebunden klassifiziert wurden, bessere Ergebnisse erzielten als Kinder, die zu beiden Messzeitpunkten als unsicher gebunden eingestuft wurden oder von „sicher gebunden“ in der frühen Kindheit zu „unsicher gebunden“ in der Adoleszenz wechselten (Sroufe et al. 1999). Eine experimentelle Studie mit rumänischen Heimkindern belegt die Plastizität von Bindungsbeziehungen noch überzeugender. Für diese Studie wurden rumänische Waisenkinder nach dem Zufallsprinzip entweder wie bisher (im Heim) betreut oder in Pflegefamilien untergebracht. Die Kinder, die in Pflegefamilien kamen, machten, verglichen mit den im Waisenhaus verbliebenen Kindern, bedeutende Fortschritte im Hinblick auf ihre Bindungssicherheit – ungeachtet der Tatsache, dass vor Beginn der Studie mehr als 75 Prozent der Kinder unsicher gebunden waren oder keinerlei Bindungsverhalten zeigten (Smyke et al. 2010).
2.3.6 Wie kann Achtsamkeit helfen?
Diese Befunde sind ein Hoffnungssignal für Eltern. Viele der Mütter und Väter in unseren Mindful-Parenting-Gruppen haben mit ihren eigenen Eltern nicht die besten Erfahrungen gemacht. Manche fragen: „Wie kann ich für mein Kind da sein, wenn ich selbst nie erlebt habe, wie das ist?“ Aus der Forschung wissen wir jedoch, dass es tatsächlich möglich ist, auch eine sehr schwierige oder von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen geprägte Kindheit zu bewältigen, wenn wir bereit sind, die emotionale Arbeit der Integration dieser Erfahrungen zu leisten, und uns bewusst werden, auf welche Weise sie in unseren gegenwärtigen Beziehungen zu unseren Kindern und anderen Bindungspartnern auftauchen. Das ist keinesfalls leicht, und nicht jede Mutter, jeder Vater wird willens sein, diese Arbeit zu leisten, oder fähig, sich zu verändern. Doch wenn wir diese Motivation mitbringen, sind wir ganz sicher nicht dazu verurteilt, die Muster unserer Eltern zu wiederholen.
Im Mindful-Parenting-Kurs gehen wir diese Problematik auf zweierlei Weise an. Zunächst laden wir die Eltern ein, bewusst auf sich wiederholende Interaktionsmuster in der Beziehung zu ihren Kindern zu achten. Dann fordern wir sie auf, zu erforschen, ob diese Muster den Interaktionen gleichen, die sie aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Diese Muster als Wiederholungen zu erkennen, kann Eltern helfen, in schwierigen Situationen einen Moment innezuhalten, bevor sie überreagieren, das Muster aus der Vergangenheit und die damit verbundenen Gefühle als etwas zu erkennen, das nicht in die gegenwärtige Situation gehört, und bewusst zu entscheiden, wie sie darauf antworten möchten. Durch das Erkennen und Loslassen alter Muster können Eltern sich von dysfunktionalen oder gar gewalttätigen elterlichen Interaktionsformen lösen.
Zweitens erforschen wir die Bindungsbeziehung der Eltern zu ihrem Kind, indem wir die Eltern einladen, ihr Kind achtsam zu beobachten und im Umgang mit ihm achtsames Zuhören und Sprechen zu praktizieren. Sich seinem Kind einfach mit ganzer Aufmerksamkeit zu widmen, hilft beim Aufbau der Bindungsbeziehung. Wir nutzen auch Dan Siegels und Mary Hartzells (2003) Konzept von „Bruch und Reparatur“ in Bindungsbeziehungen, um Eltern zu helfen, mit Eltern-Kind-Konflikten umzugehen, die als Unterbrechungen oder Abbrüche der Beziehung erlebt werden können. Wichtig ist, dass wir nach einem Konflikt an die Bruchstelle zurückgehen und die Beziehung „reparieren“, indem wir uns, wenn sich die Wogen geglättet haben, unseren Kindern wieder zuwenden und uns genau ansehen, was geschehen ist. Vor allem bitten wir sie, uns mitzuteilen, was in ihnen vorgeht, und fühlen mit ihnen. Auf diese Weise bestätigen wir ihre emotionale Erfahrung und helfen ihnen, ihre Emotionen zu verstehen und zu akzeptieren. So unterstützen wir sie bei der Entwicklung von Empathie und Mitgefühl mit sich selbst und mit anderen. Außerdem stellen wir damit die emotionale Nähe und Sicherheit unserer Beziehung zu unseren Kindern wieder her, so dass wir für sie ein sicherer Hafen bleiben, in den sie zurückkehren können, wenn sie Kummer oder Probleme haben.
2.3.7 Die Evolution vielfältiger Bindungsbeziehungen
Weiter oben haben wir erläutert, dass unsere Vorfahren ihren Nachwuchs nach dem Prinzip der kooperativen Aufzucht, d. h. mit der Unterstützung vieler anderer Bezugspersonen, großzogen. Wie ist die Bindungsbeziehung zwischen Eltern und Kindern im Licht der Evolutionsgeschichte zu verstehen? Zu den bedeutsamsten Entwicklungen in der Bindungsforschung zählt die Erkenntnis, dass Kinder vielfältige Bindungsbeziehungen zu unterschiedlichen Bezugspersonen aufbauen können und dass mehrere sichere Bindungsbeziehungen tatsächlich vorteilhafter sein können als eine einzige sichere Bindung. So führten die Psychologen Marinus van IJzendoorn und Abraham Sagi in den Niederlanden und in Israel Studien mit Kindern durch, die entweder primär von ihrer Mutter oder von ihrer Mutter und einer weiteren Bezugsperson betreut wurden. Die Forscher fanden heraus, dass sich die Bindungsbeziehungen der Kinder zu verschiedenen Bezugspersonen unterschieden; so kam es z. B. vor, dass ein Kind unsicher an seine Mutter, aber sicher an seinen Vater oder eine Großmutter gebunden war. Aus diesen Forschungsergebnissen schlossen sie, dass die Gesamtqualität des kindlichen Bindungsnetzwerks der wichtigste Faktor für die soziale und emotionale Entwicklung eines Kindes ist. Drei sichere Beziehungen zu haben, erwies sich als optimal (van IJzendoorn et al. 1992).
2.3.8 Schlussfolgerungen für heutige Eltern
Die genannten Befunde bedeuten nicht, dass die Mutter-Kind-Bindung unwichtig wäre. Sie bedeuten lediglich, dass wir, wenn wir über Bindung nachdenken, unsere Perspektive um wichtige Andere erweitern müssen, die an der Pflege, Betreuung und Erziehung eines Kindes beteiligt sind: Vater, Stiefeltern, Großeltern, Tanten, ältere Geschwister, Tagesmütter, Erzieherinnen und Lehrer. Außerdem lassen sie Raum für eine Vielfalt von Fürsorge- und Bindungsarrangements, die uns die in unserer evolutionären Vergangenheit herrschende Flexibilität in Erinnerung ruft. So haben Untersuchungen gezeigt, dass eine sichere Beziehung zum Vater die negativen Effekte einer unsicheren Bindung an die Mutter abpuffern kann (Chang et al. 2007). Ein Kind, das bei seiner alleinerziehenden Mutter lebt, ist vielleicht sowohl an seine Mutter als auch an seine Großmutter sicher gebunden, und ein Kind, das in einer Patchworkfamilie aufwächst, kann z. B. sichere Bindungen an Mutter, Vater und Stiefvater haben. Diese Flexibilität, die vielfältige Betreuungsnetzwerke entstehen ließ, entwickelte sich, weil Menschenmütter bei der Aufzucht ihrer Nachkommen auf zusätzliche Hilfe angewiesen waren. Eine weitere Lektion aus unserer evolutionären Geschichte der gemeinsamen Fürsorge ist, dass Kinder bereitwillig Bindungen zu anderen Bezugspersonen eingehen, besonders wenn diese sich als einfühlsam, fürsorglich und verlässlich erweisen. Dass es Kindern so leicht fällt, Beziehungen zu Alloeltern aufzubauen, und dass letztere sich so stark zu Kindern hingezogen fühlen, ermöglichte es unseren Vorfahren, in größerer Zahl zu überleben und sich zahlreicher zu vermehren als andere Primaten. Die Fähigkeit unserer Kinder, vielfältige Bindungen einzugehen, wird uns (wie ich hoffe) schlussendlich die nötige Flexibilität geben, um für die Kinderbetreuung im 21. Jahrhundert Lösungen zu finden.
Sicher an mehrere Betreuer gebunden zu sein, ist jedoch nicht nur ein guter Ersatz für die Bindung an eine einzige primäre Bezugsperson, sondern offenbar auch vorteilhaft für die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern. In der oben erwähnten Studie mit israelischen Kibbuzkindern zeigten Kinder, die sicher an ihren nichtelterlichen Betreuer oder ihre Betreuerin gebunden waren, später im Kindergarten größeres Selbstvertrauen und ausgeprägtere soziale Kompetenzen (van IJzendoorn et al. 1992). Kinder, die sicher an verschiedene Bezugspersonen gebunden sind, scheinen in ihren Beziehungen ein Gefühl der Sicherheit und bestimmte kognitive Kompetenzen zu entwickeln, darunter die Fähigkeit, die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten (Hrdy 2009).
2.4 Die Evolution von Empathie, Kooperation und Mitgefühl: Geschenke unserer Vorfahren
Schließlich kann uns die Evolutionstheorie auch etwas über die Entstehung von Empathie, Kooperation und Mitgefühl lehren – Fähigkeiten, die von zentraler Bedeutung für unser Leben als Eltern, für die Achtsamkeitspraxis und für unsere ureigene menschliche Natur sind. Evolutionstheoretiker und Psychologen führen unsere einzigartige Fähigkeit zu Empathie und Mitgefühl auf die ungewöhnlich enge und lange Beziehung zwischen Mutter und Kind zurück, die der Ursprung unseres Bindungssystems ist. Die Psychologin Jennifer Goetz und ihre Kollegen glauben, dass Mitgefühl in der Evolution des Menschen als ein Affektzustand auftauchte, der dazu diente, das Leid oder die Bedürftigkeit unseres verletzlichen Nachwuchses zu reduzieren. Mit der Zeit habe die höhere Überlebensrate der Kinder, die von mitfühlenderen Müttern aufgezogen wurden, zur Selektion dieses Merkmals geführt. Doch die Mutter-Kind-Bindung kennzeichnet alle Säugetierspezies, insbesondere Primaten (Goetz et al. 2010). Warum haben Empathie, Mitgefühl und Kooperationsbereitschaft sich dann gerade in unserer Spezies und nicht auch bei verwandten Menschenaffen wie z. B. Schimpansen bis zu einem so hohen Grad entwickelt?
Der Anthropologe und Entwicklungspsychologe Michael Tomasello vertritt die Meinung, dass Menschen sich durch ihre Fähigkeit, zu mentalisieren – die Gedanken anderer zu „lesen“ – und geistig-seelische Zustände zu kommunizieren, von anderen Primaten unterscheiden. Im Unterschied zu praktisch allen anderen höheren Primaten können Menschen 1) verstehen, dass andere Menschen Gedanken, Motive und Absichten haben, und 2) herauszufinden versuchen, welche Gedanken, Motive und Absichten dies sind. Unablässig bemühen wir uns zu begreifen, was in den Köpfen unserer Mitmenschen vorgeht. Noch beeindruckender ist, dass wir anderen helfen, sobald wir ihre Absichten verstanden zu haben glauben. Wir teilen die Erwartung gegenseitiger Kooperation und Hilfsbereitschaft: Unsere Motivation, die Intentionen anderer zu verstehen, ist der Wunsch, mit ihnen zusammenzuarbeiten, ihnen beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen oder gemeinsame Ziele aufzustellen (Tomasello 2008).
Schon sehr früh versuchen Menschenbabys herauszufinden, was andere über sie denken und welche Absichten diese anderen ihnen gegenüber hegen (Hrdy 2009). Menschenbabys (und Kinder und Erwachsene) beschäftigt außerdem sehr, was andere für sie empfinden: Liebst du mich wirklich? Sorgst du dich wirklich um mich?
Warum entwickelten wir diese starke Motivation, zu wissen, was andere über uns denken, und warum sind wir darin so gut geworden? Für Sarah Hrdy liegt die Antwort auf diese Frage in unserer Geschichte der kooperativen Aufzucht. Irgendwann in der Evolutionsgeschichte wurde die Bürde der Aufzucht zu schwer für eine Mutter, als dass sie sie weiter allein hätte schultern können. Mütter brauchten Unterstützung, um das Überleben ihrer Kinder zu sichern, und so begannen sie anderen vertrauenswürdigen Artgenossen – Großmüttern, Tanten, Geschwistern, Vätern – zu erlauben, sich an der Betreuung und Versorgung ihrer Kinder zu beteiligen. Mit dem wachsenden Unterstützungsbedarf ging ein gesteigertes Bewusstsein für das Bedürfnis nach Unterstützung einher. Anders als bei früheren Primaten war mütterliches Engagement nicht mehr selbstverständlich, sondern davon abhängig, wie Mütter die Verfügbarkeit von Unterstützung einschätzten. Säuglinge, die die Absichten, Motive und Emotionen ihrer Mütter besonders gut erfassen und in ansprechender Weise darauf antworten konnten, hatten es vermutlich leichter, die Bindung ihrer Mutter an sie und die mütterliche Fürsorgebereitschaft sicherzustellen. Mit anderen Worten: Weil die Hingabe einer Mutter an ihr Baby nicht garantiert ist, müssen menschliche Babys sich die Aufmerksamkeit ihrer Mutter „erarbeiten“. Die natürliche Selektion dürfte Kinder bevorzugt haben, die eine Bindung zu ihrer Mutter aufbauen konnten, indem sie ihr in die Augen sahen, Gurrlaute produzierten, lächelten und das Lächeln der Mutter erwiderten. Menschliche Neugeborene sind schon nach wenigen Lebenstagen fähig, Blickkontakt aufzunehmen, und dies stimuliert frischgebackene Mütter und Väter, ihrem Neugeborenen immer wieder lange in die Augen zu schauen und „Zwiegespräche“ mit ihm zu führen, wodurch der Aufbau einer Bindung sowie die kindliche Sprach- und Mentalisierungsfähigkeit gefördert werden. Hrdy vermutet, dass dieses Repertoire kindlicher Fähigkeiten sich deshalb so viel weiter entwickelte als bei anderen Menschenaffen, weil es dazu beitrug, die mütterliche Fürsorgebereitschaft zu sichern (Hrdy 2009).
Die Beteiligung weiterer einfühlsamer Bezugspersonen an der Betreuung und Aufzucht der Kinder dürfte außerdem die Fähigkeiten zum Perspektivwechsel, zum Teilen von Gefühlen und zur Empathie gefördert haben. Wird ein Kind von einer anderen Bezugsperson gehalten, sieht es seine Mutter aus einer neuen Perspektive. Es hat keinen Körperkontakt mehr zur Mutter, sondern sieht sie aus einer gewissen Entfernung. Um zu überleben, muss ein Kind die Fähigkeit entwickeln, die Absichten seiner Mutter in deren Gesicht zu lesen (Wird meine Mutter für mich sorgen? Hat sie Angst? Bin ich in Gefahr? Ist dieser Fremde sicher oder gefährlich? Kann sie sich um mich kümmern und mich füttern?). Wir haben gelernt, dass Kinder, die besonders gut darin waren, die Intentionen ihrer Mütter und anderer Bezugspersonen zu erfassen, von der Selektion bevorzugt wurden. In ähnlicher Weise wird eine Mutter, die ihr Kind nicht selbst im Arm hält, besonders motiviert sein, im Gesicht ihres Kindes zu lesen. Daher wird das Teilen von Erfahrungen ebenso wie die gegenseitige Mitteilung emotionaler und motivationaler Zustände via Mimik die Überlebenschancen unserer Vorfahren gesteigert haben. Intersubjektivität – die Fähigkeit, mentale Zustände und Intentionen mit anderen zu teilen – konnte sich laut Hrdy gerade in unserer Spezies in solch hohem Maße entwickeln, weil diese Fähigkeit für das Überleben eines Kindes entscheidend wurde, als das Prinzip der kooperativen Aufzucht sich durchsetzte. Diese Fähigkeit führte zur Evolution der sozialsten, kooperativsten aller Menschenaffenarten: zum Homo sapiens (Hrdy 2009).
2.4.1 Mitgefühl und Kooperation in der New Yorker U-Bahn
Eine kürzlich unternommene Reise nach New York City führte mir eindrücklich vor Augen, wie stark unsere Motivation ist, die Absichten unserer Mitmenschen zu erfassen, um ihnen zu helfen, selbst in einer Großstadt und auch dann, wenn es sich um vollkommen fremde Menschen handelt. Ich kam aus Europa, war soeben gelandet und erschöpft von der Reise, deshalb sprang ich in einen U-Bahn-Waggon, dessen Türen sich gerade schlossen, ohne mich vorher zu vergewissern, ob die Bahn auch in die richtige Richtung fuhr. Ein junger Mann mit Goldketten und einer Baseballkappe hielt die Tür für mich offen. Als mir klar wurde, dass ich keine Ahnung hatte, ob ich in der richtigen Bahn saß, entschloss ich mich, eine freundlich aussehende Frau zu fragen, in welche Richtung wir fuhren. Sie war sich nicht sicher, zeigte dann aber auf den Mann, der ihr gegenüber saß, um mir zu bedeuten, ich solle ihn fragen. Der Mann bestätigte mir, dass ich die richtige U-Bahn genommen hatte. Als ich mich bedankte, rief mir ein Passagier auf der anderen Seite des Mittelgangs zu: „Verzeihung, Miss, aber Sie sollten erst an der nächsten Station umsteigen, denn wenn Sie hier umsteigen, müssen Sie zweimal lösen.“ Ich musste innerlich lächeln: Obwohl den New Yorkern der Ruf anhaftet, unfreundlich zu sein, hatte mein unsicheres Verhalten binnen drei Minuten vier völlig verschiedene Menschen dazu bewogen, mir spontan ihre Hilfe anzubieten.
Erst später wurde mir bewusst, wie gut dieses Erlebnis Hrdys und Tomasellos These von der hoch entwickelten menschlichen Fähigkeit zur Mentalisierung und Kooperation illustriert: Im Widerspruch zu unserer Sicht des Menschen als eines primär aggressiven und egoistischen Lebewesens sind wir Menschen die einzigen Primaten, die begreifen, dass andere Menschen ebenfalls einen Geist besitzen, die die Fähigkeit entwickelt haben, die mentalen Erfahrungen anderer nachzuvollziehen, und die motiviert sind, anderen beim Erreichen von Zielen zu helfen, die in deren Geist entstanden sind. Die Menschen, denen ich in der U-Bahn begegnet bin, waren keineswegs Helden; sie nahmen lediglich wahr, dass eine irgendwie erschöpft wirkende Frau mit Koffern den Waggon bestieg, schlossen aus meinem Verhalten auf meine Ziele und waren gewillt, mir beim Erreichen dieser Ziele zu helfen. Wir haben uns so an ein solches Verhalten gewöhnt, dass wir es für selbstverständlich halten und nicht erkennen, dass es aus evolutionärer Perspektive einen gewaltigen Sprung dokumentiert.
2.4.2 Schlussbemerkungen: Evolution, Mitgefühl und Achtsamkeit
Im Verlauf unserer langen Evolutionsgeschichte haben wir uns zu Lebewesen entwickelt, die kooperativer, empathischer und mitfühlender sind als alle anderen Primaten, und an der Entwicklung unserer Kinder können wir die allmähliche Entfaltung unseres menschlichen Potenzials zu Empathie, Mitgefühl und Intersubjektivität immer wieder beobachten (Hrdy 2009; Tomasello 2008). Von klein auf zeigen Kinder Interesse an anderen Menschen, die Bereitschaft, zu teilen und anderen zu helfen, und Freude am Kommunizieren mentaler Zustände (Zahn-Waxler et al. 1992). Dies sind einzigartige Fähigkeiten unserer Spezies. Wenn Kinder von einfühlsamen und aufgeschlossenen Bezugspersonen aufgezogen werden, können sich diese angeborenen Fähigkeiten zu Intersubjektivität, Empathie, Kooperation und Mitgefühl gut entwickeln. Als Eltern haben wir die wichtige Aufgabe, unseren Kindern dabei zu helfen, indem wir emotional präsent für sie sind und uns auf ihre Gefühlszustände einstimmen (Siegel & Hartzell 2003).
Bei der traditionellen Achtsamkeitspraxis geht es nicht nur um die Entwicklung individueller Achtsamkeitsfähigkeiten, sondern auch um das übergeordnete Ziel aller Achtsamkeitspraxis: mitfühlendere menschliche Wesen zu werden und so zu handeln, dass unser Verhalten dieses Mitgefühl spiegelt. Dies heißt nicht, dass wir immer und ausschließlich mitfühlend sein werden, doch in jedem von uns sind, wie der Meditationslehrer Thich Nhat Hanh so treffend sagt, die Samen des Mitgefühls ebenso vorhanden wie die Samen des Zorns und der Furcht (T. Nhat Hanh, persönl. Kommunikation, Juli 2010). In unseren Genen, unserem Körper, unseren emotionalen Reaktionen und unseren automatischen Verhaltensmustern tragen wir das Gewicht unserer evolutionären Vergangenheit mit uns. Wir können gar nicht anders, als Mitgefühl zu empfinden und mitfühlend zu handeln, weil dies unser evolutionäres Erbe ist – und aus demselben Grund können wir manchmal nicht anders, als Gefühle wie Aggression oder Angst zu empfinden. Wir sind Teil des Entwicklungsstroms und haben gewissermaßen ein evolutionäres Recht auf all diese Reaktionen. Achtsamkeit ändert nichts daran; sie gibt uns lediglich die Möglichkeit, absichtsvoll und bewusst zu entscheiden, wie wir handeln wollen.