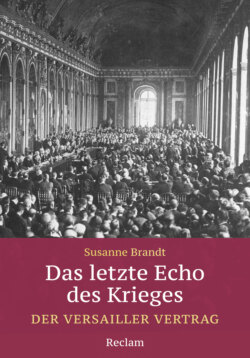Читать книгу Das letzte Echo des Krieges. Der Versailler Vertrag - Susanne Brandt - Страница 4
Das letzte Echo des Krieges
ОглавлениеWie kann man nach einem langen, blutigen, mit allen Mitteln geführten Krieg zum Frieden übergehen? Der Erste Weltkrieg war durch äußerste Brutalität geprägt gewesen. Alle Ressourcen wurden in den Dienst der Kriegführung gestellt, Regierungen verschuldeten sich bei anderen Staaten und ihren Bürgern. Die Politik nahm Einfluss auf die Wirtschaft und die Gesellschaft. Das Militär übte Druck aus auf die Politik. Zivilisten und Soldaten wurden mobilisiert, um weiterzukämpfen, Opfer hinzunehmen, den Krieg zu finanzieren und vor allem: daran zu glauben, dass sie für eine gerechte Sache kämpften. Wenn die eigene Seite im Recht ist, so die einfache Logik, muss die andere Seite im Unrecht und schuldig sein. Die Propagandastäbe in allen Staaten verteufelten den Gegner und hämmerten den Lesern wie den Kinobesuchern, den Schulkindern, Fabrikarbeitern sowie den Kirchgängern ein, dass es in diesem Kampf um zentrale Werte wie Demokratie, Freiheit und Sicherheit, ja um das Fortbestehen der eigenen Nation gehe.
Außerdem hatten die Regierenden ihren Bürgern bzw. Untertanen Versprechungen gemacht für den Fall eines Sieges: Alle Opfer sollten belohnt werden, sei es durch politische Reformen oder eine bessere und geeinte Gesellschaft. Auch materielle Werte wurden in Aussicht gestellt, etwa Zinsen auf Anleihen oder zumindest finanzielle Wiedergutmachung für Witwen, Waisen und Versehrte. Den Bündnispartnern kündigte man ebenfalls Belohnungen an. FrankreichFrankreich, GroßbritannienGroßbritannien und RusslandRussland rangen 1915 beispielsweise um die Unterstützung des neutralen ItaliensItalien, das vor dem Kriegsausbruch Bündnispartner der Mittelmächte gewesen war. Sie versprachen dem italienischen Außenminister SonninoSonnino, Sidney Gebiete, die zu Österreich-UngarnÖsterreich-Ungarn gehörten. Als SonninoSonnino, Sidney nach dem Krieg in ParisParis seine Belohnung einforderte, entbrannte ein heftiger Streit, weil der amerikanische Präsident WilsonWilson, Woodrow solche geheimen Absprachen ablehnte.
Ein brutaler Krieg, hohe Opferzahlen, durch Propaganda geschürter Hass, aber auch große Versprechen, hehre Ideale und unterschiedliche Ziele: Unter diesen komplizierten Ausgangsbedingungen trafen nach mehr als vier Jahren des Kampfes Sieger und Besiegte zusammen, um zunächst im November 1918 Waffenstillstandsvereinbarungen zu unterzeichnen und später, im Jahr 1919 in ParisParis, den Friedensvertrag auszuhandeln. Doch nicht nur das Erbe des rücksichtslos geführten Krieges, auch aktuelle Ereignisse beeinflussten den Friedensprozess. Die kriegsmüden Menschen in der Heimat setzten die von ihnen gewählten Politiker unter Druck, möglichst schnell den Übergang zum Frieden zu vollziehen. Die Erwartungen waren enorm, denn Not, Hunger und Angst sollten schnell der Vergangenheit angehören. Politiker wie der britische First Lord of the Admiralty Eric GeddesGeddes, Eric versprachen im Wahlkampf im Dezember 1918 selbstbewusst, man werde die besiegten Deutschen ausquetschen wie eine Zitrone.1 Steuererhöhungen zur Bewältigung der Kriegskosten sollte es für die eigenen Bürger nach Möglichkeit nicht geben. Damit schränkte der Premierminister David Lloyd GeorgeLloyd George, David jedoch seinen Handlungsspielraum massiv ein: Viele Kompromisse waren für ihn in ParisParis nicht mehr möglich, weil er an sein Wahlversprechen gebunden war und unter dem Druck der Opposition und der Presse stand. Der amerikanische Präsident Woodrow WilsonWilson, Woodrow wiederum, mit dem die Vereinigten StaatenUSA 1917 in den Krieg eingetreten waren, war beseelt von der Idee, einen Völkerbund zu schaffen, dessen Mitglieder in Zukunft Konflikte gemeinsam und möglichst friedlich lösen sollten. Die damit verbundene Unterordnung staatlicher Aufgaben unter eine internationale Organisation war jedoch für viele Politiker und Bürger ein unerträglicher Souveränitätsverlust, so dass sie WilsonsWilson, Woodrow Vision offen kritisierten oder nur halbherzig unterstützten.
Der Krieg hatte zu radikalen Veränderungen geführt, Monarchen waren gestürzt worden, Staaten untergegangen und neu entstanden. In PolenPolen, der TschechoslowakeiTschechoslowakei und in JugoslawienJugoslawien waren die Menschen begierig, endlich ihren eigenen Staat gründen zu können. Sie warteten nicht auf die Zustimmung der Friedensmacher in ParisParis, wenn sie Gebiete der Besiegten in den eigenen Staat eingliederten und Grenzen neu zogen. Folglich waren einige wichtige Weichen bereits gestellt, als die Staatsmänner im Januar 1919 zusammenkamen. Außerdem erwachte bei vielen Menschen nicht nur die Hoffnung auf Frieden, sondern auf ein gerechteres und selbstbestimmtes Leben. In ParisParis sahen sich die Politiker unversehens mit vielfältigen Wünschen nach einer besseren Welt konfrontiert.
In ParisParis begegneten sich die Vertreter verschiedener Staaten, die den Krieg unterschiedlich erlebt und abweichende Visionen für die Zukunft ihrer Länder hegten. So blieb es nicht aus, dass sich auch im Kreis der Sieger Interessenkonflikte entzündeten. Für eine offene Aushandlung der Meinungsverschiedenheiten und Kompromisse blieb oft nur wenig Zeit. WilsonWilson, Woodrow widerstrebte es, wie erwähnt, die ItalienItalien versprochenen Gebiete abzutreten. Seinem Ideal des Selbstbestimmungsrechtes der Völker entsprach es nicht, Menschen ungefragt einem anderen Staat zuzuteilen. Doch er fügte sich und konnte im Gegenzug ein Entgegenkommen der anderen erreichen, als er die Monroe-Doktrin in die Völkerbundsatzung aufnehmen wollte.
Am Ende waren es die »Großen Drei«, die die wichtigen Fragen entschieden: Woodrow WilsonWilson, Woodrow, David Lloyd GeorgeLloyd George, David und der französische Ministerpräsident Georges ClemenceauClemenceau, Georges. Drei grundverschiedene Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Zielen hatten in ParisParis eine Herkulesaufgabe zu bewältigen, unterstützt von einer großen Zahl von Diplomaten, Juristen, Sachverständigen, Sekretärinnen und Dolmetschern. Dass die drei Männer erfolgreich zusammenarbeiteten, lag nicht zuletzt daran, dass sie sich ohne Dolmetscher verständigen konnten, denn ClemenceauClemenceau, Georges hatte in seiner Jugend einige Jahre in den Vereinigten StaatenUSA verbracht, beherrschte die Sprache und schätzte das Land. Vor allem aber galt sein Streben dem Schutz FrankreichsFrankreich: Nie wieder, so sein unumstößlicher Wille, dürfe Deutschland seinen Nachbarn angreifen. Nur ein dauerhaft geschwächtes Deutschland garantiere die Sicherheit seines Landes. Der britische Premierminister hingegen wollte Deutschland dem politischen Interesse GroßbritanniensGroßbritannien entsprechend als Großmacht erhalten, wenn auch als eine deutlich geschwächte.
Und schließlich waren es grundsätzliche Entscheidungen, die die Arbeit in ParisParis prägten. In der französischen Hauptstadt kamen nur Vertreter der Siegermächte zusammen. Mit den unterlegenen Staaten wurde nicht diskutiert. Den Deutschen, ebenso wie den Vertretern ÖsterreichsÖsterreich, Ungarns und des zerfallenen Osmanischen ReichesOsmanisches Reich, wurden in jeweils getrennten Verfahren die Friedensbedingungen überreicht. Ihnen blieb eine kurze Frist zur Unterzeichnung und Ratifizierung, doch Verhandlungen fanden nicht statt, sehr zum Entsetzen der deutschen Delegation. Die Sieger wollten vermeiden, dass bei einer Verhandlung mit den besiegten Staaten der Eindruck entstand, es bestehe Spielraum für den Ausgang der Gespräche. Für die Alliierten stand jedoch fest, dass mit dem Waffenstillstand bereits über Sieg, Niederlage und Schuld entschieden worden war. Hinter diese Position konnten und wollten sie auf keinen Fall zurückfallen. »Sie haben uns um Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn Ihnen zu gewähren«, entgegnete der französische Ministerpräsident ClemenceauClemenceau, Georges den deutschen Delegierten bei der Übergabe der Friedensbedingungen am 7. Mai 1919.2 Die Alliierten befürchteten auch, dass ihre Gegner in mündlichen Verhandlungen versuchen würden, die Sieger gegeneinander auszuspielen und deren ohnehin fragile Einheit zu zerschlagen. Die Quellen zeigen, dass die Deutschen genau dieses Ziel verfolgt haben. Mit Sicherheit hätten Verhandlungen mit den Gegnern sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Das wollten die alliierten Politiker, die unter dem Druck ihrer Bürger und Wähler standen, nicht auf sich nehmen.
Selbst die Siegermächte waren nicht vollzählig anwesend. Nachdem in RusslandRussland die Revolutionäre 1917 den Zaren gestürzt und in Brest-LitowskBrest-Litowsk mit den Deutschen einen Separatfrieden geschlossen hatten, entbrannte ein heftiger und verlustreicher Bürgerkrieg, der erst 1921 beendet wurde. Alliierte Verbände waren weit ins russische Gebiet vorgedrungen, ursprünglich, um russischen Truppen im Kampf gegen deutsche Einheiten zur Hilfe zu kommen. Sie blieben zum Teil bis 1921 dort und unterstützten den Kampf gegen die Bolschewiki. Politiker, Diplomaten und Journalisten konnten schwer einschätzen, was in RusslandRussland geschah; es kursierten Gerüchte über die Grausamkeit der Revolutionäre, doch keiner konnte sagen, was davon den Tatsachen entsprach. Das Ausland hatte seine Diplomaten schon im Sommer 1918 abgezogen und auch die meisten ausländischen Zeitungskorrespondenten waren bis Anfang 1919 abgereist. Die Kommunikation war überaus schwierig, Telegramme konnten Tage oder Wochen unterwegs sein, falls sie überhaupt ihren Adressaten erreichten.3 Da der Vertrag von Brest-LitowskBrest-Litowsk, mit dem das Deutsche Reich RusslandRussland seine Friedensbedingungen diktiert hatte, inzwischen annulliert war, befand sich RusslandRussland unversehens weiterhin mit den Alliierten gegen Deutschland im Krieg. Doch bis zum Ende der PariserParis Friedenskonferenz konnten sich die Politiker in ParisParis nicht darauf verständigen, wen sie anerkennen und einladen wollten. So wurde im Vertragstext lediglich vermerkt, dass RusslandRussland das Recht habe, Reparationen zu fordern.
Obwohl die Friedensmacher ein enormes Arbeitspensum bewältigten, lösten sie nicht alle Aufgaben. Schon während der Verhandlungen zeigte sich, dass es den Delegierten nicht gelingen würde, sich auf eine feste Summe der von Deutschland zu leistenden Reparationen zu einigen. Erst 1921 wurde bekannt gegeben, dass Deutschland als Wiedergutmachung 132 Milliarden Goldmark zu zahlen habe. Zahlungsverzögerungen führten 1923 zur Besetzung des RuhrgebietesRuhrgebiet. Viele Deutschen, die in den Jahren 1914–1918 weitgehend von Kampfhandlungen auf deutschem Boden verschont geblieben waren, nahmen das als Fortsetzung des Krieges wahr.
Bis heute wird der Versailler Vertrag unter vielen Gesichtspunkten heftig beanstandet. Nur vereinzelte Stimmen können ihm Gutes abgewinnen, die Kritikpunkte hingegen sind überaus zahlreich. Doch bevor wir uns der Bewertung des Vertrages zuwenden können, muss seine Vorgeschichte dargestellt werden. Die ersten Kapitel des Buches folgen im Wesentlichen der Chronologie des Geschehens, vom sich abzeichnenden Kriegsende im Herbst 1918 bis zur Ratifizierung des Vertrages. In den Kapiteln 2 bis 5 wird erläutert, wie die PariserParis Friedenskonferenz funktionierte, wer die wichtigsten Personen waren und wie Krisen abgewendet und Kompromisse erzielt werden konnten. Erörtert werden die Bedingungen, unter denen die Staatsmänner versucht haben, den Krieg zu liquidieren. Für die Sieger war der Vertrag mit Deutschland der bedeutendste, weshalb er im Zentrum des vorliegenden Bandes steht. Als er am 28. Juni 1919 unterzeichnet worden war, reisten WilsonWilson, Woodrow und Lloyd GeorgeLloyd George, David bald ab.
Bis zum Januar 1920 tagten die Delegierten weiter, dann schloss die Konferenz. Viele der beteiligten Politiker und Sachverständigen haben ihre Erinnerungen an die Verhandlungen niedergeschrieben, zahlreiche Quelleneditionen stehen zur Verfügung, um die Ereignisse und die Akteure verstehen zu können. Die Dokumente spiegeln vor allem wider, dass in ParisParis eine emotional aufgeheizte Stimmung herrschte. Unterschiedliche Erfahrungen, Ziele und Ideale trafen aufeinander, hartnäckige Vorurteile und Feindbilder beeinflussten die Diskussionen. Nicht alle Probleme und Themen, die die Sieger beschäftigten, können in diesem Band behandelt werden. Die Debatte um die Beteiligung RusslandsRussland und die Angst vor dem Bolschewismus etwa wird nur am Rande angesprochen, ebenso wie Ereignisse um die Gründungen der neuen Staaten. Im Mittelpunkt stehen der Vertrag mit Deutschland, die Ziele der Hauptsiegermächte, die Dynamik auf der Friedenskonferenz und die Diskussion im Deutschen Reich.
Kapitel 6 durchbricht die chronologische Darstellung, indem es sich dem Vertrag und der Endfassung ausgewählter Paragraphen widmet. Zwar kann nur ein kleiner Teil der insgesamt 440 Artikel behandelt werden, aber der Leser soll die Gelegenheit haben, nicht nur etwas über den Vertrag und seine Entstehungsgeschichte zu erfahren, sondern auch über die wichtigsten Artikel in der Endfassung, wie etwa die Strafverfolgung von Kriegsverbrechern oder die Internationalisierung deutscher Flüsse. Punktuell werden in diesem Kapitel auch die Umsetzung der Artikel und die Folgen behandelt. Kapitel 7 widmet sich im Anschluss den wichtigsten Etappen der Vertragserfüllung und Revision.
Wenn man sich mit der PariserParis Friedenskonferenz und dem Versailler Vertrag beschäftigt, verlangt es einiges an Disziplin, die Akteure nicht für ihr Verhalten oder für vermeintliche Fehlentscheidungen zu kritisieren. Das liegt sicher auch daran, dass die folgenden Ereignisse, das Scheitern der ersten deutschen Demokratie und der verheerende Zweite Weltkrieg auch mit zeitlichem Abstand so schmerzhaft sind, dass es schwerfällt, nicht nur nach Erklärungen, sondern auch nach Schuldigen zu suchen. Kritik kann und soll geübt werden, allerdings nicht mit der Haltung einer überlegenen Kommentatorin. In diesem Sinne werden in Kapitel 8 dem Leser noch einmal die wichtigsten Merkmale des Friedensprozesses zur kritischen Beurteilung dargelegt. Die ersten Kapitel sind soweit wie möglich frei von Urteilen, um dem Leser erst einmal die Gelegenheit zu bieten, den Verlauf der Konferenz mit der Vielzahl an konkurrierenden Interessen, Zielen und Einflüssen zu erfassen. Im 8. Kapitel soll es um Alternativen gehen, und zwar auf der Basis der damaligen Rahmenbedingungen. Ein solches Gedankenspiel ermöglicht es, die Faktoren und Motive, die für das Zustandekommen des Vertrages genannt wurden, noch einmal auf ihre Wirkmächtigkeit hin zu befragen. Das Nachdenken über Alternativen dient nicht der Kritik an den Zeitgenossen, sondern führt vor Augen, dass ein totaler Krieg nicht binnen einiger Monate in ein friedliches und respektvolles Miteinander der Staaten überführt werden kann. Vielmehr ist der Weg zu einem zwischenstaatlichen Zusammenleben in Ruhe und Sicherheit lang, mühsam und muss von vielen Akteuren beschritten werden.
Umfangreiche und aussagekräftige Quellen zur Geschichte der PariserParis Friedenskonferenz liegen als Veröffentlichungen vor oder können in Archiven bzw. online genutzt werden. Dennoch werden in dem Kapitel »Quellentexte« drei Quellen abgedruckt, die insofern von besonderer Bedeutung sind, als dass sich die Protagonisten und die Historiker immer wieder auf sie beziehen. Zum einen betrifft das die Rede von Präsident WilsonWilson, Woodrow, in der er am 8. Januar 1918 die amerikanischen Kriegsziele formulierte. Seine 14 Punkte wurden zur Grundlage des Waffenstillstandes, flossen aber auch in den Versailler Vertrag mit ein und bildeten ein wichtiges Argument für die von WilsonWilson, Woodrow enttäuschten Deutschen.
Ähnliches gilt für die nach dem amerikanischen Außenminister benannte Lansing-NoteLansing, Robert. Mit ihr erklärten die Alliierten am 5. November 1918 ihre Bereitschaft zum Friedensschluss auf der Grundlage von WilsonsWilson, Woodrow 14 Punkten, mit zwei Einschränkungen. Der Wortlaut der Note, ihre Übersetzung sowie die Einschätzung, wie bindend die Vereinbarung gewesen sei, wurden in Zusammenhang mit den Reparationen und der Kriegsschuld intensiv diskutiert.
Eine dritte bedeutende Quelle ist die Rede, die der deutsche Außenminister Ulrich von Brockdorff-RantzauBrockdorff-Rantzau, Ulrich von am 7. Mai 1919 nach der Übergabe des Vertragsentwurfes hielt. Von vielen Zeitgenossen wurde die Rede als überheblich bezeichnet, zahlreiche Historiker machen den Außenminister und seine Ansprache verantwortlich für eine weitere Verschlechterung der Beziehung zwischen den Siegermächten und den Deutschen. Erst im Anschluss an die Rede und einen intensiven Notenwechsel mit den Deutschen formulierten die Sieger eine brutale Mantelnote, in der sie den Schuldspruch gegen das ganze deutsche Volk in aller Schärfe vorbrachten. Darüber hinaus veranschaulicht die Rede auf bemerkenswerte Weise die Strategie, mit der nicht nur der Außenminister auf den Vertrag reagierte.
Eine ausführliche Zeittafel bietet daran anschließend die Möglichkeit, jederzeit Daten nachzuschlagen, ohne im Text suchen zu müssen. Sie spiegelt außerdem, wie arbeitsintensiv einzelne Phasen gewesen sind, zeigt Zusammenhänge auf, wenn etwa in einer akuten Krise Zugeständnisse gemacht worden sind, und verschafft einen Überblick, zum Beispiel über die Etappen der Reparationszahlungen.
Meine Absicht ist es, in diesem Buch darzulegen, mit welch schwerem Gepäck die ehemaligen Gegner von den Schlachtfeldern zu den Friedensverhandlungen kamen. In ParisParis traten die unterschiedlichen Hoffnungen und Visionen ebenso zutage wie die vielfältigen Erfahrungen eines brutalen und verlustreichen Krieges. Die Emotionen und Feindbilder wirkten fort. Das Scheitern der Friedensbemühungen 1919 ist in erster Linie dem Charakter des Krieges anzulasten, der die Konfliktparteien schwer belastet hat. Am 26. Juni 1919 schrieb der südafrikanischeSüdafrika Delegierte Jan Christiaan SmutsSmuts, Jan Christiaan dem Herausgeber des Manchester Guardian, Charles Prestwich ScottScott, Charles Prestwich:
»Dieser Vertrag ist nicht der Frieden, er ist einfach das letzte Echo des Krieges. Er beendet die Phase des Krieges und des Waffenstillstandes. Der richtige Frieden muss erst noch kommen, und er muss von den Völkern gemacht werden.«4