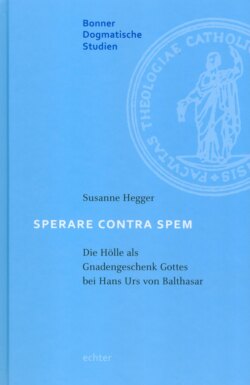Читать книгу Sperare Contra Spem - Susanne Hegger - Страница 17
2.1.2.1 Seinsvergessenheit der neuzeitlichen Metaphysik
ОглавлениеJedes ernsthafte philosophische Bemühen ist, wie bereits deutlich wurde, nach Balthasar seinem Wesen nach „auf die authentische metaphysische Frage als Mitte hin(ge)ordnet: Warum ist überhaupt Etwas und nicht lieber Nichts?“71 In der Erfahrung der grundsätzlichen Nicht-Notwendigkeit alles weltlich Seienden gerät der Mensch in Staunen über das Wunder des Seins. „Das aber besagt …, daß es nicht nur verwunderlich ist, daß Seiendes in der Differenz zum Sein sich über das Sein wundern kann, vielmehr ebenso, daß das Sein als solches und von sich her bis zum Ende ‚wundert‘, sich als Wunder, wunderlich und wunderbar benimmt. Dieses Ur-Wunder festhaltend zu bedenken, müsste das Grundanliegen der Metaphysik sein“.72 Gerade diesem Anspruch wird nun aber, so sein Befund, neuzeitliche Philosophie nicht gerecht. Vielmehr ist sie seiner Auffassung nach tiefster Seinsvergessenheit verfallen. Er beobachtet „eine schicksalshafte Erblindung, die ganze Geschlechter befällt: die äußerste Fragwürdigkeit der seienden Welt verstellt den Ausblick auf das umgreifende Sein, die metaphysische Urfrage an dieses wird gar nicht mehr gestellt“73.
Mit dieser Diagnose schließt Balthasar sich dem „Siewerthschen Theorem einer nachthomanischen Seinsvergessenheit der abendländischen Philosophiegeschichte … uneingeschränkt an.“74 Nach Siewerth ist das Seiende „einerseits die höchste und letzte eingefaltete Einheit, das Einfachste das in der Wirklichkeit der Welt angetroffen wird, wie es andererseits ein unauflösbar Allgemeines ist, das alle Merkmale und Bezüge sowohl in ihrer Verschiedenheit wie in ihrem Übereinkommen auf sich hin [eingefaltet] zusammen- oder inne-hält und seinshaft durchwaltet. Es umgreift daher mit den versammelnden, einigenden Bezügen auch alle Weisen von Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit, die an einer Sache hervortreten.“75 Diese Komplexität und dieses Mehrschichtigsein des Seienden macht ein Denken erforderlich, das die unterschiedlichen Dimensionen zunächst einmal als solche (an-)erkennt und aufnimmt, das sie darüber hinaus aber auch auf ihren Konstitutionsgrund, i. e. das Sein, hin ordnend zueinander in Beziehung setzt und dergestalt zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügt. Ein solches Denken bezeichnet Siewerth, dem Wortsinn des griechischen Verbs ἀναλέγ∈ιν folgend, als analoges Denken. Einzig ein solcher Akt der „durchmessende(n) ‚Über-legung‘“76 wird seiner Ansicht nach dem Sein des Seienden gerecht. Im modernen Denken dagegen beobachtet er ein Streben nach Einsinnigkeit. „In diesem Sinne lösen die modernen Wissenschaften die ‚analogen‘, ganzheitlichen Synthesen der Atome, der Moleküle oder Zellen in die gleichen Zuordnungsfaktoren und in gleiche Verhältnisse auf und scheiden alles, was sich diesem Ordnungs- und Maßsystem nicht einordnen läßt, aus der Betrachtung aus.“77 Das Sein als letzter Maßgrund alles Seienden ist dabei obsolet und gerät ergo zunehmend in Vergessenheit.
Dieser Vorwurf richtet sich gegen die beiden von Balthasar ausgemachten Wege neuzeitlich philosophischen Denkens gleichermaßen. Auf der einen Seite beobachtet er ein rationalistisches Bestreben, „das Sein zum umfassendsten Vernunftbegriff zu formalisieren … und damit der Vernunft ausdrücklich oder einschlußweise Übersicht und Verfügung über das Sein einzuräumen. Das Sein wird damit zur obersten und leersten Kategorie“.78 Diese Ablösung des Seinsbegriffs von der Wirklichkeit des konkreten Seienden muss die Seinsfrage unweigerlich zum Verstummen bringen, weil sich an einem abstrakten Begriff kein wunderndes und staunendes Fragen entzünden kann. Ohne diesen Brückenschlag auf das Absolute hin bleibt der Mensch dem Endlichen ohne jede Möglichkeit des Selbstüberstiegs verhaftet. Er ist gleichsam in seinem eigenen Denken gefangen. Folgt man Balthasar, so wird man sagen müssen, dass Selbiges in der Konsequenz auch für das Sprechen von Gott gilt. Weil der Seinsbegriff als abstrakte Denkkategorie völlig unbestimmt ist, kann er „einsinnig [univoce] auf unendliches wie endliches Sein, d. h. auf Gott und die Welt angewendet werden“.79 Das unendliche Sein Gottes wird so zu einer Kategorie menschlichen Denkens verweltlicht, und dadurch dem Menschen scheinbar verfügbar. Er meint, über Existenz wie Wesen Gottes Bescheid zu wissen.80
Auf der anderen Seite steht der von Balthasar so genannte „pantheistische Idealismus“81 hegelscher Ausprägung, der das Sein „so in sich verfestigt, daß es mit Gott zusammenfällt und nun im göttlichen Weltprozeß seine Wesenheiten aus sich selber erzeugt“.82 Ein Sein aber, das sich notwendig auszeugen muss, um dergestalt erst zu sich selber zu kommen, ist nicht anders als ein Endliches (im Sinne des Begrenztseins durch die Notwendigkeit zu werden, was es noch nicht ist) und deshalb letztlich auch als Figur menschlichen Denkens zu verstehen. In beiden Wegen neuzeitlicher Philosophie erkennt Balthasar daher „Formen der Logisierung und Essentialisierung des Seins“83, durch die das Sein zu einem Begriff des menschlichen Intellekts verkehrt und verfälscht wurde und wird.84
An dieser Stelle gilt es nun ganz genau hinzuschauen, um Balthasars Anliegen nicht misszuverstehen. Es geht ihm nicht um eine pauschale, undifferenzierte Ablehnung der sogenannten ‚anthropologischen Wende‘, die neuzeitliche „Umzentrierung des Kosmos auf den Menschen“85, durch die der „Mikrokosmos Mensch zu Mitte und Maß der Natur aufrückt“.86 Ganz im Gegenteil: Mit dieser Entwicklung, so seine grundsätzlich positive Wertung, nimmt der Mensch seine schöpfungsgemäße Bestimmung als Herrscher der Schöpfung erst wahrhaft an.87 Entsprechend erkennt von Balthasar in den immer beherrschender gewordenen wissenschaftlichen Strategien der Weltbewältigung, mit deren Einsatz der Mensch „immer weniger Dinge dem bloßen Naturverlauf überläßt, immer mehr Lebensverhältnisse [bis hinein in die verborgensten und intimsten des Menschen selbst] dem Zugriff der forschenden und damit auch praktisch-planenden Ratio unterwirft“88, zunächst einmal ein dem Wesen des Menschen durchaus entsprechendes Bemühen. „Wissenschaft läßt sich nur vom Menschen her definieren; sie ist das Tun des homo sapiens, der auf Grund dieses Tuns auch zum homo faber wird, weil er das Leben und die Dinge so meistert, wie sein verstehender Geist die Welt innerlich theoretisch im voraus gemeistert hat.“89 Das Bestreben, die Welt zu verstehen, um sie gestaltend zu durchwirken, ist demnach so alt wie der Mensch selbst. Was sich dabei im Laufe der Menschheitsgeschichte allerdings gewandelt hat, ist das Verhältnis des Menschen zur Natur,90 wobei Balthasar davon ausgeht, dass „das Gesetz des ‚Wandels als Fortschritt‘ die Ausfaltung der Idee des Menschen in der Welt zum Inhalt hat“.91
Wenn nun aber wissenschaftliches Arbeiten dergestalt Maß und Form vom menschlichen Wesen her erhält, so muss „jedes wissenschaftliche Urteil … um das Gewicht zu haben, das der Würde wissenschaftlichen Verhaltens überhaupt zukommt, angesichts der Gesamtidee des Menschen gefällt werden“.92 Dieser aber, so haben wir eingangs gesehen, ist nicht nur Welt bewältigender Geist, sondern gerade darin gleichzeitig immer auch wesentlich eine auf die ihm unverfügbare Gabe des Seins hin offene Frage und in diesem Sinne immer schon ein religiöses Wesen. Nur dort also, wo sich der Mensch in der Begegnung und Auseinandersetzung mit weltlich Seiendem zugleich dem Wunder des Seins öffnet und sich darin auf das absolute Sein hin übersteigt, wird er den Dingen wie auch seinem eigenen Wesen gerecht.
Diese Perspektive ist in naturwissenschaftlich-technischem Denken nun aber systematisch ausgeblendet, „denn jede Einzelwissenschaft setzt das Dasein ihres Gegenstandes voraus und muß die Frage, warum überhaupt etwas ist, ausklammern.“93 Die Logik der sogenannten exakten Wissenschaften verfolgt mit Ausschließlichkeit das Ziel, vorliegende Fakten auf ihre Gesetzmäßigkeiten hin zu befragen, um sich ihrer auf diese Weise zu bemächtigen und so in immer stärkerem Maße Herrschaft über die Natur zu gewinnen. Ergo bedarf es immer wieder der Vermittlung dieser wissenschaftlichen, das Seiende bewältigenden, mit der religiösen, sich auf die Gabe des Seins angewiesen sein lassenden94 Dimension menschlichen Seins, damit der Mensch nicht der Gefahr erliegt, sich selbst zum letzten Bezugspunkt und Maß aller Dinge zu machen. Nur so ist nach Balthasar den Dingen wie dem Menschen gerecht werdendes Verstehen überhaupt möglich. „Realität der Welt, welcher Ordnung sie auch angehören mag, … kommt nicht anders zur Geltung als innerhalb einer Seins- und damit auch einer S i n n-vorgabe der Vernunft … Deshalb hat eine eigene Wissenschaft über diese Vorgabe zu wachen, sie zu prüfen und zu rechtfertigen: die Philosophie.“95 Wenn von Balthasar ‚der Philosophie‘ diese Aufgabe zuspricht, so steht dabei, daran sei noch einmal erinnert, sein Konzept der Integration von Philosophie und Theologie immer schon im Hintergrund: „Indem Philosophie die Voraussetzungen für die sinnstiftende und sinnspendende Funktion der Vernunft in deren Offensein für die Allheit des Sein entdeckt, mit dieser Allheit aber notwendig der Gedanke des absoluten und göttlichen Seins auftaucht, grenzt Philosophie notwendig an Religion, wenn sie nicht gar, in ihrer eigenen Tiefe, ineinsgesetzt wird mit der gedanklichen Seite der Religion oder, was dann auf das Gleiche herauskommt, mit der ‚natürlichen Theologie‘.“96
Damit sind wir nun wieder bei der am Ausgangspunkt dieser Überlegungen stehenden Kritik Balthasars angelangt. Diese ihr eigentliches Wesen ausmachende Vermittlungsaufgabe erfüllt die neuzeitliche Philosophie seiner Überzeugung nach nämlich in keiner Weise. Im Gegenteil: Sie hat die ihr anvertraute metaphysische Grundfrage vergessen, sodass die „auf sinnliche Empirie beschränkte Vernunft … von da ab (begann), sich mit Naturwissenschaften die Zeit zu vertreiben, in der sie es weit gebracht hat, so weit, daß sie heute die fortvegitierende philosophische Frage in sich hinein absorbiert und zum Schweigen bringt.“97
Noch einmal: Nicht die naturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Welt als solche ist im Sinne Balthasars philosophisch und vor allem theologisch in Frage zu stellen. Wohl aber die weitgehende perspektivische Beschränkung, in der sie geschieht. „Die Menschheit heute ringt mit dem materiellen Kosmos, um ihn zu beherrschen. Das ist ein Teil ihrer Bestimmung, der durch die Wege der Metaphysik den Schein der Ganzheit erhielt“.98 Die neuzeitliche Bewegung der sogenannten ‚anthropologischen Wende‘, die einen gerade auch aus schöpfungstheologischer Sicht berechtigten Sinn als bewusste Annahme der dem Menschen von Gott zugedachten Stellung innerhalb der Schöpfung hat, wird demnach durch die Verabsolutierung der horizontalen, i. e. weltimmanenten, Dimension zu einer „anthropologischen Reduktion“99 pervertiert. Mit dieser Formel ist nach Balthasar die Grundsignatur unserer Zeit erfasst. „Der Konstruktionspunkt von dem aus die Welt und das Wissen um die Wirklichkeit entworfen wird, ist die Subjektivität des Menschen.“100 Der Mensch ist damit letzter Bezugspunkt. „Ihn vom Sein umgriffen … zu denken ist müßig, es sei denn, man beziehe dieses Sein auf den schöpferischen und geistigen Gott, der im System ein Fremdkörper bleibt.“101 Seinsblindheit ist bei Balthasar daher gleichbedeutend mit Gottesblindheit.102
Dem Denken bleiben logisch jetzt nur zwei Wege: Entweder die atheistische Leugnung Gottes, womit das System ‚bereinigt‘ wäre oder aber die systematische ‚Anpassung Gottes‘, indem er dem menschlichen Denken auf einem der beiden Wege des Rationalismus oder des pantheistischen Idealismus unterstellt wird. In diesem Sinn wirft Balthasar der neuscholastischen Theologie denn auch vor, in ein „Bewältigungsdenken“103 verfallen zu sein, was seiner Auffassung nach einer Selbstauflösung in eine positivistische Wissenschaft gleichkommt. Gott wird dem menschlichen Denken scheinbar verfügbar, so wie auch weltliche Dinge ihm verfügbar sind. Dies aber hat fatale Konsequenzen, denn „wo die Frage untergeht, hat die Antwort keine Chance mehr, aufzutreffen.“104 Wo die Welt nicht mehr nach Gott fragt, da kann Gottes (Ant) Wort nicht mehr an sie ergehen. Was dann dennoch über Gott gesagt wird, ist letztlich nichts anderes als menschliches Wort, das sich in seiner Hybris unweigerlich selbst entlarven muss. „Wenn es schon für den echt bekümmerten und existentiell fragenden Laien eine solche [oft kaum zumutbare] Belastung ist, sonntags von einem je-schon-bescheidwissenden Kleriker über Gott aufgeklärt zu werden, so läßt sich verstehen, warum sich die Welt eines Tages als hinreichend über Gott aufgeklärt gefühlt und deklariert hat und wie es ihr verleidet worden ist, die Frage zu stellen, die, in die stereotypen Katechismusfragen hineinkanalisiert, die ebenso stereotypen Antworten bereitfindet.“105 Balthasar spricht in diesem Zusammenhang von einem neuscholastischen Zirkel innerhalb dessen modernes Denken zwischen Seins- und Gottvergessenheit kreist.106 Soll die Frage nach Gott und damit die Ansprechbarkeit des Menschen für Gott in der Welt nicht endgültig verstummen, so gibt es seiner Überzeugung nach nur einen einzigen Ausweg, nämlich den der Neubelebung der Seinsfrage, weil „das Christliche immer wieder nur als Antwort auf die Seinsfrage im Ganzen … sich den Menschen plausibel machen kann. Wo die Seinsfrage nicht ertönt, wird die Theologie mysterienlos-positivistisch.“107
Damit sind wir nun beim eigentlich Originären des balthasarschen Denkansatzes angelangt. Wenn im Folgenden von seiner Neubelebung der Seinsfrage die Rede sein wird, so darf darunter keinesfalls eine Renaissance der antiken Metaphysik, gleichsam ein Schritt zurück hinter neuscholastisches Denken, hin zu den griechischen Wurzeln gedacht werden.108 Balthasar will nicht etwa das Rad der Geschichte zurückdrehen; vielmehr verfolgt er ausdrücklich einen theoretischen Neuansatz. Sein Grundgedanke dabei ist, dass Meta-Physik für uns heute eben nicht mehr „den Akt des Überstiegs über die Physis besagt, die für die Griechen den ganzen Kosmos umfaßte, von dem der Mensch ein Teil war. … Der Kosmos vollendet sich für uns im Menschen, der zugleich Zusammenfassung der Welt ist und ihr Überstieg.“109 Diese veränderte Weltsicht macht es unabdingbar, die Seinsfrage aus einer entsprechend veränderten Blickrichtung anzugehen. „Unsere Philosophie wird also wesentlich eine Meta-Anthropologie sein, die nicht nur die kosmologischen, sondern auch die anthropologischen Wissenschaften zur Vorraussetzung hat und sie auf die Seins- und Wesensfrage des Menschen hin übersteigt.“110 Balthasar tritt also an, die klassische Seinslehre von der existenzialen111 Verfasstheit des Menschen her neu zu durchdringen, „wobei alle früher gestellten Grundfragen der Philosophie ein neues Gesicht erhalten“112.
An dieser Stelle ist es nun aus einem doppelten Grund unerlässlich, den Versuch zu unternehmen, die unterschiedlichen, stark miteinander verwobenen Dimensionen der Gedankenführung Balthasars offen zu legen. Zunächst einmal führen sie natürlich zu seinem Verständnis von Sein, das es hier ja zu ergründen gilt. Weil aber, wie dargelegt, nach balthasarscher Überzeugung auch und gerade die Theologie untrennbar an die metaphysische respektive meta-anthroplogische Urfrage gebunden ist, ergeben sich die wesentlichen originären inhaltlichen wie methodischen Grundzüge seiner Theologie notwendig aus seinem Umgang mit der Seinsfrage. Mit anderen Worten: Gelingt es, das Seinsverständnis Balthasars zu erschließen, so ist damit bereits auch Wesentliches bezüglich seines Theologieverständnisses zumindest markiert. Nur darum kann und soll es an dieser Stelle gehen. Die einzelnen, sich mit diesem Seinsverständnis eröffnenden theologischen Gehalte, gilt es dann im weiteren Verlauf der vorliegenden Untersuchung im Hinblick auf die Höllenthematik eingehend zu bedenken.