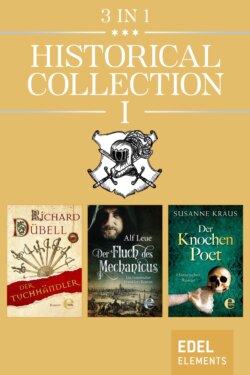Читать книгу Historical Collection I - Susanne Krauß - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеUm die Vesperstunde war die polnische Gräfin begraben, ein Gebet aus dem Munde meines Verwalters gesprochen und der junge Löw samt dem Totengräber wieder zurück in der Stadt. Die Ermordete ruhte nun, ihr Leib beschützt von einem schlichten hölzernen Kreuz, neben Maria und meinem vierten Kind. Ich hatte mich davor gefürchtet, der Arbeit eines Totengräbers an diesem Ort zuzusehen, der zugleich meine Vergangenheit und meine Zukunft unter feuchter Erde begraben hielt; aber es war weniger schlimm gewesen, als ich gedacht hatte. Tatsächlich fühlte ich eine vage Beruhigung, als der Totengräber den niedrigen Erdhügel über dem Leichnam festklopfte, sich dann aufrichtete und das Kreuzzeichen schlug. Ich dachte: Herr, ich habe meine Schuldigkeit an ihr getan, und es wurde mir ein wenig leichter ums Herz. Der Verwalter begleitete mich zurück zum Wohngebäude. Wir nahmen eine schweigende Mahlzeit inmitten meines aus der Stadt wieder heimgekehrten Gesindes ein, dem unsere Stille inmitten ihres aufgeregten Stimmengewirrs und ihrer fröhlichen Erzählungen über die Gewaltigkeit des neuen Kirchenbaus nicht auffiel. Nach dem Essen war ich endlich allein, und ich war dankbar dafür.
Ich fuhr mir mit der Hand über das Gesicht und spürte die Taubheit meiner Haut; als ich die Augen schloß, war es ein gutes Gefühl, sie geschlossen zu halten. Ich versuchte, meine nächsten Schritte zu planen, aber meine Gedanken glichen einem wilden Strudel. Es gab nur noch eine Aufgabe, für die ich heute genügend Energie übrig hatte. Ich schickte nach meinen Verwalter.
»Wollt Ihr noch die Unterlagen wegen des Stoffgeschäftes mit mir durchgehen?« fragte er. Ich schüttelte den Kopf.
»Nein, ich bin zu müde«, sagte ich. »Ich wollte dir nur mitteilen, daß ich in der Stadt eine Messe für meine verstorbene Frau bestellt habe; ich will ihr noch beiwohnen, dann komme ich zurück und gehe zu Bett. Wir sprechen uns morgen über unser weiteres Vorgehen ab.«
»Ich werde das Gesinde ein Paternoster für Eure Frau beten lassen.«
»Ich danke dir«, sagte ich. Er zuckte mit den Schultern. Ich sah in sein Gesicht und ahnte seine nächste Frage voraus.
»Laß zwei Paternoster beten«, ordnete ich an, und er nickte betrübt, ohne den wirklichen Grund für meine grimmige Miene zu verstehen. Ich schritt aus der Stube, ohne mich noch einmal umzusehen, zog mich um, bestieg mein Pferd und ritt zur Stadt.
Die ganze Zeit während der kurzen Messe in der Kirche zum Heiligen Geist vermochte ich den Frieden nicht zu finden, der sich in den letzten Jahren beim Besuch von Marias Totenmessen nach und nach eingestellt hatte. Es waren die einzigen Gelegenheiten, zu denen ich die Heilige Messe besuchte, seit ich Bischof Peter verlassen hatte: die Totengedenken an meine Frau. Ich zahlte dem Priester einen großzügigen Betrag, nachdem die späten Kirchenbesucher den Bau verlassen hatten, und vernahm seinen Segenswunsch, ohne ihn wirklich zu hören. Als ich die Geschichte mit der heimlichen Geliebten erfunden hatte, war mir niemals in den Sinn gekommen, daß ich damit das Andenken an Maria beschmutzen könnte. Nicht einmal während der Beerdigung der Getöteten auf meinem privaten Gottesacker hatte sich dieser Gedanke eingestellt. Jetzt, in der kalten Kirche, umgeben vom Duft des Weihrauchs und dem Gemurmel der alten Weiber, die sich uneingeladen zu der Messe eingefunden hatten und die weder mich noch Maria jemals gekannt hatten, plagte mich dieser Gedanke mit aller Macht.
Ich ritt bedrückt durch die Dunkelheit nach Hause, begleitet von etlichen Bauernkarren, deren Lenker dem Wein in den städtischen Schenken zu lange zugesprochen hatten. Der Roßknecht nahm mein Pferd in Empfang und stellte es im Stall unter, und ich begab mich in meine Schlafkammer, ohne nochmals die Stube aufzusuchen. Ich schlüpfte unter die Decke und schloß die Türen des Bettkastens. Eine Weile starrte ich in die absolute Finsternis und war trotz meiner Erschöpfung sicher, keinen Schlaf finden zu können; aber der Körper forderte sein Recht und zog mich in die Bewußtlosigkeit hinunter.
Einmal wachte ich auf und glaubte, daß es erneut an meiner Schlafkammertür gepocht hatte, und ich lag verkrampft unter der Decke und spürte, wie mir der Schweiß ausbrach. Am nächsten Morgen erwachte ich mit den ersten Rufen der Hähne. Ich hatte eine vage Erinnerung an einen Traum, in dem ich mit Maria am frischen Grab der toten Polin stand und Maria mit zärtlicher Sorgfalt ein kleines Sträußlein Wiesenblumen auf den niedrigen Erdhügel legte, und ich spürte mit der Hand über mein Gesicht, erfühlte die Spuren nächtlicher, unbewußt vergossener Tränen und fühlte mir verziehen.
Die Sonne wurde des Nebels an diesem Morgen schneller Herr, und als sich die letzten weißen Fetzen auflösten, kletterte ich auf mein Pferd und machte mich auf den Weg zur Stadt. Das Wetter versprach einen herrlichen, spätherbstlichen Tag, dessen Luft jene Klarheit hatte, die ich an dem feuchten Klima meiner Wahlheimat zumeist vermißte. In Augsburg, wo ich aufgewachsen war und von wo mich der Unmut des Bischofs vertrieben hatte, waren solche Tage im Frühling und im Herbst die Regel gewesen; hier in Landshut waren sie die Ausnahme. In Augsburg hatte ich oftmals vom Turm des Doms aus die zartblauen Umrisse der fernen Berge gesehen, die durch irgendeinen Zauber oder durch eine merkwürdige Zusammensetzung der Luftschichten in eine beinahe greifbare Nähe gerückt waren. In Landshut war mir dies bisher nur einmal geschehen, an einem Tag, der den Himmel in Flammenfarben getaucht hatte und an dem sich mein Gesinde fortwährend bekreuzigte und über schlechte Vorzeichen murmelte, während mein Verwalter ein sauertöpfisches Gesicht machte und über Kopfschmerzen klagte. Vielleicht hätte man heute in Augsburg das Blinken der schneebedeckten Bergflanken wieder gesehen. Hier reichte es zumindest aus, die prächtigen Bauten der Stadt klar und wie frisch gewaschen dem Betrachter zu präsentieren.
Das Land, auf dem mein Hof lag, befand sich inmitten des weiten Isartales. Bis zum Bau des Zisterzienserinnenklosters mußte es eine gewaltige sumpfige Wiese gewesen sein, die der Pfettrachbach in regelmäßigen Abständen überschwemmte und die nur die wenigen kleinen Anwesen der Landpächter ernährte, die sich darum gruppierten. Die Bauarbeiten des Klosters hatten dazu geführt, daß sich Tagelöhner und Handwerker vor seinen Toren ansiedelten, die durch Entwässerungen und Uferbefestigungen das Säldental nutzbar machten. Heute war zwischen dem Tor des Frauenkonvents und der Stadtmauer kaum noch eine freie Fläche zu finden. In der anderen Richtung hingegen, nach Norden, lagen außer meinem umfangreichen Landstück nur noch wenige kleine Bauernkaten, die sich bis zu den nördlichen Hängen des Isartales verstreuten. Sie bildeten zusammen mit meinem Land, dem Kloster und den Heimen der vom Wirtschaftsbetrieb des Klosters Lebenden ein immer dichter werdendes Netz von Wohnstätten, das schließlich zur Stadt selbst hinführte.
Mit den Außenbezirken mochten etwa zehntausend Menschen in Landshut leben. Auf einem kiesigen Schwemmlandstück zwischen der in ihrem flachen Bett vielfach verzweigten Isar und den steilen Abhängen der südlichen Hangleiten gelegen, vermittelte die Stadt ihren Bewohnern das angenehme Gefühl der Sicherheit, das denjenigen beschert ist, die sich von allen Seiten behütet wissen. Sichtbarer Ausdruck dieses Gefühls war der sorglose Umgang mit der Stadtmauer, in deren langgestreckte Trapezform nicht nur Tore in jede Himmelsrichtung gebrochen waren, sondern auch eine Anzahl kleinerer Mannlöcher, die von verschiedenen Zünften benutzt wurden, deren Arbeitsplätze direkt außerhalb der Stadtmauern lagen.
Mit der neuerbauten Kirche zum Heiligen Geist an ihrem Nordende, dem emporstrebenden Martinsdom im Süden und der Kirche des Sankt Jobst im äußersten Osten beherbergte die Herzogsstadt drei gewaltige Sakralbauten in ihren Mauern; dazu die drei Klöster der Franziskaner, der Dominikaner und der Malteser. Jeder weiß, daß nur der Reichtum einer Stadt die Barfüßerorden anzieht; wem dies aber noch nicht als Beweis für den Wohlstand der Herzogsstadt genügte, mochte sich die Viertel ansehen, die die Häuser der Bewohner aufnahmen.
Auf der Kiesaufschüttung im Süden, auf der die Stadt ursprünglich entstanden war, lagen die Quartiere der herzoglichen Waffen- und Rüstungsschmiede und die Wirtschaftsgebäude der Burg. Die Stadtwohnung des Herzogs bildete dort ein zusätzliches, fast eigenes Viertel, das Herzog Ludwig von seinem Vater Heinrich übernommen und weiter ausgebaut hatte. Die Häuser der herzoglichen Beamten schlossen sich daran an und zogen sich bis zum Fuß des Martinsdoms. Danach führte die Hauptstraße, die man allgemein als Altstadt bezeichnete, mit ihren reichen Bürgerhäusern und deren eigenwilligen Laubengängen, mit Lagerhäusern, Gasthöfen und Handelsgewerben geradewegs in Richtung Norden bis zum Spitaler Turm, jenem Torbau, der den innersten Bereich der Stadt nochmals zum Hospiz und der Heilig-Geist-Kirche hin abschirmte. Parallel zu ihr lief die Neustadt, ebenso von hochaufragenden, bunten Fassaden der Patrizierhäuser eingerahmt, deren Besitzer ihre bisherigen Gebäude in der Altstadt verkauft hatten, um in der Neustadt größer und prunkvoller bauen zu können. Zuletzt war die Freyung um die Kirche des Heiligen Jobst entstanden, ein steuerfreier Bereich, der die dort neu angesiedelten Bürger für zehn Jahre von sämtlichen Abgaben befreit hatte.
Unter seinen Vorgängern war Landshut gewachsen; mit Herzog Heinrich, dem Vater des jetzigen Herzogs, war um die Jahrhundertwende der Wohlstand in die Stadt gekommen; sein Beiname war noch zu seinen Lebzeiten »der Reiche« gewesen. Sein Sohn Ludwig teilte sich mit ihm diese Ehre. Der junge Georg würde dereinst einen Pfrund erben, angesichts dessen Kaiser und Könige vor Neid erblassen konnten und der einen nicht zu unterschätzenden Machtfaktor im Flickwerkgefüge des Reichs darstellte. Herzog Ludwig hatte sich bereits einmal gegen Kaiser Friedrich gestellt und sich als Königsmacher zu etablieren versucht; damit hatte er einen der Anstöße zu jenem Krieg gegeben, in dessen Auswirkungen auch ich vor zwölf Jahren hineingezogen worden war. Nicht wenige munkelten, daß er mit der bevorstehenden Verheiratung seines Sohnes einen neuerlichen Versuch dazu wagen mochte, des Kaisers Macht zu beschneiden. Es war die Art von Gerede, das immer dann voller Häme in die Welt gesetzt wird, wenn ein Mächtiger von seiner persönlichen Statur her nicht imstande scheint, sein großes Amt auszufüllen; und Kaiser Friedrich, der die meiste Zeit mit alchemistischen Übungen am Hof zu Graz verbrachte, schien eine geradezu auserlesene Zielscheibe dafür zu sein.
Die Stadt konnte von derlei Gerede nur profitieren; in ihrem Herzen arbeiteten schon jetzt, weniger als eine Generation nach Herzog Heinrichs des Reichen Tod, die besten Schnitzer, Goldschmiede und Rüstungsmacher in weitem Umkreis, zudem zwei der verehrtesten Baumeister der Zeit. Außerhalb der Stadtmauer hatte sich der ausgedehnte Bereich der Handwerker etabliert, deren Kunstfertigkeit sie über die Grenzen ihres Herzogtums hinaus bekannt werden ließ. Zuletzt hatten sich die Tuchmacher mit ihren Bleichmühlen auf dem südwestlichen Ende der großen Flußinsel niedergelassen, zwischen den hölzernen Isarbrücken, über die die Straße nach Norden hinaus führte. Nicht wenige Kaufleute erwarteten, daß ihre Produkte bald den Venezianer Stoffen den Rang ablaufen würden. In dieser Hinsicht war ich skeptisch, aber das Ansehen der Tuchmachergilde war so groß, daß man für ihre Mühlen einen Kanal quer über die Flußinsel gegraben und danach ein eigenes kleines Türchen in der Nähe des Zerrertores in die Stadtmauer gebrochen hatte, damit sie diese bequem erreichen konnten. Sie stellten ihre eigene Wache dafür und hüteten auch selbst dessen Schlüssel.
Es war nicht zu bezweifeln, daß die Stadt, die vor mir im Herbstsonnenschein lag, bald zu den mächtigsten und schönsten im Deutschen Reiche zählen würde.
Solange nichts Unvorhergesehenes passierte.
Herzog Ludwig hatte sein Stadthaus für die polnische Delegation zur Verfügung gestellt. Die weiträumigen Gebäude mit einem Innenhof bildeten fast ein kleines Dorf für sich innerhalb der Stadtgrenzen; oder eher eine Festung, die in ihrem Grundriß der Burg auf dem steilen Hügel überhalb der Stadt glich. Tatsächlich galt dort der Burgfrieden als Gesetz, nicht die Statuten der Stadt, und hätten sich die Landshuter Bürger zu der Dummheit verstiegen, den Herzog in seinem Stadthaus belagern zu wollen, hätte er es mit seinem Gefolge eine ganze Weile darin ausgehalten, bevor die Lage für ihn ernst geworden wäre. Es gab mehrere Wirtschaftsgebäude, Stallungen und kleinere Vorratsspeicher und ein wuchtiges Wohngebäude, in dem sich eine gut bestückte Rüstkammer verbarg. Hier befand sich auch der Eingang, direkt neben den gewaltigen hölzernen Schließflügeln des Ländtores. Vor seiner Bebauung hatte man das Gebiet Krähenland geheißen. Der Name schien mir nicht schlecht gewählt. Heute erhoben sich dort neben dem Herzogshof die Häuser der meisten höhergestellten Beamten Ludwigs des Reichen, die einem in ihren dunklen Prachtgewändern und ihren blasierten Gesichtern ebenfalls wie Krähen vorkamen; gleich ihnen stocherten sie ihren Lebensunterhalt aus dem Mist der größeren Tiere. Das Haus des Doktor Mair war auch dort zu finden, mit seiner Vorderfront zum Neubau des Doms weisend, mit seinem hinteren Teil direkt an die Gebäude des Herzogs angrenzend. Neben der ehemaligen jüdischen Synagoge hatte der Herzog seinen Hauptkasten errichten lassen, ein gewaltiges Lagerhaus, in dem die Zehntleistungen seiner Untertanen einlagert wurden und das erst vor fünf Jahren endgültig fertiggestellt worden war – immerhin zwanzig Jahre, nachdem Ludwig der Reiche den Herzogsstuhl in Besitz genommen hatte. Das gesamte Süd viertel der Stadt diente dem Unterhalt und dem Betrieb der Burg, die über ihm dräute. Es war kein Wunder, daß es die Beamten des Herzogs für richtig gehalten hatten, die polnischen Ritter dort einzuquartieren.
Die Polen hatten sich ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten in ihrem Bereich geschaffen; sie hatten sogar Wachen vor dem Zugangstor stehen, die den Eintritt nach ihrem Gutdünken verweigerten. Es war die zweite Kontrolle, die ich zu passieren hatte: Eine in einem lockeren Ring um die Residenz des Herzogs angelegte Patrouille hatte mich schon am Anfang der zum Ländtor führenden Gasse abgefangen und kurz befragt. Moniwids Namen kannten sie; nach kurzer Beratung mit einem Leutnant, der aus seinem Quartier neben Doktor Mairs Haus kam, ließen sie mich durch. Auch sie waren Ortsfremde und sprachen im schleppenden Dialekt des oberen Rottals.
Die Wache der Polen bestand aus drei Männern, die mich mit geschwollenen Augen musterten und die dem Anschein nach die Freigebigkeit des Herzogs in der letzten Nacht an seinen Weinvorräten erprobt hatten; sie waren entsprechend schlecht gelaunt und übernächtigt. Ich mußte einigen Nachdruck in meine Bitte legen, zu Albert Moniwid vorgelassen zu werden, bis sich einer von ihnen bequemte, den Anführer der Gesandtschaft selbst zu fragen. Er kroch mit aufreizender Langsamkeit über den strohbestreuten Innenhof und verschwand um die Ecke des Wohngebäudes. Keiner der Männer sprach bayrisch – ebensowenig wie Latein. Es war kein leichtes gewesen, ihnen den Zweck meines Besuchs klarzumachen. Während wir auf die Rückkehr des Boten warteten, sahen mich die übriggebliebenen Wachen ungnädig und schweigsam an. Ab und zu warfen sie sich Bemerkungen auf polnisch zu, und ich hatte den Verdacht, daß sie wenig Schmeichelhaftes über meine Person enthielten. Schließlich kehrte der dritte Wächter zurück und machte mir klar, daß er mich zu Herrn Moniwid bringen würde. Ich ließ mein Pferd in der Obhut der Wächter zurück. Die Kennerblicke und zärtlichen Gesten, mit denen sie es zu einem Pferch führten, verrieten mir, daß sie zwar ungeschlachte Kerle, aber doch wenigstens Pferdekenner waren.
Der Boden im Innenhof bestand aus festgestampftem Lehm, den man mit Stroh und Reisig aufgestreut hatte. Das feuchte Herbstwetter und die vielen Pferdehufe und Stiefel hatten ihn in eine Landschaft verwandelt, die einem frisch gepflügten Feld glich. Zahlreiche Pfützen und Lachen glänzten im Sonnenlicht. Es war ein enger Hof, bedrängt durch den wuchtigen Bau des Wohngebäudes zur Linken und die Wirtschaftsgebäude am jenseitigen Ende. Nur ein Teil davon war von der Sonne beschienen; der hohe Giebel des Wohngebäudes warf seinen schweren Schatten über den Rest.
Der Enge zum Trotz hatten die Polen den Innenhof in ein Übungsgelände für die bevorstehenden Turniere verwandelt. Eine Stechpuppe stand im hinteren Drittel, die untere Hälfte bereits vom Schatten des Wohnhauses verdunkelt: ein Sandsack mit einem verbeulten Helm obenauf und einer langen Stange, die an der Stelle durch den Sandsack gesteckt war, an der sich bei einem Menschen die Arme befunden hätten. Das eine Ende der Stange trug einen kleinen runden Schild, das andere Ende einen freischwingenden Dreschflegel. Die Basis der Puppe ruhte in einer einfachen Mechanik, die es ihr gestattete, sich um ihre senkrechte Achse zu drehen: Wer an den kleinen Schild stieß, löste damit unweigerlich ein schnelles Herumschwingen der Puppe und des Dreschflegels am anderen Ende der Stange aus. Die Puppe diente dazu, die Geschicklichkeit des Turnierreiters zu festigen und zu erhöhen. Sie war ein sinnvolles Instrument – sie übernahm die Bestrafung des Ungeschickten selbst, sofort und mit unparteiischer Grobheit. Als ich zum Hof hereintrat, sah ich eben einen der Polen in einem leichten Lederhaubert gegen die Puppe anrennen. Er traf den Schild exakt, aber das Aufprallgeräusch der hölzernen Lanzenspitze erschreckte sein Pferd, und anstatt weiterzurennen, stemmte es für einen kurzen Augenblick die Hufe in den Boden. Der Dreschflegel schwang mit täuschender Trägheit herum, der Übende versuchte sich zu ducken, und dann kamen mit einem trockenen Geräusch Flegel und Kopf in Berührung. Das Pferd machte einen Satz, daß der Reiter beinahe aus dem Sattel gefallen wäre, und alle Umstehenden grinsten. Er fand sein Gleichgewicht wieder, faßte sich an seinen schmerzenden Hinterkopf und sah sich mißmutig um. Ich erkannte mit Vergnügen, daß der Reiter Albert Moniwid selbst war.
Er steckte die Lanze in einen Halter, faßte die Zügel und trabte aus der Übungsbahn, um einem anderen Mann Platz zu machen. Sein Nachfolger hatte mehr Glück: Auch er traf den Schild, aber sein Pferd blieb gelassen und trug ihn sicher aus der Bahn des herumschwingenden Dreschflegels. Die Puppe drehte sich ein paarmal um sich selbst, bis sie von zwei herbeieilenden Knappen wieder ruhiggestellt wurde. Der polnische Ritter wendete sein Pferd mit bewundernswerter Geschicklichkeit in vollem Lauf in dem engen Hof und sprengte mit einem triumphierenden Aufschrei an der Stechpuppe vorbei zurück zu seinen Genossen. Moniwid nickte, dann lenkte er sein Pferd auf mich zu, noch immer die Beule an seinem Kopf reibend. Mir war klar, daß er mich mit seinem Auftritt hatte beeindrucken wollen. Daß es ihm nicht gelungen war, konnte seine mürrische Laune kaum verbessern. Sein Gaul war hochnervös, und ich kannte mich mit Pferden genügend aus, um erkennen zu können, daß es schwierig genug gewesen war, ihn mit der bedrohlichen Lanze direkt neben seinem Kopf auch nur halbwegs gerade auf die Puppe losgaloppieren zu lassen, aber ich hatte keine Lust, dem Polen dafür den angebrachten Respekt zu bezeigen. Ich sah schweigend zu ihm empor. Er verzog das Gesicht und sagte: »Die Beule schinerzt fast so sehr wie Euer Anblick, Herr Kaufmann. Was wollt Ihr von mir?«
»Ich muß mit Euch sprechen.«
»Habt Ihr den Mörder etwa schon gefunden?«
Ich sah zu ihm hinauf, groß und mächtig auf seinem wuchtigen Streitroß sitzend. Ich fragte mich, ob ich den Gaul mit jener famosen goldenen Decke vor mir hatte, die in Wittenberg genug Aufsehen erregt hatte, daß sich der Tratsch bis in Hanns Altdorf ers Amtsstube fortgepflanzt hatte. Das Pferd liebte es nicht stillzustehen und tänzelte unruhig von einem Fuß auf den anderen. Moniwid hielt die Zügel straff angezogen, so daß der Unterkiefer des Tieres eng gegen seinen Hals gepreßt wurde. Die Luft zum Atmen wurde ihm dadurch knapp, und es versuchte sich zu befreien; es würde erst später begreifen, daß es keinen Sinn hatte, sich gegen seinen Reiter behaupten zu wollen. Der Ritter parierte die Ausbruchsversuche seines Pferdes mit instinktiven Körperbewegungen, und so wurde nicht mehr als das aufgebrachte Tänzeln daraus; man konnte daran erkennen, daß er tatsächlich ein ausgezeichneter Reiter und im Turnier wahrscheinlich ein furchterregender Gegner war.
Ich kniff die Augen zusammen und sagte ruhig: »Natürlich nicht.«
»Natürlich«, höhnte er. »Welchem Umstand verdanke ich es dann, daß Euer Weg bei mir vorbeiführt?«
»Es gibt etwas, das ich Euch berichten muß.«
»Dann fangt an.«
»Hier?«
»Was habt Ihr gegen diesen Platz einzuwenden? Er wurde uns von Eurem Herrn zugewiesen; ich wußte nicht, daß er einem Landshuter Kaufmann nicht passend erscheint.«
»Soll ich die widerwärtigen Details über den ganzen Hof schreien?« rief ich aufgebracht. »Was man Eurer edlen Gräfin alles angetan hat?«
Seine Augenbrauen senkten sich und verwandelten seine Augen in schmale Schlitze. Ich sah das Zornesfunkeln darin; aber wenigstens stieg er nun ab. Das Pferd, von seiner Last befreit, versuchte, auf der Hinterhand hochzusteigen, und der Pole wurde ein paar Schritte weit von ihm mitgerissen, bis er es wieder mit den Vorderbeinen auf den Boden gezwungen hatte. Einer der Knappen, die vorhin die Stechpuppe ruhiggestellt hatten, lief durch die Pfützen auf ihn zu und nahm ihm die Zügel ab. Es fiel ihm noch schwerer als Moniwid, das Tier in die Richtung davonzuzerren, in der er es haben wollte.
Albert Moniwid marschierte mit brüsken Schritten zu mir zurück. Als er vor mir stand, wies er hinter sich.
»Die Turniere sind nicht mehr weit, und wir müssen unsere Pferde einreiten. Von den sogenannten bayrischen Rittern wird nicht mehr viel übrigbleiben, wenn wir in die Planken gehen.«
Ich verzog achtlos den Mund, und er sah sich genötigt, noch etwas hinzuzufügen: »Ich habe gehört, Herzog Christoph der Starke wird bei den Turnieren kämpfen. Er ist ein ganz und gar gottloser, aufgeblasener Popanz. Ich habe mir vorgenommen, ihn in Grund und Boden zu rennen; Ihr stört mich bei meinen Übungen.«
»Herr Moniwid, wenn wir den Mörder nicht fassen, wird es keine Hochzeit und kein Turnier geben. Ihr wolltet dafür sorgen; erinnert Ihr Euch?«
»Pah«, winkte er ab. »Dann werde ich ihn auf dem Schlachtfeld treffen, und die Waffen werden scharf sein. Um so besser.«
»Wollt Ihr nun hören, was ich Euch zu sagen habe?«
»In Gottes Namen; sprecht, Herr Kaufmann.«
»Die Dame wurde erdrosselt, bis sie offensichtlich das Bewußtsein verlor; sodann wurde ihr das Genick gebrochen. Danach bediente sich der Täter irgendeines Werkzeuges, damit die Tat nach einer Vergewaltigung aussah. Tatsächlich hat eine solche niemals stattgefunden.« Es hörte sich nicht richtig an; ich wollte hinzufügen: Jedenfalls nicht in dem üblichen Sinne, aber an seinem Gesicht konnte ich erkennen, daß er verstanden hatte. Er schwieg eine lange Weile, nachdem ich zu Ende gesprochen hatte, und währenddessen schien er mein Gesicht scharf zu mustern. Seine Wangenmuskeln zuckten dabei, und über seine Züge huschten Gedanken wie finstere Schatten.
Nach einigen Momenten erkannte ich, daß er nicht ob der neuen Details sprachlos war; sein Schweigen hatte einen viel profaneren Grund. Er versuchte, sich darüber klar zu werden, ob ich ihm nicht einen Bären aufband. Ich konnte förmlich den inneren Kampf sehen, den er mit sich ausfocht. Es brauchte eine geraume Zeit, bis er sich zu dem Entschluß durchrang, daß ich die Wahrheit gesagt hatte.
»Was hat das zu bedeuten?« fragte er rauh.
»Herr Moniwid«, sagte ich ruhig. »Es ist kein Zufall, daß die Nichte des Königs auf diese Art und Weise ums Leben gebracht wurde. Jemand versucht, die Hochzeit Eurer Prinzessin mit unserem Herzogssohn zu verhindern.«
»Warum sollte jemand… ?« rief er laut, und alle Köpfe fuhren zu uns herum. Ich fühlte mich merkwürdig schwindlig, als ich es ausgesprochen hatte. Es war nicht über mich gekommen wie eine Erleuchtung. Seitdem ich heute morgen aufgewacht war und meine Sinne wieder in ruhigeren Bahnen verliefen, fraß dieser Gedanke an mir. Moniwid zog die Luft mit einem scharfen Geräusch durch die Nase ein und fauchte dann zwischen zusammengebissenen Zähnen: »Warum sollte jemand das wollen? Ihr habt den Verstand verloren.«
»Ihr sagtet selbst, daß Ihr nichts dagegen hättet, wenn die Hochzeit abgesagt würde«, erinnerte ich ihn. Er starrte mir ins Gesicht; plötzlich packte er mich und schob mich mit derselben erstaunlichen Leichtigkeit wie schon in der Kirche vor sich her in einen schattigen Winkel des Hofes. Als wir dort angelangt waren, brachte er sein Gesicht so nah wie möglich an das meine und zischte erstickt: »Wenn Ihr damit andeuten wollt, ich hätte womöglich mit diesem Mord zu tun …«
»Das will ich nicht, um Himmels willen«, sagte ich und machte meinen Arm los. »Tatsächlich kam ich nur her, um Euch klarzumachen, daß die Sachlage keineswegs so einfach ist, wie wir bisher dachten.«
Er schnaubte aus. Mit einem heftigen Kopf schütteln beruhigte er sich wieder.
»Was erwartet Ihr jetzt von mir?« fragte er.
»Daß Ihr die Frist verlängert, die Ihr uns gegeben habt.«
»Weshalb sollte ich dies tun?«
»Weshalb?« rief ich verblüfft. »Die Ausgangsvoraussetzungen für den ganzen Fall haben sich geändert!«
»Inwiefern? Die Gräfin Jagiello wurde ermordet.«
»Aber aus gänzlich unterschiedlichen Motiven …«
»Die Motive«, sagte er unwirsch, »die Motive sind nebensächlich. Es kann sich gut um ein Hirngespinst handeln, das Euch befallen hat; sollte es sich aber so verhalten, wie ihr mir geschildert habt, ist die Ungeheuerlichkeit doppelt groß, die einer Eurer Landsleute begangen hat.«
Sein Sticheln hatte den Erfolg, daß ich meine Argumentation vergaß.
»Warum sollte es denn nicht einer von Euren Landsleuten gewesen sein?« erwiderte ich ärgerlich. »Wenn alle hier so denken wie Ihr, scheint es mir sogar recht wahrscheinlich, daß der Täter in diesen Mauern zu finden ist.«
»Das ist eine Frechheit…«, knurrte er.
Ich ermahnte mich zur Ruhe. »Bitte«, sagte ich drängend und breitete die Hände aus. »Es hat keinen Sinn, uns zu streiten. Ich entschuldige mich für meine Worte. Aber bitte denkt nach und laßt einmal die Ressentiments beiseite: Die Möglichkeit, daß der Mörder einer von Euch ist, ist mindestens genauso groß wie die, daß er einer von uns ist. Auf beiden Seiten gibt es wohl Vorbehalte gegen diese Verbindung. Setzt den Termin aus, den Ihr uns gestellt habt. Ich verspreche Euch, daß uns an der Aufklärung des Verbrechens ebensoviel gelegen ist wie Euch. Was habt Ihr davon, uns einem solchen Druck auszusetzen? Wer so arbeitet, macht Fehler, und ich nehme an, daß wir beide dies gerade vermeiden wollen. Wenn wir genügend Zeit haben, kann ich Vertraute finden, die mir helfen werden; im Moment bin ich ganz alleine. Ich kann mich in Ruhe zuerst bei Euren Leuten umhören und dann in der Stadt. Ich bin sicher, wir werden den Mörder einkreisen und zur Strecke bringen.«
Er dachte nicht einmal über meine Worte nach. »Der Termin bleibt«, sagte er hart.
»Warum denn? Bis die Hochzeit vorüber ist und Ihr nach Hause aufbrecht, um Euren König vom Tod seiner Nichte in Kenntnis zu setzen, vergehen noch drei oder vier Wochen. Ich glaube nicht, daß der Prinzessin das Verschwinden ihrer Base auffallen wird; sie hat genügend mit den Feierlichkeiten zu tun, sobald die Hochzeit erst einmal…«
»Der Termin bleibt«, wiederholte er. Ich unterbrach mich und schaute in sein Gesicht. Was ich sah, ließ mich wissen, daß weitere Worte keinen Sinn hatten. Er hatte uns die Daumenschrauben angelegt, und er genoß es zu sehen, wie sie uns peinigten. Schließlich erwachte mein eigener Stolz.
»Also gut«, sagte ich. »Wie sieht es mit einer Befragung Eures Gefolges aus?«
»Der Schuldige ist nicht hier«, knurrte er hartnäckig.
»Bei Gott«, sagte ich nun genauso hart wie er, »jetzt habe ich genug. Ich schmeiße Euch den ganzen Kram vor die Füße. Ich habe Euer Edeldämchen hinter meinem Haus beerdigt, wie es sich gebührt; ich lasse sie wieder ausgraben und hier mitten auf Eurem von Pferdemist stinkenden Hof abladen, und dann macht mit ihr, was Ihr wollt. Und Ihr könnt sicher sein, daß ich und der Notarius und wenn es sein muß auch der Kanzler schon vor Herzog Ludwig und dem Kaiser stehen, während Ihr noch darüber nachdenkt, an welchem ihrer Gliedmaßen ihr sie auf den Friedhof schleifen sollt. Und was der Herzog und der Kaiser über Eure Rolle in dieser ganzen leidigen Angelegenheit erfahren, wird nicht sonderlich viel Positives enthalten.« Ich atmete schwer, als ich geendet hatte; noch während ich sprach, war meine Wut immer größer geworden. Am liebsten hätte ich ihn in diesem Moment ins Gesicht geschlagen.
»Man kann Euch leicht aus der Reserve locken«, sagte Moniwid nüchtern. »Das ist mir schon in der Kirche aufgefallen.«
»Leichter, als Euch zur Zusammenarbeit zu bewegen«, keuchte ich.
»Ihr sollt Euren Willen in dieser Sache haben«, erwiderte er nach einer kurzen Pause. »Fragt meine Leute, aber tut es so, daß nichts über die ganze Geschichte herauskommt. Ich habe das Verschwinden der Gräfin Jagiello damit erklärt, daß die Prinzessin sie sofort zu sich befohlen habe. Ich denke, mein Gefolge hat es mir abgekauft.«
»Ihr setzt mich in Erstaunen, Herr Moniwid«, sagte ich nicht ohne Sarkasmus.
Diesmal zuckte er nur mit den Schultern. »Schließt daraus nicht, daß ich mit Eurer Person oder Euren Landsleuten einverstanden bin. Ich mag es nur, wenn einer sich wacker schlägt.«
»Ich habe schon verstanden«, sagte ich.
Er musterte mich nochmals eindringlich, dann gab er sich einen Ruck.
»Wollt Ihr sogleich anfangen?« fragte er.
»Nein; ich muß mich noch mit Hanns Altdorfer und dem Richter besprechen. Ich komme nach dem Mittag wieder. Bis dahin solltet Ihr Eurem Gefolge erklären, daß ich ein Landshuter Kaufmann bin, der ein paar Handelsbande knüpfen will.«
»Derlei ist verboten, bevor der Hochzeitstroß eintrifft«, erinnerte er mich. »Alle Pfeffersäcke in der Stadt halten sich daran.«
»Ich weiß. Ich bin eben ein wenig ehrgeiziger als meine Zunftgenossen; zumindest könnt Ihr es so darlegen. Das würde auch erklären, warum ich Euch jetzt aufgesucht habe.«
»Ihr hattet es Euch schon zurechtgelegt, nicht wahr?«
Ich hob die Hände, und er grinste widerwillig.
»Einverstanden«, brummte er.
Ich nickte, und wir trennten uns wortlos. Ich war schon aus dem Schatten wieder hinaus in das Sonnenlicht getreten, als er mir nachrief: »He, Herr Kaufmann!«
Ich drehte mich um. Er stand am Rand der Schattenfläche und hatte beide Fäuste in die Hüften gestemmt.
»Der Termin bleibt, hört Ihr?« rief er fast fröhlich. »Der Termin bleibt.«
Ich nickte nochmals und holte mein Pferd.
»Um Gottes willen«, flüsterte Hanns Altdorfer, und seine schlaksige Gestalt, die er in seinen unbequemen Stuhl gefaltet hatte, sackte zusammen. »Bist du dir sicher, daß die Folgerung des jungen Mannes stimmt?«
»Natürlich; ich habe alles selbst nachgeprüft«, knurrte ich. »Was für eine Frage, Hanns! Wie soll ich mir sicher sein? Habe ich in solchen Dingen Erfahrung? Ich glaube ihm einfach; warum sollte er mir eine solche Lüge erzählen?«
Er zuckte mit den Schultern und machte ein unglückliches Gesicht.
»Kannst du dir vorstellen, was das zu bedeuten hat?« flüsterte er.
»Im Augenblick kann ich mir noch nicht einmal recht vorstellen, was der Täter für Gründe hatte.«
»Aber warum diese … diese …«
»Schlächterei?« vollendete ich für ihn. »Vielleicht war es nur ein Verrückter.«
Ich konnte ihm ansehen, daß er innerlich erschauerte. Sein Gesicht war für ein paar Momente ein offenes Buch, als er sich vorzustellen versuchte, was den Täter getrieben haben mochte. Ich beschloß, ihm den Gedanken nahezubringen, mit dem ich heute morgen erwacht war.
»Hast du dir schon einmal überlegt, daß es auch ein gezielter Versuch sein kann, die Hochzeit zum Scheitern zu bringen?« fragte ich. Er riß die Augen auf.
»Denk nur an die Reaktion Moniwids; wer weiß, wie viele von den Polen so denken wie er. Und wie viele Landshuter.«
»Aber eine solche Tat zu begehen, um die Hochzeit zu behindern …«
»Es lohnt sich doch«, sagte ich gelassener, als ich mich fühlte. »Selbst wenn die Hochzeit dadurch nicht verhindert wird, dürfte es die Beziehungen zwischen Kasimir von Polen und Herzog Ludwig deutlich verschlechtern. Moniwid hat gesagt, die Tote sei äußerst beliebt bei Hofe gewesen. In der Politik muß man manchmal in kleinen Schritten planen.«
»Es graust mich, wenn ich dich so reden höre«, warf er mir vor. Ich zuckte mit den Schultern. Er griff mit den Händen vor sich in die Luft, als müßte er den nächsten Gedanken einfangen.
»Aber warum hat der Täter dann nicht selbst … Du weißt, was ich meine; warum hat er sie nicht selbst … berührt?« brachte er hervor. Ich kehrte die Handflächen nach oben. Ich wußte es nicht.
»Und wie brachte er die Gräfin dazu, des Nachts in die Kirche zu kommen? Woher wußte er überhaupt, wer sie war?« ergänzte ich.
»Das ist einfach«, sagte Altdorfer, ohne lange nachzudenken. »Er kannte sie.« Dann verstummte er und sah mich betroffen an.
»Und sie ihn«, sagte ich. »Was darauf hindeutet, daß der Täter unter den Polen zu finden ist.«
»Großer Gott. Hast du schon mit Moniwid gesprochen?«
»Ich komme gerade von ihm. Er hat mir erlaubt, mich unter seinen Leuten umzuhören.«
Er konnte sich nicht verkneifen, die nächste Frage zu stellen. »Glaubst du, er hat selbst etwas damit zu tun?«
»Ich weiß es nicht«, sagte ich ehrlich. »Wenn, dann traut er mir entweder so gut wie gar nichts zu, oder er hofft, auf diese Weise jeden Hinweis auf seine Person zerstreuen zu können.«
»Ich glaube«, sagte Altdorfer dumpf, »wir sollten sofort den Kanzler und den Richter informieren.«
Ich nickte langsam.
»Und sie warnen«, setzte ich hinzu.
Er starrte mich an. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen.
»Was meinst du damit?«
»Wer auch immer der Täter war: Er liegt sicher auf der Lauer und wartet auf den Aufruhr, der nach dem Fund der Toten in der Stadt ausbrechen sollte. Mittlerweile dürfte ihm klar sein, daß seine Absicht durchkreuzt wurde. Entweder er versucht es ein zweites Mal, oder er versucht, die Verschleierung des Mordes ungeschehen zu machen.«
Altdorfer kniff die Augen zusammen und massierte seinen Hals.
»Du denkst, wir sind in Gefahr.«
»Ich halte es für möglich.«
»Um Gottes willen«, stieß er nochmals hervor. »Du sagst das, als würde es dich nichts angehen.«
Ich schnaubte unlustig. Tatsächlich hatte ich seit dem Morgen an nichts anderes mehr gedacht.
»Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden«, sagte Altdorfer mit unsicherer Stimme.
»Ja«, erwiderte ich. »Jetzt haben wir nicht mehr nur Albert Moniwids Drohung als Motivation.«
Wir verließen Hanns Altdorfers Amtsstube und suchten den Richter auf. Es war ein vergeblicher Weg: Einer seiner Schreiber teilte uns mit, Girigel sei noch am Allerheiligentag abends nach Burghausen gerufen worden. Er habe jedoch eine Nachricht für den Stadtkämmerer hinterlassen.
Altdorfer nahm das versiegelte Schreiben entgegen und trug es zu einem Fenster. Während er las, blickte ich ihm über die Schulter. Es waren nur ein paar hastige Zeilen in einer eckigen Handschrift daraufgeworfen, die besagten, daß Richter Girigel hoffe, so schnell wie möglich nach Landshut zurückkehren zu können und daß wir ihn derweilen über die Fortschritte unterrichten möchten; seine Brieftauben stünden uns zur Verfügung. Er hatte unverbindlich formuliert – wir würden das Schreiben zur Not als Legitimation vorweisen können, wenn wir seine Brieftauben wirklich benötigten. Altdorfer rollte es zusammen und wollte es einstecken. Nach einem Moment des Zögerns streckte er es jedoch mir entgegen.
»Du wirst es eher brauchen als ich«, murmelte er.
Der Kanzler war ebensowenig zu erreichen. Nachdem Hanns Altdorfer seinen Namen genannt hatte, führte uns ein Knecht zu seiner Frau, und wir erfuhren, daß der Kanzler in den nächsten Tagen in Eching weilen würde, um die Formalitäten für die letzte Rast der polnischen Prinzessin zu klären. Er ließe uns ausrichten, daß er uns viel Glück für die geschäftliche Transaktion wünsche und bedauere, uns derzeit nicht mit seinem Rat weiterhelfen zu können. Er hatte nicht einmal seine Frau in den Fall eingeweiht. Wir verabschiedeten uns von ihr und kehrten zum Rathaus zurück.
Im Stadtzentrum hatte sich mittlerweile ein staunenswertes Spektakel entwickelt; die breite Altstadt war erfüllt von menschlichem und tierischem Lärm. Ich blieb abrupt stehen, um zu schauen, und Hanns Altdorfer, der unbeeindruckt weitergegangen war, drehte sich zu mir um und lächelte dann. Er sagte etwas, das ich auf Anhieb nicht verstehen konnte, aber seine Geste und die Bewegung seiner Lippen verrieten mir, was er gemeint hatte: »Jetzt geht es los.«
Eine lange Reihe von Bauernkarren zog sich vom Spitaler Tor bis zum Rathaus herauf; ihre hohen, teilweise mit Eisen beschlagenen Räder ratterten erbärmlich über das bucklige Pflaster. Sie bewegten sich im Schrittempo voran, von mächtigen, im Gedränge unruhig werdenden Ochsen gezogen, denen die Pfiffe und die schnalzenden Peitschen der Wagenlenker im Nacken saßen. Die Wagen reihten sich dicht an dicht, und wo sich eine Lücke zwischen ihnen auf tat, wurde sie von einer Schar schnatternder Gänse, kleineren Herden wild ausschlagender Lämmer und aneinandergebundener Kälber ausgefüllt. Sie hatten ihre eigenen Treiber, die mit lauten Rufen und gellendem Pfeifen dafür sorgten, daß die Tiere sich in die richtige Richtung bewegten; da und dort sprangen große dunkle Hunde um die Herden herum und sorgten mit eifrigem Schnappen und heiserem Bellen ebenfalls für Disziplin. Der Treck bewegte sich zäh und stockend voran, kam immer wieder zum Stehen, wenn ein Ochsengespann die Nerven verlor und die Hufe in den Boden stemmte oder ein paar Gänse aus dem Zug ausbrachen, und bog in einer steten Reihe hinter dem Rathaus in die Steckengasse ab. Dutzende von Bürgern standen an der Straße wie ein Empfangskomitee, johlten und klatschten und lachten, und die Scharen von Wappnern, die den Treck links und rechts begleiteten, leisteten mit gebrüllten Befehlen und Flüchen ihren eigenen Beitrag zum allgemeinen Lärm. Das Pflaster war schlüpfrig von den Exkrementen der Tiere, und besonders den aufgeregten Gänsen zog es immer einmal wieder die Füße weg, was von den Umstehenden mit erfreutem Hohngelächter quittiert wurde. Als sich das Gelächter weiter hinten zu einem Beifallssturm steigerte und dazwischen eine Serie von ganz und gar gotteslästerlichen Flüchen zu hören war, wußte ich, daß dort einer der Wappner das Schicksal der Gänse geteilt hatte.
Hanns Altdorfer kam zu mir zurück und wies auf den Treck.
»Sie sind pünktlich«, rief er mir ins Ohr.
»Weshalb? Was ist das?«
»Das sind die Vorräte für die Hochzeit. Rentmeister Hohenecker hat den Beginn ihrer Anlieferung für den heutigen Tag angefordert. Erstaunlich, daß alles so reibungslos abläuft.«
»Wo kommen sie her?«
»Aus dem ganzen Umland. Jedes Landgericht wurde angewiesen, Hühner, Gänse, Lämmer, Spansauen, Kälber und Eier nach Landshut zu liefern. Die Landrichter und Kastner hatten in ihren jeweiligen Bezirken dafür zu sorgen, daß die herzoglichen Bauern und die Stiftsklöster, deren Vogt unser Herzog ist, die angeforderten Vorräte bereitstellten.«
Die Leute begannen in der Enge zu drängeln, damit ihnen nichts entging. Ich erhielt einen sanften Stoß in die Seite und sah eine magere Frau mit blassem Gesicht, die sich mit einem Bündel an der Brust an mir vorbeidrückte: offensichtlich ein vor nicht allzu langer Zeit geborenes Kind. Zwei weitere Kinder hingen an ihrem Rockzipfel und gafften mit offenen Mündern und laufenden Rotznasen zu den Erwachsenen nach oben. Ich zwinkerte ihnen unbeholfen zu, aber sie zeigten keine Reaktion. Man verlernt den Umgang mit Kindern, wenn die eigenen schon so lange aus dem Hause sind.
»Wo werden die Tiere hingebracht?« fragte ich den Stadtkämmerer. »Zu den Zehrgaden hinter Peter Oberndorfers Haus in der Steckengasse, wo die Vorräte eingelagert werden; wir haben dort Ställe und auch die Küchen aufbauen lassen. Kennst du die Fleischbänke hinter dem Rathaus? Man mußte sie aufbrechen, um genug Platz zu schaffen und die Anrichten nach vorne heraus stellen zu können. Was dort keinen Platz findet, kommt in die Vorratskammern im Brothaus und im Weinhaus, und der Rentmeister hat selbst den Stadel von Wolfgang Leutgeb angemietet, um alles unterzubringen. Die beiden Küchenmeister wetzen sicher gerade ihre Messer.«
»Das müssen Hunderte von Gänsen und Lämmern sein; von den Kälbern gar nicht zu reden.«
»Jedes Gericht hat fünfhundert Gänse und Lämmer zu stellen; dazu alle Spansauen, die in der Zeit anfallen, sowie alle schlachtreifen Kälber. Und das ist nur, was heute anzuliefern ist. Die Landrichter kaufen daneben bei allen Klöstern, Pfarrhöfen und Sedelhöfen an Kapaunen ein, was sie nur bekommen können. Die Jäger und Fischmeister des Herzogs haben Wildbret und Fische zu liefern; seit Tagen sind die Wälder nicht mehr sicher, die Kerle schießen ihre Bolzen in alles, was sich bewegt. Und die Seen um München und der Chiemsee werden vermutlich bald leergefischt sein.«
Er unterbrach sich. Die Zuschauer begannen zu jubeln und zu pfeifen, und wir versuchten den Grund ihrer erneuten Belustigung zu erspähen. Ein Zugochse war so eng in die Steckengasse eingebogen, daß der vollbeladene Wagen mit der Seite an eine Hausecke prallte und die Bohlen, die als Seitenwand dienten, herabfielen. Einige Büschel Stroh und mit ihnen Hunderte von Eiern rutschten aus dem Wagen und auf den Boden. Was nicht zerbrach und als unappetitlicher Matsch zwischen den Pflastersteinen herumschwamm, wurde von den Umstehenden eilends eingesammelt; die Wappner, die sich die Bäuche hielten vor Lachen, schritten viel zu spät ein. Der Wagenlenker jammerte lauthals, bis er außer Sicht war, und der Treck bewegte sich wieder weiter.
»Ich wette, dieser Ochse steckt noch im Verlauf der Hochzeit am Spieß«, sagte ich.
»Wahrscheinlich. Wenngleich ihn die Fürsten und Herrschaften zu zäh finden würden; für sie sind zartere Bissen gerichtet. Er kommt aus dem Volk und wird wohl zum Volk zurückkehren.«
»Welches sein zähes Fleisch mit Schwarzbrot verzehren und mit billigem bayrischen Wein hinunterspülen wird, während die edlen Damen und Herren süßes Weißbrot essen und ihre Gaumen mit Muskateller und Malvasier benetzen«, vollendete ich boshaft. Altdorfer erlaubte sich ein Grinsen. Nach einem kurzen Moment wurde er wieder ernst.
»Laß uns weiterarbeiten«, sagte er. »Du siehst ja, was hier los ist. Irgend jemand muß sich auch noch um die Holzversorgung kümmern. Der Kanzler hat schon zwei Holzmeister bestellen lassen, und ich muß mit ihnen über einen geeigneten Stapelplatz sprechen. Sie möchten das Holz in der Freyung aufschichten; ich fürchte, der Platz dort wird nicht ausreichen. Aber zuerst möchte ich mich noch mit dir beraten.«
»Du hast recht, Hanns«, seufzte ich. »Wir können uns keinen Fehler erlauben. Wenn wir versagen, sind hier eindeutig zu viele Gänse angeliefert worden.«
Bis wir das Rathaus betraten, hatte sich Hanns Altdorfers Freude über den reibungslosen Beginn der Hochzeitsvorbereitungen wieder gelegt. Er war zugleich aufgebracht und mutlos, als wir uns in sein Zimmer begaben.
»Der Kanzler und der Richter haben uns im Stich gelassen, findest du nicht auch?« brummte er, nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Wir stehen mit dem Fall ganz allein da.«
»Wir brauchen sie nicht«, sagte ich. »Wenn sie nicht in Landshut sind, kann ihnen auch nichts zustoßen. Betrachte es einmal von der Seite.«
Er lachte freudlos auf.
»Wenn das so ist, sollte ich mir auch irgendwo anders etwas Dringendes zu tun suchen«, keuchte er. »Am besten in Ägypten.«
Ich erwiderte nichts, und er sah mich ernst an und erklärte: »Das war nur so dahingesagt. Ich lasse dich nicht hängen; schließlich habe ich dich in die ganze Sache verwickelt.«
Ich hätte gerne abgewinkt und geprahlt, daß ich ihn nicht brauche und daß es das Beste sei, wenn er die Stadt ebenfalls verließe. Aber ich schwieg; ich wußte, daß ich seine Hilfe noch benötigen würde.
»Was geschieht nun?« fragte er schließlich.
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Ich denke darüber nach, was ich vor fünfzehn Jahren getan hätte.«
»Und was ist das?«
»Wir verfolgen die Spur weiter, die wir bisher haben «, erklärte ich, ohne mir meiner Sache ganz sicher zu sein. »Wir haben Gäste aus der Umgebung des polnischen Hofes in der herzoglichen Stadtresidenz; der Täter kann sich darunter befinden. Wir haben weiterhin den polnischen Botschafter mit seinem Gefolge im Haus Walthers vom Feld, den wir nicht außer acht lassen dürfen. Befinden sich sonst in irgendeinem Quartier in der Stadt Polen?«
Altdorfer bückte sich unter seinen Tisch, ohne mir zu antworten. Er kam mit einer großen pergamentenen Rolle wieder zum Vorschein und hielt sie in die Höhe.
»Der Häuserplan«, sagte er. »Ich habe alle Quartiernehmer eingezeichnet, um den Überblick zu behalten.« Er wischte die Federn und den Sandstreuer auf dem Tisch beiseite und breitete den Plan aus.
Es war ein Stadtplan, in dem alle Häuser und Anwesen in der Stadt in Parzellen eingezeichnet waren; die offiziellen Behausungen außerhalb der Stadtmauern, die nicht von Pfahlbürgern errichtet worden waren, fanden sich ebenfalls darin. Jemand hatte mit schwarzer Tusche in jede Parzelle den Namen des Besitzers geschrieben; ich fand Hanns Altdorfers Namen dort, wo sein Haus stand, und ich entdeckte ebenfalls die Namen Löw und Oberndorf er und etliche andere, die mir bekannt waren. Der Stadtkämmerer schien die Beschriftung ständig zu erneuern: Bei einigen der Namen konnte man erkennen, daß sie über einer Stelle standen, an der man einen anderen Namen ausgekratzt hatte. Ich sah wieder hoch und stellte fest, daß Hanns Altdorfer ein selbstzufriedenes Gesicht machte.
»Ich nehme an, der Plan ist auf dem neuesten Stand«, sagte ich, um ihm eine Freude zu machen. Er nickte mit Nachdruck.
»Er stammt noch aus den Zeiten des Stadtkämmerers Pätzinger, vor mehr als zehn Jahren. Ich habe damals schon als einer seiner Schreiber mit diesem Plan gearbeitet.«
»Was bedeuten die in rot eingetragenen Namen neben denen der eigentlichen Besitzer?«
»Das«, erklärte er stolz, »sind die Namen der Gäste oder Delegationen, die für die Hochzeit dort untergebracht sind.«
Ich nickte und betrachtete den Plan wieder. Unter den roten Namen waren besonders viele ausgekratzte Stellen; scheinbar war es nicht leicht, eine endgültige Belegung vorzunehmen. Ich befeuchtete einen Finger und tupfte leicht an einen der Namen; die Tusche war sicher noch keine zwei Tage alt.
»Sieh her«, sagte Hanns Altdorfer und wies auf die Stelle, an der die Stadtresidenz Herzog Ludwigs eingezeichnet war: Ich sah in Schwarz den Namen Ludvicus Dux und daneben, in Rot, in schlichter Stilisierung den Adler des polnischen Wappens. »Hier logiert die Delegation von Albert Moniwid.«
Ich fuhr mit dem Finger über die Karte, bis ich das Haus Walthers vom Feld erreichte; auch hier war wieder der kleine rote Adler zu sehen. Ich warf einen Blick aus dem Augenwinkel zu Hanns Altdorfer, aber er wartete nicht auf mein Lob, sondern suchte bereits nach weiteren Eintragungen mit dem gekritzelten Wappen.
»Ich mache nicht alle Einträge selbst«, sagte er entschuldigend. »Eigentlich ist der Stellvertreter von Richter Girigel, Wilhelm Trennbeck, mit der Zuweisung der Logis befaßt, und ich habe mit ihm vereinbart, daß er jede neue Information sofort an meine Schreiber weitergibt, die diesen Plan vervollständigen.«
Er bewegte den Finger in einer Schlangenlinie zwischen den beiden Häuserreihen der Altstadt hin und her und fuhr vom Judentor bis zur Heilig-Geist-Kirche langsam alle Einträge ab. »Hier ist nichts«, murmelte er.
Ich folgte seiner planmäßigen Suche unwillkürlich mit den Augen, aber schon gegenüber des Rathauses stieß ich auf einen weiteren Namen, der mir auffiel.
»Fridericus Rex«, sagte ich erstaunt. »Soll das bedeuten, daß der Kaiser schon in der Stadt ist?«
»Nein«, sagte er. »Wir haben seinen Namen nur schon eingetragen, weil es sicher ist, daß er dieses Quartier erhalten wird. Sieh her: Bei meinem Haus und beim Haus von Peter Oberndorfer steht ebenfalls schon, daß der Bräutigam und die Braut dort logieren werden. An diesen Zuweisungen wird sich nichts mehr ändern.«
»Das ist das herzogliche Zollhaus, in dem der Kaiser wohnen wird.«
»Richtig. Der Herzog hat Order gegeben, es für die Bequemlichkeit des Kaisers einzurichten.«
»Ich kann mich erinnern, daß du gesagt hast, der Kaiser sei nicht auf der Burg untergebracht.«
»Zuwenig Platz. Und zu nahe an Herzog Ludwig; die beiden sind nicht unbedingt Freunde, wenn sie auch längst keine Feinde mehr sind. Wahrscheinlich wollte der Kaiser einen Ort, an dem er sich sicher fühlen konnte.«
Mittlerweile hatte Altdorfer in seiner systematischen Art die Neustadt und die Freyung nach polnischen Logiergästen untersucht, ohne fündig zu werden. Er umrundete die Stadtmauer mit dem Finger und sah dann zu mir auf.
»Nichts«, erklärte er. »Sieh ruhig nochmals selbst darüber, aber ich denke, es gibt im Moment keine weiteren polnischen Gäste in der Stadt.«
»Was ist mit der Ländgasse zwischen der Altstadt und dem Fluß?«
»Die Häuser dort wurden als mögliches Quartier nicht in Betracht gezogen«, sagte er. »Es gibt nur im unteren Drittel Wohnhäuser; der Rest bis zum Ländtor hinauf sind Stadel und Lagerhäuser. Du siehst keine einzige rote Eintragung dort.«
Ich deutete auf eine Parzelle in der östlichen Häuserzeile der Ländgasse.
»Hier ist euch ein Fehler unterlaufen«, bemerkte ich. »Ein Name wurde ausgekratzt, aber kein neuer eingetragen.«
Er schüttelte den Kopf.
»Das ist richtig«, brummte er. »Das Haus steht leer.«
»Es steht leer? Wem gehört es denn?«
»Soweit ich weiß, dem Herzog. Es wurde vor langer Zeit von seinem Vater konfisziert, aber er hat niemals etwas damit angefangen.« Er zuckte mit den Schultern, und ich hatte den Eindruck, daß er noch etwas mehr dazu sagen wollte, es sich aber verkniff. »Es verfällt; schade darum«, sagte er nur.
Er richtete sich seufzend aus seiner gebückten Haltung auf und begann, die Karte einzurollen. Er verstaute sie vorsichtig wieder unter seinem Tisch.
»Zwei Möglichkeiten«, erklärte er. »Der Täter steckt entweder bei Albert Moniwid oder beim Botschafter.«
»Das vereinfacht die Sache«, sagte ich mit falscher Fröhlichkeit. »Es hätten auch zwanzig verschiedene Möglichkeiten zutage kommen können. So kann ich heute noch anfangen, mich bei Moniwid und dem Botschafter ein wenig umzuhören.«
Altdorfer schniefte nur. Bevor er sich zu einer Antwort aufraffen konnte, öffnete sich jedoch die Tür, und einer seiner Schreiber streckte den Kopf herein. Altdorfer sah ihn ungnädig an.
»Verzeihung, Exzellenz«, sagte der Schreiber demütig. »Hier ist der herzogliche Futtermeister Pammberger, der Euch sprechen will.«
»Ich habe keine Zeit!« rief Altdorfer. »Der Futtermeister soll ein anderes Mal wiederkommen.«
Der Schreiber machte ein verzweifeltes Gesicht, und ich wußte, daß er selbst schon vergeblich versucht hatte, den Besucher loszuwerden. Er wollte etwas einwenden, aber offensichtlich hatte auch der ungebetene Gast draußen in der Schreibstube des Stadtkämmerers ablehnende Antwort vernommen. Er polterte mit tiefer Stimme:
»Keine Zeit? Das wäre ja noch schöner.«
Er drängte sich an dem Schreiber vorbei zur Tür herein, ein schwerer Mann mit langen grauen Haaren, dessen Beine in mächtigen, kotigen Stiefeln steckten und der den Geruch von Heu und Pferden mitbrachte. Er ignorierte mich vollkommen, baute sich mit der selbstbewußten Arroganz eines herzoglichen Beamten neben dem Tisch Altdorfers auf und grollte: »Ich habe ein Problem, und Ihr werdet mir zuhören, Notarius.«
Die Hofbeamten des Herzogs, mächtige und einflußreiche Männer, waren während der Zeit der Hochzeitsvorbereitungen mit weitreichenden Sonderbefugnissen ausgestattet worden. Das Selbstverständnis eines Stadtbeamten wie des Kämmerers mußte diese Maßnahme hart treffen; dazu brauchte es nicht das großspurige Auftreten eines jener Amtsinhaber. Ein Mann wie Hanns Altdorfer war es sicherlich gewohnt, daß die herzoglichen Beamten grob mit ihm umsprangen; aber zu anderen Zeiten gab es Stellen, bei denen man sich über einen Amtsinhaber beschweren konnte, wenn er seine Grenzen überschritt. Während der Vorbereitungen zur Hochzeit allerdings gab es vermutlich keine Grenzen für die Hofbeamten. Altdorfer starrte den Futtermeister gequält an.
»Ich habe einen Gast«, sagte er.
»Für den Ihr anscheinend genügend Zeit übrig habt. Also habt Ihr diese auch für mich.«
Altdorfer verdrehte die Augen und gab auf.
»Dann sprecht, in Gottes Namen.«
»Es handelt sich um die Pferde der Eingeladenen«, sagte der Futtermeister. »Wir werden sie nicht alle in der Stadt unterbringen. Bei etwa sechstausend Stück ist die Kapazität aller Stadel und Hinterhöfe erschöpft, selbst wenn wir die Ackerbürger im Bereich der Stadt, die Pächterhöfe im Habran und die Ställe des Zisterzienserinnenklosters mit benutzen. Wir rechnen aber mit etwa zehntausend Pferden.«
»Das ist nicht meine Angelegenheit«, stieß Altdorfer hervor. »Der Stellvertreter des Stadtrichters kümmert sich um die Unterbringung der Gäste und ihrer Pferde. Fragt Herrn Trennbeck.«
»Wenn er aufzufinden wäre, jederzeit«, rief der Futtermeister. »Leider scheint es, als hätte er sich versteckt.«
»Richtig«, stöhnte Altdorfer. »Der Kanzler hat ihn schon vor ein paar Tagen nach Eching gesandt, um dort die Unterstellmöglichkeiten für den letzten Aufenthalt des polnischen Hochzeitszuges auszukundschaften.«
»Und nun?«
Hanns Altdorfer zuckte mit den Achseln. Ich folgte dem Gespräch nur mit halbem Interesse und wartete auf eine Möglichkeit, mich zu verabschieden. Der Stadtkämmerer kratzte sich heftig am Kopf und sagte dann zögernd: »Soweit ich weiß, hat man sich mit diesem Problem schon auseinandergesetzt. In den Einladungen wurde die zu erwartende Anzahl der Pferde abgefragt und die Gäste angewiesen, nur die persönlichen Reittiere mit zur Stadt zu nehmen. Troß und Wagenpferde sollten in den Pachthöfen draußen auf dem Land bleiben.«
»Schön, daß man mir das auch einmal sagt«, knurrte der Futtermeister.
»Vielleicht solltet Ihr mit den herzoglichen Schreibern sprechen, wenn Ihr diese denn finden könnt, Herr Pammberger«, sagte Altdorf er mit einem so unüblichen Anflug von Sarkasmus, daß ich aufhorchte. Pammberger brummte etwas, das niemand weiter hinterfragte. Scheinbar fühlte er sich im Augenblick geschlagen. Nach einem Moment wandte er sich wieder an Hanns Altdorfer.
»Wo befinden sich diese Pachthöfe genau, Kämmerer?« fragte er.
»So eingehend bin ich nicht informiert. Es ist eigentlich die Aufgabe von Wilhelm Trennbeck.«
»Nun gut«, brummte der Futtermeister. »Wenn sich jemand des Problems bewußt ist, hat es keine solche Eile mehr. Ich dachte nur, es hätte sich noch niemand darüber Gedanken gemacht.«
»Dann wünsche ich Euch noch einen schönen Tag«, sagte Hanns Altdorfer.
Der Futtermeister überhörte die Verabschiedung, ohne mit der Wimper zu zucken. »Das Futter im Hauptkasten des Herzogs dürfte reichen«, murmelte er mehr zu sich selbst als zu uns. »Dafür ist ebenfalls gesorgt. Die Frage ist nur noch, wie wir es in der gebotenen Schnelligkeit auf die Straße hinunterbekommen. Die Vorräte liegen im ersten Stock.«
»Laßt es von kräftigen Kerlen in geschlossene Wägen schaufeln«, schlug Hanns Altdorfer vor, aber Pammberger schüttelte den Kopf.
»Die Fenster sind zu klein«, sagte er. »Nein, ich denke, wir werden Löcher in die Wand schlagen und das Futter über eiserne Röhren herausgleiten lassen.«
»Dann tut das«, sagte Altdorfer ungeduldig.
»Tut das!« rief der Futtermeister. »Tut das! sagt er. Dazu muß ich mich erst wieder mit den Kanzlern abstimmen oder mit dem Hofkastner oder mit wem auch immer. So einfach ist das nicht; das Gebäude ist ja ganz neu.«
»Ja«, sagte der Stadtkämmerer beinahe mitleidig. »Das ist nun Euer Problem.«
Der Futtermeister warf die Hände in die Luft und wandte sich ab. »Wo ist Richter Trennbeck gleich?« fragte er, schon im Gehen.
»In Eching, ein paar Meilen flußaufwärts.«
»Ich weiß, wo Eching ist«, sagte Pammberger knapp. Er griff nach der Tür; er war schon halb draußen, als ihm die Grundregeln der Höflichkeit wieder einfielen und er sich kurz vor uns verneigte, bevor er nach draußen verschwand. Noch im Schließen der Tür hörten wir ihn murmeln: »Hufeisen und Nägel. Hoffentlich haben die Hufschmiede genügend auf Vorrat gelegt.« Er schloß die Tür mit einem lauten Knall. Wir hörten seine schweren Stiefel über den Boden der Stube poltern, und gleich darauf steckte der Schreiber seinen Kopf wieder herein und flüsterte: »Entschuldigung.«
»Schon gut. Ich bin seiner auch nicht Herr geworden«, sagte Altdorfer und winkte ab. Er schüttelte den Kopf und sah mich an. Fast erwartete ich, daß er als nächstes mich mit dem gleichen irritierten Tonfall fragen würde, was er für mich tun könne. Ich streckte ihm die Hand entgegen.
»Ich mache mich wieder an die Arbeit«, sagte ich. »Vielleicht hat ja Pammberger den Mord begangen, dann überlasse ich dir die Genugtuung, ihn zu verhaften.«
»Mach keine Scherze«, erwiderte er düster, und ich ließ ihn allein.