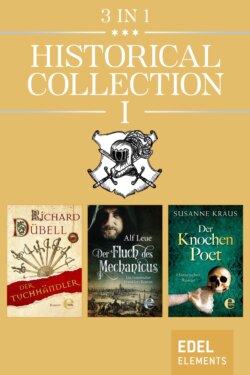Читать книгу Historical Collection I - Susanne Krauß - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеAus den Schänken in der Altstadt drang der Geruch nach gebratenem Fisch, Kohlrabi und das saure Essigaroma von Sulzgerichten auf die Straße, und mein Magen erinnerte sich daran, daß ich das letzte Mal im Morgengrauen etwas zu mir genommen hatte. In der Altstadt trieb sich eine Menge Volk herum; es war der Tag nach Allerheiligen, Allerseelen, und viele Bauern nutzten die Gelegenheit, auch heute ihre Pachthöfe zu vernachlässigen und in der Stadt zu gaffen. Kleine Gruppen von Kindern bettelten vor den Bürgerhäusern in der Hoffnung, noch ein paar von gestern übriggebliebene Seelenwecken zu ergattern. Es fehlten nur die Stände, um den Eindruck eines Markttages komplett zu machen; aber aufgrund des Feiertags oder wegen der Hochzeitsvorbereitungen schien der Stadtrat keine Erlaubnis gegeben zu haben, heute Markt abzuhalten.
Es stellte sich als kein leichtes Unterfangen heraus, die polnische Delegation in Herzog Ludwigs Stadtresidenz zu befragen. Nicht, daß sie sich widerwillig oder gar feindselig gezeigt hätten; sie brachten mir im Gegenteil die herablassende Freundlichkeit entgegen, die ein Adliger, und sei er noch so klein, verarmt und unbedeutend, einem Bürgerlichen gegenüber an den Tag legt. Es war nur so, daß sie sich den ganzen Tag über als äußerst beschäftigt gaben und zwischen Turnierübungen, Leibesertüchtigungen und der Pflege der Pferde kaum Zeit fanden, sich mit mir zu befassen. Außerdem war kaum einer von ihnen einer anderen Sprache als des Polnischen mächtig, und Albert Moniwid mußte mir als Übersetzer vom Lateinischen ins Polnische und zurück dienen; ein Dienst, den er nicht ohne deutlich zur Schau getragenem Spott erledigte. Ich war nicht mehr so erstaunt über die sprachliche Ungelenkheit der polnischen Ritter, als ich erfuhr, daß auch die Prinzessin nur Polnisch sprach.
Ich hatte während meiner Dienste für Bischof Peter mehr als einmal Menschen ausgehorcht, von denen ich annahm, sie eines Verbrechens überführen zu können. Ich war erstaunt, daß ich kaum etwas von den Kniffen verlernt hatte; und ich fühlte mich wie ein Mann, der nach langer Untätigkeit seine Glieder zum ersten Mal wieder bewegt und feststellt, daß seine Muskeln noch ihren Dienst verrichten.
Alles, was ich sagte und hörte, ging jedoch durch den Filter Albert Moniwid. Ich war bemüht, die Mimik und Körpersprache der Befragten mit dem zu vergleichen, was Moniwid mir in der lateinischen Übersetzung präsentierte, und ab und zu flocht ich in meine eigenen Sätze Bemerkungen ein, die meinem Gegenüber bei wahrheitsgemäßer Übersetzung bestimmte Reaktionen entlocken mußten. Soweit es sich hierüber nachprüfen ließ, übertrug Moniwid wortgetreu; aber wer vermochte zu sagen, ob er diese kleinen Fußangeln nicht durchschaute und sie übersetzte, anderes jedoch ausließ oder veränderte? Ich biß die Zähne zusammen und hoffte, daß ich es schon bemerken würde, wenn jemand etwas zu verbergen hatte, oder daß Moniwid mit der Zeit unachtsam werden und sich in seinen eventuellen Lügen verstricken würde.
Ich erfuhr manchen Klatsch über die Hochzeit und deren Hauptpersonen, wie sie sich aus polnischer Sicht darstellten; man konnte den Polen nicht vorwerfen, daß sie mit ihren Ansichten hinter dem Berg hielten. Von mehreren der Ritter wurde mit einiger Bitterkeit erwähnt, daß ihre Prinzessin erst die dritte Wahl für den jungen Herzog gewesen war und daß es edlere (wenn auch nicht so reiche, was die polnischen Recken ebenfalls erbitterte) Anwärter auf die Hand der jungen Frau gegeben habe. Von einer der Frauen, die die Delegation in größerer Zahl begleiteten und die ein bewundernswertes Selbstbewußtsein an den Tag legten, ob sie nun die Gattin eines der Herren waren oder als alleinstehende Edeldame mit einem kleinen Schwärm Zofen in des Herzog Residenz logierten, erhielt ich unabhängig davon eine phantastische Erklärung für die Heiratspolitik König Kasimirs: Ohne vor Albert Moniwid ein Blatt vor den Mund zu nehmen, erwähnte sie verächtlich, die Prinzessin sei wohl kaum mehr eine virgo Intacta (dies war Moniwids lateinische Umschreibung für einen vermutlich viel stärkeren polnischen Ausdruck) und es dürfe niemanden verwundern, wenn sie zur Unzeit einen Nachkommen auf die Welt bringe. Daß die finanzielle Lage des gesamten polnischen Königreichs hinreichend prekär sein mußte, erklärte sich mir durch einige schadenfrohe Bemerkungen, wonach König Kasimir den bayrischen Gesandten die Bezahlung der Mitgift auf Raten in den Ehevertrag diktiert hatte – dies ganz entgegen den Anweisungen, die die herzogliche Delegation erhalten hatte und die deshalb vor Angst schlotternd sich der Unterstützung durch die polnische Königin versichert hatte, welche immerhin eine Base Herzog Ludwigs war. Außerdem wurde mir klar, daß die Polen einen ingrimmigen Ehrgeiz hegten, bei den zu erwartenden Turnieren die bayrischen Ritter von den Pferden zu rennen; beinahe jeder zweite sprach davon, und wie es schien, konzentrierte sich ihr Ehrgeiz auf Herzog Christoph den Starken, den Bruder des Herzogs Albrecht von München, dessen Triumphe in vielen Turnieren die Münder der Männer und die Herzen der übriggebliebenen Jungfrauen füllten. Ich war mit der Zeit geneigt zu glauben, daß die gesamte Delegation aus den unbezähmbarsten Raufbolden unter der polnischen Ritterschaft bestand, ihren Anführer mit eingeschlossen. Die Respektlosigkeit, mit der sie sowohl von ihrem als auch von meinem Souverän sprachen, schien mir diese Annahme noch zu unterstützen und auch, daß sie dabei vor Moniwid keine Scheu an den Tag legten. Ich begann zu vermuten, daß man sie nur deshalb nach Landshut vorausgeschickt hatte, damit sie als Begleitung des Brautzuges in den vielen Städten, durch den dieser zog, keinen Unsinn anstellen konnten.
Was sich mir nicht offenbarte, war, ob sich der Täter unter den von mir Befragten befand. Ich erfuhr zwischen den Zeilen einige Einzelheiten über die tote Gräfin; zum Beispiel, daß sie sich mit Moniwid über seine Kompetenzen als Anführer der Delegation gestritten hatte. Aber es erschien mir trotzdem nicht wahrscheinlich, daß er der Täter war; ich mochte ihn nicht, aber ich war sicher, daß Moniwid nicht fähig gewesen wäre, einen Mord auszuführen – und noch weniger auf diese Art und Weise.
Als ich mich von Moniwid verabschiedete, hielt er die Zügel meines Pferdes fest.
»Was werdet Ihr als nächstes tun?« fragte er.
»Nachdenken«, antwortete ich knapp.
»Beeilt Euch damit«, knurrte er und gab die Zügel meines Pferdes frei. »Ihr habt nur noch elf Tage Zeit.« Ich konnte mich nicht zurückhalten und sagte: »Zwölf Tage mit heute.«
»Natürlich«, erwiderte er und wandte sich ab. »Ich hatte vergessen, daß Ihr gut rechnen könnt.«
Ich hatte den gesamten Nachmittag des Donnerstag mit der polnischen Delegation verbracht, ohne auch nur den kleinsten Hinweis zu erhalten. Als ich die herzogliche Residenz beim Einbruch der Dämmerung verließ, war ich wütend und voll Sorge. Der Eingang zur Ländgasse lag dem Tor der Residenz direkt gegenüber, und ich ritt hindurch, um mir den Umweg über die Altstadt zu sparen. Die Hufe meines Pferdes klangen dumpf auf dem festgetretenen Erdreich in der Gasse. Hier, in ihrem oberen Drittel, war es stockduster. Ich erinnerte mich, daß Hanns Altdorf er gesagt hatte, erst in der unteren Hälfte stünden Wohnhäuser. Ich sah an den Stadeln hoch, die sich links und rechts über die Gasse lehnten. Jedes Haus stand abweisend, die Fenster blind, die Türen unbewegt. Die dunklen Eingänge der Tordurchfahrten, deren Torflügel offenstanden, und der kleinen Gassen zu beiden Seiten gähnten menschenleer. Als ich die ersten Fackeln vor mir sah, die an der Ecke brannten, an der die kleine Seitengasse an Sebastian Löws Haus vorbei zur Altstadt führte, fiel mir das unbewohnte Haus ein, über dessen Schicksal Altdorf er so merkwürdig ausweichend gesprochen hatte, aber ich wußte nicht, wo in der dunklen Straße hinter mir das Gebäude liegen mochte. Ich versuchte, es aus meinen Gedanken zu verdrängen, aber es wollte nicht vollständig verschwinden. Es war das einzige Haus weit und breit, das nicht einem Bürger oder wenigstens einem Gast als Behausung diente.
Bei der kleinen Seitengasse bog ich schließlich doch wieder zur Altstadt ab, um ins Licht zu kommen. Es trafen noch immer vereinzelte Transportkarren mit Vorräten ein, aber das Gros schien für heute erledigt zu sein. Ich kam an zwei Wappnern vorbei, die von einem Offizier ihre Anweisungen für morgen erhielten: Man erwartete die Ankunft von etlichen hundert Ochsen und Schafen auf Flößen, und die beiden sollten mit einer kleinen Mannschaft das Ländtor sowie die kleinen Flößertore besetzen, um etwaige während der Nacht ankommende Lieferungen sofort in Empfang nehmen zu können.
Ich hoffte, daß der polnische Botschafter im Haus des Holländers anwesend war; ich hatte ihn mir für den morgigen Tag vorgenommen. Unwillkürlich stellte ich mir auf dem Ritt nach Hause die Frage: Und danach? Ich wußte nicht, was ich danach tun sollte. Mein Plan endete mit der Hoffnung, unter den Polen einen Verdächtigen auszumachen. Ich erwartete den kommenden Tag voller Angst und Ungeduld, während ich mich eine lange Weile schlaflos auf meinem Lager herumwälzte.
Am Morgen erinnerte ich mich, daß ich Sebastian Löw noch den Betrag schuldete, mit dem er den Totengräber bezahlt hatte, und ich steckte etwas Geld ein, bevor ich mich auf den Weg zum polnischen Botschafter machte. Ich traf auf einen womöglich noch größeren Trubel als am gestrigen Tag. Die Spiegelgasse, in der sich das Haus des holländischen Kaufmanns befand und die Alt- und Neustadt miteinander verband, lag am entgegengesetzten Ende der Altstadt, und ich sah mich gezwungen, in die Neustadt auszuweichen, wenn ich vorankommen wollte.
Zwei Wappner bewachten den Eingang zum Logis des polnischen Botschafters. Ich sah mit Erleichterung, daß es sich um Hiesige handelte, mit denen ich mich wenigstens verständigen konnte. Einer von ihnen führte mich und mein Pferd in einen kleinen Innenhof, der von dem weitläufigen Haus umschlossen wurde, und übergab mich einem polnischen Dienstboten des Botschafters. Der Dienstbote war ein älterer Mann, der bayrisch sprach und sich davon beeindrucken ließ, daß ich vermeintlich im Auftrag des Landshuter Bürgerrates vorsprach. Er brachte mich ohne langen Aufenthalt zu seinem Herrn und stellte mich vor.
»Der Rat Priamus, mein Herr«, sagte er dann zu mir und zog sich zurück.
Priamus war ungeachtet seines klassischen Namens keine stattliche Erscheinung; klein und aufgeschwemmt, sah man seinem Körper und vor allem seinen rotgeäderten Augen seine Laster an. Er nickte mir halb ungeduldig, halb neugierig zu und bot mir einen Sitzplatz an einem wuchtigen Tisch an. Ein Zinnkrug mit mehreren Bechern stand auf einem Tablett in der Mitte des Tisches; ein Becher befand sich vor dem Stuhl, in dem der Pole saß. Eine zittrige Tröpfchenspur auf der Tischplatte, die sich von dort bis zum Standort des Kruges zog, verriet, daß dieser heute schon mehrere Gänge vom und zum Becher zurückgelegt hatte. Priamus beugte sich ächzend über den Tisch, schnappte einen zweiten Becher und stellte ihn vor mir ab. Ungefragt schenkte er mir ein. Ich roch den aufsteigenden Weinduft; es war nicht gerade ein billiger Krätzer.
»Was kann ich für Euch tun?« Er sprach mit einem leichten Akzent, der ebenso davon herrühren konnte, daß er bereits etliche Worte verschliff.
»Ihr sprecht unsere Sprache sehr gut«, sagte ich. Er nickte nur, ohne zu zeigen, ob er sich über das Kompliment freute. Ich holte Atem und begann ihm die Geschichte zu erzählen, die ich mir für ihn zurechtgelegt hatte.
»In Wahrheit«, begann ich, »spreche ich nicht stellvertretend für alle Landshuter Bürger, sondern …«
Er zog eine Augenbraue hoch. In seinen Augen stand plötzlich Mißtrauen, und er ließ mich nicht ausreden.
»Wollt Ihr mir etwas verkaufen?« fragte er barsch. »Habt Ihr Euch deswegen eingeschlichen?«
»Nein«, erwiderte ich. »Es geht mir vielmehr um folgendes: Nicht alle Bürger sind der Ansicht, daß die Verbindung des jungen Herzogs mit Eurer Prinzessin eine glückliche Idee ist, und so …«
»Wieso?« schnappte er.
»Nun, der junge Herzog …«, ich lachte und tat so, als wolle ich ihm etwas Vertrauliches mitteilen, »wißt Ihr, der junge Herzog ist ein wenig – wie sagt man: ungestüm; ja, und er liebt die Jagd und die Turniere über alles und widmet eine Menge Zeit nur …«
»Wollt Ihr damit andeuten, er würde die Prinzessin vernachlässigen, wenn er sie erst einmal geheiratet hätte?«
Seine Art, mich ständig zu unterbrechen, machte mich nervös. Ich hatte das Gefühl, daß ich die Kontrolle über das Gespräch verlor.
»Also, etliche Bürger sind der Ansicht, daß …«
Er stellte seinen Becher so hart auf den Tisch zurück, daß ein wenig Wein herausschwappte. Seine Wangen röteten sich.
»Wie heißen die undankbaren Burschen, die Euch geschickt haben?«
»Was?« stotterte ich.
»Hört einmal«, zischte er und stach mit seinem Zeigefinger auf mich ein. »Euer Herzog Ludwig ist der beste Herrscher, den sich ein Mann wünschen kann. Seht her, was er aus Eurer Stadt gemacht hat; seht her, wie freigiebig er Euch zu der Hochzeit seines Sohnes einlädt und alle Bürger freihält. Da wollt Ihr zu mir kommen und den jungen Herzog schlechtmachen, damit ich meinem König Schauermärchen berichte, wie es seiner Tochter wohl in Zukunft ergehen wird? Ich halte das für eine Unverschämtheit!«
Ich schüttelte den Kopf und wollte etwas sagen, aber er ließ mich nicht zu Wort kommen. Ärgerlich nahm er einen Schluck Wein und sprach weiter, noch bevor ich Atem holen konnte.
»Steckt Ihr vielleicht mit den Ungarn unter einer Decke? Genügt es Mathias Corvinus nicht, daß er widerrechtlich in unser Land eingedrungen ist und die Grafschaften im Süden verwüstet hat? Will er mit Intrigen gegen König Kasimir vorgehen, jetzt, nachdem er den Waffenstillstandsvertrag mit ihm unterzeichnet hat?« Er schnaubte empört.
Ich versuchte, mit seinen Gedanken Schritt zu halten, aber es gelang mir nicht.
»Sprecht Ihr von König Matthias von Ungarn …?« fragte ich.
»Tut bloß nicht so unschuldig!« fuhr er mich an. »Wenn Ihr Euch zu seinem Knecht gemacht habt, wißt Ihr so gut wie ich, wozu dieser Bauernlümmel fähig ist. Er ist wütend, weil König Kasimir seinen Herrschaftsanspruch über Ungarn auch beim Kaiser durchgesetzt hat, und klammert sich daran, daß die Katholischen ihn, Matthias, zum König gewählt haben. Daneben bildet er sich ein, die Krone Böhmens gehöre ihm, obwohl der älteste Sohn unseres Königs auf den Thron gewählt wurde. Und außerdem kocht er vor Zorn darüber, daß Königin Elisabeth ständig seine Werbung um die Prinzessin Jadwiga ausgeschlagen hat.«
»Er hat um die Hand der Prinzessin …?«
»Mehrfach; mehrfach! Aber er ist es nicht wert, die Hand einer Königstochter zu erhalten, dieser Furchenzieher. Dabei ist er ganz versessen auf sie, seit er sie zum ersten Mal gesehen hat. Das kann ich mir schon vorstellen!« Er lachte freudlos. »Wie es ihm gefallen würde, seine schwieligen Pfoten auf ihren unschuldigen Leib zu legen.« Er schenkte sich aufgebracht nach. Meinen Becher ignorierte er betont; er hätte auch nichts eingießen können. Ich hatte noch keinen Schluck getrunken. Ich hatte ihm vielmehr atemlos zugehört. Als er schwieg, sagte ich: »Es ist nicht so, wie Ihr denkt«, um ihn zum Weiterreden zu animieren.
»Es ist ganz genauso, wie ich denke. Matthias weiß genau, daß er gegen eine Verbindung König Kasimirs mit dem Herzog Ludwig und damit mit dem Reich keine Chance hat – noch dazu, da er auch in Ungarn selbst mit einer Opposition zu kämpfen hat, die lieber König Kasimirs zweiten Sohn als ihn auf dem Thron sähe. Er hat den Waffenstillstand nur unterzeichnet, weil er uns militärisch nicht gewachsen ist; und unter seinem Schutz sieht er jetzt eine günstige Gelegenheit, die Achse zwischen König Kasimir und dem Reich zu zerstören, indem er die Hochzeit zwischen der Prinzessin und dem jungen Herzog zu verhindern versucht.« Er hob eine Hand und ballte sie zur Faust. »Man sollte ihm eine Tracht Prügel verabreichen, wie es sich für einen Bauern gehört.« Er holte seinen Blick aus den Niederungen der polnischen Politik zurück und f okussierte seine roten Auglein wieder auf mich. Ich erkannte, daß es ihm mittlerweile Mühe bereitete.
»Euch sollte man auch eine Tracht verabreichen; Euch und den feinen Herren, die Euch zu mir geschickt haben. Ich lasse mich nicht von Euch aufwiegeln, weder gegen meinen König noch gegen Euren Herzog, den ich als feinen Mann kennengelernt habe. Verschwindet aus meinem Haus.«
Er stand auf und warf sich in eine drohende Pose. Sie verfehlte ihre Wirkung, da er viel kleiner war als ich und sich mit beiden Händen an der Tischkante festhalten mußte. Ich ging dennoch ohne ein weiteres Wort. Wäre ich der gewesen, für den ich mich ausgegeben hatte, hätte ich über sein Pathos gelacht. So aber konnte ich nicht verhehlen, daß mich seine Loyalität beeindruckte. Er war ein Trunkenbold, und er mochte hinter den Weibern her sein, aber in seiner Ergebenheit den Herren gegenüber, denen er zu dienen sich verpflichtet hatte, bewies er eine gewisse Würde, die anderen Männern mit größerer Sittenstrenge fehlte. Ich verließ sein Haus und ritt durch die Spiegelgasse weiter zur Altstadt hinüber. Ich mußte mich erneut mit Hanns Altdorfer absprechen.
Die Altstadt war noch immer ein einziger Tumult, und ich versuchte, mein Pferd bei den Wappnern am Ländtor unterzustellen, aber die Männer weigerten sich, darauf aufzupassen; sie hatten alle Hände voll zu tun, um die Scharen von Ochsen und Schafen in die richtigen Bahnen zu leiten, die mittlerweile auf den ersten Flößen vor der Stadtmauer landeten. Ich ritt zur Altstadt hinauf und versuchte mein Glück ebenso vergeblich bei der Baustelle und beim Rathaus. Es gab vor vielen Häusern Pfosten und kleine Vordächer, unter die man sein Pferd stellen konnte, aber es schien mir nicht ratsam, mein Reittier ohne Bewachung zurückzulassen. Eine Menge Gesindel trieb sich in der Stadt herum, zur Zeit noch verstärkt durch die Attraktivität der bevorstehenden Hochzeitsfeiern, und so mancher Gutgläubige fand sein Pferd ohne Zaum und Sattel wieder – oder Zaum und Sattel ohne Pferd. Schließlich sah ich mich gezwungen, den Gaul in die Obhut eines Gasthauses zu geben, dessen Wirt mit unschuldiger Miene sechs Pfennig bis zum Abend veranschlagte, Heu und Stroh nicht inbegriffen, und verlangte, ich müsse das Pferd bis zum Abendläuten wieder entfernt haben, weil er zu diesem Zeitpunkt eine Menge Gäste erwarte. Ich zahlte zähneknirschend und beschloß, diesen Posten dem herzoglichen Kanzler gesondert in Rechnung zu stellen, um ihm zu zeigen, wie sehr die Prunksucht seines Herrn die Landshuter Wirte verdarb. Danach machte ich mich auf den Weg zu Sebastian Löw, um zuerst meine Schulden zu bezahlen.
Die Altstadt war in der Zwischenzeit buchstäblich zu einem gefährlichen Pflaster geworden; über den getrockneten Dung von gestern legte sich als Schmierschicht der Kot der Ochsen und Schafe, die vom Ländtor her und der Ländgasse quer über die Straße zu den Fleischbänken getrieben wurden. Ich balancierte vorsichtig hinüber und wartete eine Pause im Viehtrieb ab, um mich zu Löws Haus hindurch zu zwängen. Wie auch schon gestern stand eine Menge Volks Spalier und beobachtete die Bemühungen von Wappnern und Viehtreibern, ihre Neugier ungetrübt von dem beißenden Gestank der Ausdünstungen und der dicken Schichten aus antrocknendem Kot.
Es hatte sich wohl herausgestellt, daß die kleinen Flößertore in der Stadtmauer zu eng für die mächtigen Leiber der Schlachtochsen waren; man trieb sie deshalb kurzentschlossen durch das Ländtor und an der Baustelle der Kirche vorbei die Altstadt hinunter. Durch die Bauhütten und das herumliegende Material wurde der Weg dort jedoch zu einem Nadelöhr, und ich konnte mir vorstellen, daß der mächtige Hans Stethaimer nicht gewillt war, wegen der Tiere seine Baustelle aufzuräumen. Um den Viehtrieb nicht deshalb ins Stocken geraten zu lassen, verlegte man einen Teil der Strecke auch durch die Ländgasse; ich sah durch die Gasse von weitem die Rücken der Zuschauer, die sich am Weg entlang aufgestellt hatten.
Als ich die Eingangstür zu Löws Haus öffnete, rannte ich beinahe in einen alten Mann mit einem groben Kittel, der sich dahinter aufgehalten hatte. Er sah mich erwartungsvoll an.
»Ich möchte zu Sebastian Löw«, sagte ich.
»Der Herr ist drüben in der Gasse und schaut dem Viehtrieb zu.«
»Ist sein Sohn zu sprechen?«
»Er hält sich irgendwo in der Stadt auf. Kann ich Euch zur Herrin führen?«
»Nein, danke. Wo, sagtest du, ist Herr Löw?«
»In der Ländgasse. Er ist eben losgegangen. Ich nehme an, Ihr werdet ihn gleich in der Nähe des Gasseneingangs finden.«
Ich nickte und verließ das Haus. Einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich die Bezahlung nicht auf morgen verschieben und mich zuerst mit Altdorfer treffen sollte, doch ein Blick zurück in die Altstadt sagte mir, daß es im Moment sinnlos war, sie durchqueren zu wollen. Ich machte mich auf die Suche nach dem Apotheker.
Er stand nicht weit von der Einmündung in die Ländgasse entfernt und versuchte, über die Köpfe der von ihm Stehenden zu spähen. Ich sprach ihn an, und er machte einen kleinen Sprung.
»Ihr seid es, Herr Bernward«, stieß er hervor. »Ihr habt mich erschreckt.
»Das tut mir leid«, erwiderte ich. »Seid Ihr so schreckhaft?«
»In letzter Zeit schon«, sagte er. Dann breitete sich ein freundliches Lächeln über sein rundes Gesicht aus.
»Was kann ich für Euch tun?«
»Nichts«, erklärte ich. »Ich tue etwas für Euch. Zuerst möchte ich Euch sagen, daß Euer Sohn seine Arbeit gut gemacht hat.«
Er erlaubte sich, vor Stolz zu erstrahlen.
»Hat er Euch die Urkunde ausgestellt?«
Ich dachte an das wertlose Stück Papier, das ich in meiner Kleidertruhe verstaut hatte, und sagte: »Ja. Sie wird mir gute Dienste leisten.«
Er nickte. Sein Lächeln verschob sich um ein paar Grade von Stolz zu Anteilnahme. Es war überraschend, wie offen sein Mienenspiel seine Gefühlslage ausdrückte. Ich revidierte meinen Eindruck von unserem ersten Treffen, daß seine Kunden sich durch seine fröhliche Stimme verspottet fühlen mußten, nochmals; wer ihm länger als ein paar Augenblicke ins Gesicht sah, würde bedenkenlos jedes Mittel in sich hineinstopfen, das der Apotheker einem empfahl. Er strahlte Aufrichtigkeit aus, wie ein Holzfeuer Wärme abgibt.
»Ihr habt mit den Eltern des jungen Mädchens noch nicht gesprochen?«
»Nein. Ich fand noch – ah, nicht den Mut dazu.«
»Ich kann es Euch nicht verdenken. Eine schwierige Aufgabe wartet auf Euch. Zögert nicht, meinen Sohn zu Hilfe zu nehmen, Herr Bernward; die Gegenwart eines Medicus kann bei derartigen Gesprächen manchmal Wunder wirken.«
»Ich werde daran denken; vielen Dank«, erwiderte ich.
Er zuckte mit den Schultern, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Ich räusperte mich und sagte: »Ich bin Euch noch schuldig, was Ihr dem Totengräber gegeben habt.«
»Einen halben Gulden. Es tut mir leid; er ließ nicht mit sich handeln.«
»Macht Euch keine Sorgen. Er war seinen Preis wert.« Ich händigte ihm das Geld aus, und er steckte es in die Tasche, ohne nachzuzählen. Dann zog er die Nase hoch und sah einen Moment den vorbeiziehenden Tieren zu, und über seine Miene wechselten rasch freundlicher Spott, Faszination und der Gesichtsausdruck eines Menschen, dem der Geruch von frischen Exkrementen in die Nasenlöcher gestiegen ist.
»Seid Ihr geschäftlich hier?« fragte er, als er sich wieder zu mir umwandte und mit dem Daumen auf den Viehtreck zeigte.
»Ich habe nach Euch gesucht«, antwortete ich. »Ich wollte meine Schulden begleichen.«
»Das hätte aber keine Eile gehabt«, entgegnete er beinahe verlegen. Ich klopfte ihm leicht auf die Schulter, und er lächelte. Er deutete wieder auf die vorbeiziehenden Tiere mit ihren Treibern.
»Eine ganze Menge Vieh, nicht wahr?« sagte er. »Ihr hättet es gestern sehen sollen, als das Gros der Vorräte aus den umliegenden Landgerichten durch die Stadt zog. Wahrscheinlich sind die ganzen Höfe in der Umgebung so ausgeplündert wie nach einem Kreuzzug. Die Tiere hier stammen sogar aus Ungarn.«
»Ich kann es mir vorstellen«, erwiderte ich. »Was führt Euch hier heraus? Nur die Neugier?«
»Nein«, lachte er. »Wenn ich wollte, könnte ich von den Fenstern meines Vorratsspeichers das Ganze viel besser überblicken, und das, ohne im Gestank zu stehen. Ich warte auf einen der Flößer; ich habe ihm aufgetragen, mir eine Ladung ungarisches Rosenöl für das Konfekt mitzubringen.«
»Ich dachte, die Flößer transportieren nur das Vieh her.«
Er zwinkerte mir zu.
»Eine Ladung Rosenöl nimmt kaum Platz weg«, sagte er. »Nicht ein Schaf muß dafür seinen Platz räumen. Ein unproblematisches Zusatzgeschäft für den Besitzer des Floßes.«
»Und auch für den Auftraggeber, der dadurch einen niedrigen Transportpreis erzielt«, grinste ich, und er grinste zurück. Beinahe hörte ich ihn denken: Das habe ich nur von Euch gelernt.
»Wo trefft Ihr Euren Flößer?«
»An der Lände, jenseits der Stadtmauer. Ich muß warten, bis das ganze Vieh entladen ist; vorher hat er bestimmt keine Zeit, sich um mein Anliegen zu kümmern. Wollt Ihr mir noch ein wenig Gesellschaft leisten?«
»Gern«, sagte ich. Ich wußte, daß ich so schnell wie möglich mit dem Stadtkämmerer sprechen mußte, aber die unkomplizierte Freundlichkeit des Apothekers tat mir gut. Ich dachte: Eine halbe Stunde Verzug kann auch nicht schaden, und lehnte mich bequem gegen die Hausmauer in meinem Rücken.
Wir schwiegen eine Weile und sahen dem Strom von Ochsen und Schafen zu, die mit von der Floßfahrt noch unsicheren Beinen an uns vorbeitrabten. Die scharfen kleinen Hufe der Schafe hatten das Erdreich in der Gasse mittlerweile aufgerissen, und die schweren Tritte der Ochsen vermischten den Lehm und den herabgefallenen Kot zu einem zähen, übelriechenden Brei. Angesichts dessen konnte ich mir denken, daß die meisten der in der Altstadt wohnenden Patrizier die Umleitung nicht ungern sahen; das Pflaster auf der Straße war schon verschmutzt genug. Vielleicht hatten sie Hans Stethaimers Weigerung, für den Viehtreck Platz zu machen, mit einigen kleinen Gaben den Rücken gestärkt.
»Kennt Ihr das Haus da drüben?« fragte Löw unvermittelt. Ich sah hoch; er deutete auf ein Gebäude weiter oben in der Ländgasse.
– »Nein«, sagte ich.
»Es steht schon seit ewigen Zeiten leer«, erklärte er.
Ich horchte auf; dies war das Haus, von dem Altdorf er gesprochen und das ich gestern übersehen hatte.
»Was ist damit?« fragte ich vorsichtig.
Er dämpfte plötzlich seine Stimme und beugte sich zu mir herüber; ich mußte mich bücken, um ihn verstehen zu können. Er sagte: »Wißt Ihr, ich bin kein leichtgläubiger Mann. Ich weiß, daß man bestimmte Pilze und Kräuter einnehmen kann, um Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht sehen können – schöne und schreckliche Dinge. Aber es sind Dinge, die aus den Giften in diesen Pflanzen entstehen, weil sie das Gehirn des Menschen durcheinanderbringen, und nicht etwa Dinge, die es in Wirklichkeit gibt. Ich weiß auch, daß die Irrlichter in den Sümpfen nicht die Seelen von Ertrunkenen sind, sondern aus Gasblasen entstehen, die sich entzünden, wenn die Luft schwül und kurz vor einem Gewitter ist. Und ich weiß, daß die meisten der alten Weiblein, die man im Fränkischen und Hessischen als Hexen verbrannt hat, im Grunde nichts Verwerflicheres taten als ich selbst und vom Satan so wenig verbuhlt worden sind wie die reinste Jungfrau in irgendeinem Kloster. Und deshalb habe ich auch gelacht, wenn aufgeregte alte Jungfern oder halb betrunkene Flößer meinen Vater aufsuchten, um ihm zu erzählen, sie hätten gespenstische Lichter in diesem alten Haus dort drüben gesehen. Meister Löw, sagten sie, die Seelen der Toten gehen dort um und finden keine Ruhe. Mein Vater war freundlich und gab ihnen beruhigende Kräuter mit, doch wenn sie den Laden wieder verlassen hatten, drehte er sich zu mir um und sagte ernst: Sebastian, höre auf zu lachen; das sind arme Menschen, denen ihre Angst und ihr Geisterglaube Dinge vorgaukeln, die gar nicht vorhanden sind. Die Seelen der Toten sind im Fegefeuer und büßen dort ihre Zeit ab – sie haben in alten Häusern nichts verloren.«
Er fuhr sich mit der Hand über den Mund, als müsse er nachdenken, ob er überhaupt weiter sprechen sollte. Dann schluckte er und sagte: »Und nun habe ich selbst flackernde Lichter in diesem verfluchten Haus gesehen, spät in der Nacht, und so etwas wie hohle Stimmen gehört. Deshalb bin ich so schreckhaft.«
Ich starrte ihn mit weitaufgerissenen Augen an; ich konnte nicht verhindern, daß mir eine Gänsehaut den Rücken hinunterlief, wenn auch aus anderen Gründen als jenen, die sichtbar die letzten verbliebenen Haare in Sebastian Löws Nacken aufstellten.
»Wann war das?« fragte ich scharf.
»Gestern.«
»Was habt Ihr unternommen?«
»Ich? Nichts. Ich werde es künftig tunlichst vermeiden, bei Nacht an dem Haus vorbeizugehen, das ist alles. Ich fürchte, daß ich zu viele Jahre in den Ausdünstungen meiner Arzneien und Kräuter verbracht habe und daß auch mein Hirn beginnt, mir Dinge vorzugaukeln.«
»Habt Ihr von jemand anderem gehört, der die gleichen Beobachtungen gemacht hat?«
»Nicht, daß ich wüßte. Warum fragt Ihr so eindringlich nach?«
Ich zuckte zurück; ich hatte mich von meiner Aufregung mitreißen lassen. Löw musterte mich halb erwartungsvoll, halb mißtrauisch. Ich suchte nach einer unverfänglichen Antwort.
»Das Haus steht doch nahe am Fluß«, stotterte ich schließlich. »Der ganze Untergrund war früher ein Sumpf. Ich habe einmal gehört, daß sich auch dort jene Gase bilden können, von denen Ihr als Irrlichter gesprochen habt. Ich habe nach einer Erklärung gesucht, deshalb wollte ich wissen, ob auch andere Menschen solche Erscheinungen hatten.«
Er entspannte sich und begann wieder zu lächeln. Plötzlich wurde mir klar, daß er befürchtet hatte, ich würde ihn für vollkommen verrückt halten.
»Schon möglich«, sagte er. »Dazu müßte man das Innere des Hauses einmal genau untersuchen, aber mich persönlich bringen keine zehn Pferde dort hinein; Vernunft hin oder her. In einem habt Ihr ohnehin Unrecht: Der Untergrund besteht nicht aus ehemaligem Sumpf, sondern aus Kies. Und von Gasen, die sich in Kies bilden, habe ich noch nie etwas gehört.«
Ich sagte gleichmütig: »Dann ist es etwas anderes, das sich mit natürlichen Dingen erklären läßt. An Geister, die mit hohlen Stimmen reden, mag ich jedenfalls nicht glauben.«
»Ich auch nicht«, lachte er, aber es klang nicht überzeugend. »Vor allem aber will ich nicht einen meiner Nachbarn fragen, ob er des Nachts Stimmen gehört hat, wenn Ihr mich versteht.«
Er wandte sich wieder dem Viehtrieb zu, aber mein Interesse daran war erloschen. Ich versuchte die Bedeutung dessen zu verstehen, was er mir gesagt hatte. Erst als Löw sich zu mir umdrehte und mir ins Gesicht sah, merkte ich wieder auf.
Seit einigen Minuten war kein Tier mehr vorbeigetrieben worden, und es schien, als sei die Verladeaktion fürs erste beendet. Die Menschen begannen sich wieder zu zerstreuen. Löw schüttelte sich, wie um seine alte Fassung wiederzuerlangen, und hielt mir dann die ausgestreckte Hand hin.
»Ich muß meinen Flößer aufsuchen«, sagte er und erwiderte meinen Händedruck mit seinen weichen Fingern. »Ich hoffe, Ihr haltet mich jetzt nicht für unzurechnungsfähig.«
»Mein Verwalter schwört Stein und Bein, er habe einmal den Teufel an einem Wegkreuz um den Leichnam eines Gehenkten tanzen sehen«, sagte ich. »Und ich halte ihn für so vernünftig, daß ich immer wieder mein Geschäft in seine Hände lege.«
Er lächelte mich verwirrt an; sichtlich wußte er nicht, ob dies nun eine positive oder eine negative Antwort war.
»Nun denn«, sagte er und zog seine Hand zurück. »Gott behüte Euch.«
»Gott befohlen«, erwiderte ich, und er marschierte mit schnellen kleinen Schritten durch den Matsch in der Gasse davon.
Ich ließ ihm Zeit; ihm und den anderen, die sich noch in der Gasse befanden. Es dauerte nicht lange, dann lag sie wieder verlassen da, jetzt noch mehr als sonst gemieden wegen des Morasts, in den sich der Untergrund verwandelt hatte. Ich sprang hinüber auf die andere Seite der Gasse und wanderte zu dem verlassenen Gebäude hinauf. Es war ein großes, auf den ersten Blick ansehnliches Bürgerhaus im oberen Teil der Ländgasse. Von seinem Tor aus konnte man bereits den Fuß des Torturmes sehen, der das Ländtor bewachte, und den Eingang zum Lager der Polen. Ein Mauerbogen überspannte eine breite Zufahrt, die mit einer doppelflügligen Tür versehen war. Ich trat näher und rüttelte an einem der Türflügel; sie waren fest geschlossen, und als ich die Hand zurückzog, hatte ich den Schlick vermodernden Holzes an meiner Handfläche. Ich betrachtete den Verputz. Aus der Nähe konnte man erkennen, daß er schäbig und bröckelig war. Ich zupfte an einer hervorstehenden Ecke; ein handtellergroßer Fladen löste sich und fiel zu Boden. Ich zerrieb ihn nachdenklich mit dem Fuß und schaute an der Fassade entlang nach oben. Die Farbe war überall verblichen, und wo sich das Wasser hatte sammeln und ablaufen können, hatte es lange, moosige Streifen gebildet, die wie mißgünstige Barte von den Ecken und Kanten nach unten hingen. Die Fensterscheiben in den oberen Stockwerken waren heil; im Erdgeschoß waren sie eingeworfen. Kinder, für die es eine Mutprobe bedeutete, in einem verlassenen Haus etwas zu zerstören. Das Haus sah so unbewohnt aus, wie es nur sein konnte. Es schien Kälte auszustrahlen, und obwohl es zwischen anderen Gebäuden stand, wirkte es einsam wie die verlassene Kate eines Einsiedlers. Dann machte mich etwas stutzig.
Ich trat wieder auf die Straße zurück, um besser sehen zu können. Die von der Sonne beschienenen Fassaden der gegenüberliegenden Häuser spiegelten sich in den unversehrten Scheiben. Ich drehte mich um; was direkt gegenüberlag, waren Lagerhäuser und Stadel; die Wohnhäuser begannen erst wieder unterhalb der Wirtschaftsgebäude. Ich hielt die Hand über die Augen und betrachtete eines der Fenster im oberen Stockwerk.
Ich konnte es zuerst nicht richtig erkennen. Das Glas spiegelte, und das Fenster war von innen mit einer Decke verhängt. Aber von meinem neuen Standpunkt aus war es deutlich zu sehen. Die Decke war an einer Seite ein wenig zurückgezogen, ganz, als hätte jemand einmal durch das Fenster gespäht und sie nicht wieder richtig zurechtgerückt. Durch den so entstandenen Spalt konnte man ohne Schwierigkeit einen Teil der Fensterbank sehen. Eine brennende Kerze stand darauf.
»Ist es nicht schade, wenn ein Haus so verkommt?« fragte eine weibliche Stimme neben mir, und ich fuhr herum.
Ich wußte nicht, wie sie so lautlos neben mir erschienen war. Sie trug einen Mantel aus blauem Atlas, auf dessen dunkler Oberfläche ein Granatapfelmuster schimmerte, und darunter ein Kleid aus dunkelgrünem Damast, dessen Rock sich weit um ihre Beine bauschte und mit einem breiten Rand von schwarzem Pelz abgenäht war. Schwarz war auch das gefältelte Tuch in ihrem Dekolleté. Die Taille war tiefer gesetzt, als es der Mode entsprach, und ihr silberverzierter Gürtel ließ erkennen, daß sie beinahe zu schlank war. Die Spitzen von hohen, schmalen Schuhen, die bereits vom Schmutz der Gasse überzogen waren, ragten unter dem langen Rock hervor. Als ich den Blick hob, sah ich in ein Paar glänzend dunkler Augen, in denen sich der Streifen Himmel hinter den Fassaden spiegelte, eine entschlossene Nase und die Schatten von Fältchen um die Mundwinkel, die sich bei einem Lächeln sicherlich in kleine Grübchen verwandelten und die in vorteilhafterem Licht kaum zu sehen gewesen wären. Ihr Haar war in der Art der polnischen Edeldamen aufgesteckt. Es war von einem matten Blond, das seltsam mit den dunklen Augen kontrastierte. Sie war nur unwesentlich kleiner als ich. Sie hielt ihren Oberkörper mit beiden Armen umfaßt und spähte mir mit verengten Lidern ins Gesicht, als wäre sie ein ganz klein wenig kurzsichtig.
Ich bemühte mich, nicht zu zeigen, daß mich ihr plötzliches Erscheinen erschreckt hatte. Ich starrte sie an, und sie gab meinen Blick ruhig zurück. Die Ruhe wollte nicht zu den rastlosen Bewegungen ihrer Hände passen, mit denen sie ihre Oberarme knetete. War sie aus dem alten Haus gekommen? Ich mußte mich ermahnen, nicht zu der brennenden Kerze hinaufzuschauen.
»Das Haus«, sagte sie. »Es wäre ein schönes Wohnhaus, aber es zerfällt. Bald wird es nur noch eine Ruine sein.« Ihre Stimme war sanft und tief, und erst jetzt bemerkte ich den Akzent: Sie dehnte die Vokale länger, als es richtig gewesen wäre.
»Niemand scheint es zu wollen«, sagte ich verwirrt.
Sie zuckte mit den Schultern. Ich fand meine Geistesgegenwart wieder und machte ein paar Schritte von dem Haus weg die Gasse hinunter, und zu meiner Verblüffung folgte sie mir.
»Wenn das so ist, sollte es der Stadtkämmerer den Armen als Behausung zuweisen. Ich habe gesehen, daß Familien draußen vor den Toren in selbstgezimmerten Bretterbuden hausen«, erklärte sie.
»Die Leute vor der Stadt sind keine Bürger«, sagte ich. »Niemanden schert es, wie sie leben. Sie gehören nicht zur Stadt.«
»Ich dachte, es seien – wie sagt man bei Euch: Pfahlbürger?«
»Ihr meint: Ausbürger; die Menschen, die auf dem Lande wohnen, aber sich der Stadt verpflichten, um ihren Pflichten gegenüber ihren Landherren ledig zu werden. Diese Menschen hausen gewöhnlich nicht außerhalb der Stadtmauern und leben von den Abfällen, die dort heruntergeworfen werden, sondern bearbeiten redlich ihr Land und liefern ihre Produkte in die Stadt. Was Ihr gesehen habt, ist land- und besitzloses Gesindel, um das sich niemand kümmert.«
Sie schniefte unzufrieden.
»Auch bei uns ist das so«, erwiderte sie. »Es ist kurzsichtig. Wenn man sich um die Armen besser bemühen würde, müßten sie nicht vom Betteln und vom Straßenraub leben, und die Stadt wäre sicherer. Letztendlich würde das den Behörden sogar Geld sparen.«
»›Bei uns‹«, sagte ich. »Wo ist das?«
Sie lächelte plötzlich, aber es war ein gezwungenes Lächeln, das zu viele Zähne zeigte.
»Ich gehöre zur Vorausdelegation des Hochzeitszuges«, erklärte sie. Ich betrachtete sie aufmerksam; sie erstaunte mich nicht nur aufgrund ihrer Sprachkenntnisse. Sie war mir nicht aufgefallen, als ich gestern mit den Polen gesprochen hatte, und es konnte durchaus sein, daß sie mich belog. Ich sah zum zweiten Mal auf ihre Hände hinunter. Sie waren noch immer so rastlos wie zu Beginn.
»Ich habe Euch gestern gesehen, als Ihr mit den anderen Mitgliedern der Gruppe gesprochen habt«, fuhr sie fort.
»Ich habe Euch nicht gesehen. Und dabei dachte ich, Herr Moniwid hätte mir jeden seiner Begleiter vorgestellt.«
»Ich bin nur eine Bedienstete«, sagte sie bescheiden. Diesmal war ich sicher, daß sie mich belog. Was ich von ihrem Kleid sah, war zu teuer für eine Zofe; desgleichen die Schuhe, deren Leder unter dem dunklen Stoff des Mantels schimmerte.
»Ich bin erstaunt, daß Ihr Euch die Mühe gemacht habt, die Herren anzusprechen«, sagte sie wie nebenher. »War Euch nicht klar, daß mit ihnen keine Geschäfte zu machen sind?«
Mit dieser Aussage hatte ich nicht gerechnet.
»Was meint Ihr?« fragte ich überrascht.
»Daß die Herren nur von geringem Adel sind, mit notorisch schlecht gefüllten Beuteln«, erläuterte sie. »Ich halte die Idee für naiv, mit ihnen ins Geschäft kommen zu wollen.«
»Ihr seid sehr offen«, brachte ich hervor, und sie errötete. Sie senkte den Kopf, aber ich hatte den Eindruck, daß sie sich bewußt zu dieser Demutsgeste zwang. Wenn sie tatsächlich eine Zofe war, dann war sie die selbstbewußteste Zofe, die ich jemals gesehen hatte.
»Verzeihung«, murmelte sie. »Es liegt an der fremden Sprache. Ich wollte Euch nicht beleidigen.« Sie sah mir wieder in die Augen.
»Euer Einfall war aber trotzdem – nicht zu Ende gedacht«, sagte sie dann mit leichtem Zögern. »Um so mehr, wenn man bedenkt, welches Risiko Ihr damit eingegangen seid.«
Ich versteifte mich unwillkürlich und konnte einen schnellen Blick zu dem alten Haus ein paar Dutzend Schritte weiter die Gasse hinauf nicht unterdrücken. Es stand so unberührt da wie vorhin; niemand spähte aus einem Fenster oder lungerte in einer offenen Tür, bereit, sich auf mich zu stürzen.
»Wie darf ich das verstehen?« sagte ich. Es war offensichtlich, daß ihr meine Reaktion nicht entgangen war. Plötzlich begann ich mich unter ihrer intensiven Musterung unwohl zu fühlen.
Ihr Miene war unbewegt, aber die Stimme angespannt, als sie sagte: »Liegt nicht eine Strafe darauf, vor der Ankunft der Hochzeitsgesellschaft heimlich Handelsgeschäfte mit den Delegationsmitgliedern anzuknüpfen?«
»Nun …«, sagte ich, aber sie fuhr fort: »Besonders, wenn man dies unter Umgehung der Zunft zu tun versucht. Oder täusche ich mich in meiner Annahme, und Euch hat die Zunft ausgesandt?«
»Nein«, stotterte ich. »Die Zunft hat damit nichts zu tun …«
Sie sah mich mit einem Ausdruck an, in dem ich nur Mißtrauen lesen konnte.
»Dann kann ich nicht verstehen, weshalb Ihr das Risiko einer hohen Geldstrafe eingegangen seid für eine so kleine Gewinnchance. Für einen Kaufmann scheint Ihr nicht viel von Eurem Geschäft zu verstehen.«
Ich öffnete den Mund, ohne etwas herauszubringen. Ihre Hände waren jetzt ruhig, aber ich sah, daß sie sie fest um ihre Ellbogen geklammert hatte. Sie kniff die Augen zusammen, dann überraschte sie mich plötzlich mit einem breiten Lächeln, das nicht echter wirkte als ihr erstes, aber nach ihrer mißtrauischen Miene völlig unerwartet kam. Sie senkte den Kopf erneut, ohne jedoch die Augen von mir zu lassen.
»Ich habe mich wohl wieder anders ausgedrückt, als ich es eigentlich wollte«, sagte sie halblaut. »Ich muß Euch erneut um Verzeihung bitten.«
Ich besann mich und sagte: »Man hat mir mitgeteilt, die Nichte Eures Königs befände sich unter der Delegation. Sie war es, mit der ich Geschäfte machen wollte.«
Sie schnaubte.
»Das hört sich vernünftiger an. Aber fürchtet Ihr das Verbot nicht?« Ich setzte mein strahlendstes Lächeln auf. Vermutlich kam es bei ihr ebenso falsch an wie ihres bei mir.
»Ihr werdet mich doch nicht verraten, oder?« fragte ich sie. »Wäre es umgekehrt, würde ich mir für Euch jedenfalls die Zunge herausreißen lassen.«
Wenn ich gehofft hatte, damit ihr Mißtrauen zu zerstreuen, hatte ich mich geirrt. Sie zog die Schultern hoch, und ihre Miene verfinsterte sich jäh.
»Ich habe nichts Unrechtes getan«, rief sie.
»Ich wollte Euch nichts nachsagen«, sagte ich und hob abwehrend die Hände.
»Wie sollte ich auch etwas gegen Eure Gesetze anstellen?« fragte sie ruhiger. »Ich tue nur, was meine Herrin mir aufträgt.«
Aus einem Einfall heraus fragte ich: »Hat sie Euch beauftragt, mich anzusprechen?«
Sie antwortete nicht. Statt dessen zog sie den Mantel um ihre Schultern und sagte: »Ich muß gehen. Es tut mir leid, daß ich so harsch mit Euch gesprochen habe. Manchmal fallen mir die richtigen Worte nicht ein.«
Ich rief: »Wer ist Eure Herrin?«
Sie wandte sich zum Gehen, aber dann drehte sie sich doch nochmals um. Jetzt lächelte sie zum ersten Mal, ohne sich dazu zwingen zu müssen. Scheinbar amüsierte sie sich selbst über ihre Antwort.
»Die Gräfin Jagiello; die Nichte von König Kasimir«, erklärte sie. Ich war so überrascht, daß ich für einen Moment vergaß, meiner Rolle treu zu bleiben.
»Wenn sie zurückkommt«, sagte ich dann hastig, als sie mir wieder einfiel, »würdet Ihr ihr ausrichten, daß ich sie sprechen möchte? Sie wurde wohl zur Prinzessin gerufen, habe ich erfahren, um ihr seelischen Beistand zu geben.«
Sie sah mir wieder in die Augen.
»Wenn sie zurückkommt«, sagte sie ruhig, »werde ich ihr es ausrichten.«
Ich sah ihr bestürzt hinterher, als sie mit hastigen Schritten die Gasse hinauf eilte. Wenn ich ihren Blick und ihren Tonfall richtig gedeutet hatte, hatte sie eine ganz andere Antwort auf der Zunge gehabt: Wenn du glaubst, was man dir über den Aufenthaltsort der Gräfin erzählt hat, bist du ein noch größerer Narr, als ich angenommen habe.
Ich gab mich nicht der Täuschung hin, daß dies ein zufälliges Gespräch gewesen war. Sie hatte die Begegnung mit mir gesucht, und sie hatte versucht, mich auszuhorchen; ihre Anspannung hatte sie verraten. Ich dachte an ihre glänzenden Augen und die Grübchen um ihre Mundwinkel, und der Gedanke, sie könnte in die Ermordung der Gräfin verwickelt sein, begann mir zu mißfallen. Ich wußte, daß sie kein einziges wahres Wort über sich selbst gesagt hatte; ebenso wie ich, und ich nahm an, daß ihr das durchaus bewußt war. Aber was war der Grund für ihren Auftritt?
Ich wußte noch nicht einmal ihren Namen. Ich hob die Hand und wollte ihr hinterherrufen, aber dann senkte ich sie wieder und schloß den Mund. Ich beobachtete, wie ihre Gestalt um die leichte Krümmung verschwand, die die Gasse hinter dem alten Haus beschrieb. Verwirrt wandte ich mich ab.
Ich stapfte in die Altstadt zurück, in der sich das Treiben mittlerweile beruhigt hatte, um Hanns Altdorfer über die Kerze in dem verlassenen Haus Bescheid zu geben und danach mein Pferd zu holen. Er war nicht in seiner Amtsstube zu finden, aber ich bat einen seiner Schreiber auszurichten, daß ich den Stadtkämmerer morgen früh wieder aufsuchen wolle. Als ich das Rathaus verließ, fühlte ich mich beinahe erleichtert, meinem Freund nicht begegnet zu sein; es gab noch etliches, worüber ich in Ruhe nachdenken mußte. Ich holte mein Pferd, zankte mit dem Wirt, der noch einmal zwei Pfennige für Heu wollte, das mein Gaul angeblich gefressen hatte, aber ich konnte lauter schreien als er, und nachdem schon ein paar Gäste den Kopf zur Wirtsstube herausstreckten, gab er nach und erließ mir jede weitere Zahlung. Ursprünglich hatte ich bei ihm einen Bissen essen wollen; ich unterließ es und ritt mit knurrendem Magen und leichtem Schwindelgefühl davon.
Vor dem Spitaler Tor war ein kleiner Menschenauflauf. Als ich näher kam, sah ich, daß einem großen Holzkarren auf dem höllischen Katzenkopfpflaster ein Rad abgesprungen sein mußte: Seine hoch aufgepackte Ladung aus wenigstens mannsstarken Asten und Stämmen hatte sich selbständig gemacht und blockierte in einem gewaltigen wirren Haufen die Tordurchfahrt. Die drei Holzknechte, die die Ladung begleitet hatten, kletterten dazwischen mit hochroten Köpfen umher und versuchten nervös, wenigstens eine schmale Gasse freizuräumen. Der Wachführer der Torwache feuerte sie mit phantasievollen Beschimpfungen an, die der gaffenden Menge ab und zu ein schadenfrohes Gelächter entlockten.
Es war klar, daß die Räumungsarbeiten noch eine Weile in Anspruch nehmen würden. Ich trieb mein Pferd an den Stadeln und Malztennen vor der Heilig-Geist-Kirche vorbei in die Neustadt hinüber und verließ die Stadt durch das Kapuzinertor, das nur eine Viertelmeile weiter flußabwärts lag. Es war ein Umweg, denn das kleine Wehr über die Isar, das hinter dem Kapuzinertor lag, führte nur zu den Bleichmühlen auf der Flußinsel und war für alle Passanten außer den Tuchmachern und Färbern gesperrt; ich mußte daher an der Stadtmauer entlang wieder flußaufwärts reiten, um zum Inneren Isartor und der ersten der beiden Brücken zu gelangen. Aber ich hatte den Eindruck, daß ich auf diese Weise immer noch schneller war, als wenn ich auf die Erledigung der Sisyphusarbeit am Spitaler Tor gewartet hätte.
Das Wehr, das einen Teil des Isarwassers aus dem südlichen Flußarm durch den Bleichgraben in den nördlichen Flußarm umleitete, war wie der Graben selbst auf Anforderung der Tuchmachergilde erstellt worden. Das Wasser, das durch den Graben lief, betrieb die Bleichmühlen, deren Klopfen man an den Tagen vor einem Wetterumschwung bis zu meinem Hof hinaus hören konnte. Im allgemeinen war das diesseitige Flußufer immer mit ein paar johlenden jungen Burschen besetzt; nicht wenige Frauen arbeiteten als Bleicherinnen in den Mühlen, und an warmen Tagen schlugen und drehten sie die Tuche in großen Zubern am jenseitigen Flußufer, während ihre triefend nassen Schürzen eng an ihren Körpern klebten und mehr enthüllten als verbargen. Ich hatte aufgrund der schlechten Witterung nicht erwartet, daß sich jemand am Flußufer aufhalten würde; um so erstaunter war ich, wenigstens zwei Dutzend Menschen vorzufinden, die sich am Wasser drängten und die Hälse ausrenkten; selbst ein paar von den Torwachen waren darunter. Sie wichen auseinander, als sie die Hufe meines Pferdes hörten, und mein Gaul betrat von selbst die Gasse, die sie bildeten. Auf seinem Rücken hatte ich einen Ehrenplatz, um das Geschehen zu beobachten.
Das Wehr war im wesentlichen eine gerade Reihe aus mächtigen Holzpfählen, die in Abständen in den Flußboden getrieben waren. An ihnen waren Bohlen befestigt, die das Wasser in den Bleichgraben umleiteten, und ein wackliger Steg, der über die Wehrkrone zur Flußinsel hinüber führte. Je nach Wasserstand mußten Bohlen hinzugefügt oder weggenommen werden, um die Menge des abgeleiteten Wassers zu kontrollieren. Es war eine Aufgabe, die einige Erfahrung verlangte: Besonders im Frühjahr konnten sich die Wassermengen, die der Fluß transportierte, rasch ändern, und wenn man die Änderungen nicht im Ansatz erkannte und so schnell wie möglich handelte, konnte von einem katastrophalen Rückstau, einem Bruch des Wehrs bis zu einem kurzfristigen dramatischen Sinken des Wasserspiegels hinter dem Wehr alles passieren. Im Wasser treibende Aste und sonstiges Bruchholz waren eine weitere Gefahr, die sofort beseitigt werden mußte, wollte man nicht Schäden an der Konstruktion des Wehrs riskieren. Die Tuchmacher hatten aus diesen Gründen eine ständige Wache auf dem Wehr postiert, ein kleines Häuflein kräftiger Männer, die mit ihrem Hiersein ganz nebenbei auch noch verhinderten, daß Unbefugte das Wehr benutzten, um auf die Insel zu gelangen.
Zwei dieser Männer waren im Augenblick damit beschäftigt, eine Schlinge um einen Gegenstand zu werfen, den der Wasserdruck gegen das Wehr preßte. Sie stießen mit langen Stangen hinab, um die Schlinge fachgerecht befestigen zu können; man konnte es dumpf poltern hören, wenn das Treibgut sich herumdrehte und wieder gegen die Bohlen schlug. Plötzlich kam der Gegenstand einen Augenblick an die Wasseroberfläche und rollte herum, und ich erkannte, daß es ein menschlicher Körper war. Während ich noch schockiert den Bemühungen zusah, die Wasserleiche zu bergen, wurde mir klar, daß sich die Zuschauer ihretwegen hier eingefunden hatten – die Beseitigung eines ausgerissenen Baumstammes hätte sicherlich keinen Hund hinter dem Ofen hervorgelockt.
Schließlich gelang es, die Schlinge so festzumachen, daß ihr Sitz den Anforderungen der beiden Wehrhüter entsprach. Sie packten das Hanfseil zu zweit und zogen die Leiche am Wehr entlang auf das diesseitige Ufer zu. Das Wasser wurde rasch seichter, je näher sie dem Ufer kamen; bald lief der aufgeschwemmte Körper auf Grund und widersetzte sich allen Bemühungen, dem Zug des Seils zu folgen. Die beiden Männer fluchten und machten Anstalten, in das Wasser hineinzuwaten; zögernd folgten ihnen ein paar jüngere Zuschauer, und gemeinsam gelang es ihnen, die Leiche bald schleifend, bald rollend über den Kies an Land zu bringen. Die Menschen wichen zurück, als sie völlig im Freien lag, nur um gleich darauf einen noch dichteren Ring darum zu schließen. Ich auf meinem Gaul behielt trotzdem mühelos den Überblick, wenn ich auch nicht besonders begierig darauf war.
Es handelte sich um einen Mann, wenngleich nur die Kleidung diesen Umstand verriet und nicht sein Gesicht; soweit man ein Gesicht nennen konnte, was sich zwischen einem nassen Schopf dunkler Haare und dem Kragen seines Kittels befand. Er mußte schon seit mehreren Tagen im Wasser gelegen haben, und die Fische hatten sich an dem gütlich getan, wozu ihnen die Kleider den Zugang nicht verwehrten. Die Wehrhüter hatten ihn auf den Rücken gelegt, und seine Arme standen steif und halb abgewinkelt in die Höhe, als wolle er sein Erstaunen darüber ausdrücken, daß man ihn aus dem Wasser gezogen hatte. Das Wasser rann in kleinen Bächen an ihm herab.
Die Empfindsameren unter den Zuschauern wandten die Köpfe ab oder machten das Kreuzzeichen; die jungen Männer, die den Wehrhütern geholfen hatten, wischten sich die Hände an ihren Hosenbeinen ab und versuchten, ihren Ekel vor dem aufgedunsenen Leib zu verbergen. Alle standen tatenlos um die Leiche herum und starrten auf sie hinab; wenn die Fische seine Augen nicht schon aufgefressen hätten und der Tote wundersamerweise wieder zum Leben erwacht wäre, hätten ihn die vielen Gesichter vermutlich sofort wieder zu Tode erschreckt.
Die Torwachen erinnerten sich ihrer Pflicht und drängten nach vorne, um die Zuschauer zurückzuschieben. Einer lief zum Tor zurück und kam gleich darauf in Begleitung seines Wachführers wieder zum Ufer.
»Den hier haben sie eben aus dem Wasser gezogen«, hörte ich ihn sagen.
Der Wachführer betrachtete die Leiche mit ausdruckslosem Gesicht.
»Weiß jemand, wer es ist?« fragte er leise.
»So würde ihn doch nicht einmal seine eigene Mutter wiedererkennen. «
»Durchsucht ihn«, befahl der Wachführer.
Seine Männer sahen sich unangenehm berührt an. Es war klar, daß sich keiner darum riß, dem Toten in die Taschen zu fassen. Schließlich ermannte sich einer von ihnen, legte seinen Spieß nieder und kniete sich neben der Leiche auf den Boden. Er starrte einen Moment lang in das zerstörte Gesicht, und ich war froh, daß ich weit genug entfernt war, um von den Details verschont zu bleiben. Er schluckte und tastete den Körper vorsichtig ab. Ich hatte fast erwartet, daß das aufgeschwemmte Fleisch nachgeben und einen fauligen Geruch verströmen würde, der in Sekundenschnelle alle Gaffer vertriebe, aber es geschah nichts dergleichen. Die tastenden Hände des Wappners erreichten den Rock, der von den aufgequollenen Schenkeln zurückgeschlagen war, und strichen ihn glatt. Sie fanden zwei Taschen und fuhren hinein, aber die Taschen waren leer. Sichtlich erleichtert, erhob sich der Wappner und trat so rasch zurück, daß niemand auf den Gedanken kommen konnte, ihn zu gründlicherer Suche anzuspornen.
»Nichts«, meldete er.
»Dreht ihn um«, befahl der Wachführer ungerührt.
Nach einigem Hin und Her bohrten sie ihre Spieße unter dem Toten in den Kies und benutzten sie als Hebel, um den Körper herumzuwuchten. Die Männer, die als Wache auf dem Wehr arbeiteten, beobachteten sie amüsiert. Sichtlich waren sie den Umgang mit Wasserleichen gewöhnt, aber da niemand sie zur Hilfe aufforderte, hielten sie sich im Hintergrund und hatten ihren Spaß an den bleichen Gesichtern der Wappner. Der Tote drehte sich steif und widerwillig auf die Seite, zögerte einen Moment und plumpste dann auf den Bauch, die Arme eingestemmt, als würde er im nächsten Moment einen Liegestütz machen. Die Sehnen und Muskeln gaben unter dem Gewicht des Körpers nach, und die Arme bogen sich zur Seite, bis er flach auf dem Gesicht lag. Eine Lache breitete sich unter ihm aus und versickerte rasch zwischen den Steinen.
Einer der Zuschauer deutete auf den Hinterkopf des Toten. Das Haar war naß und lag eng am Schädel an. Man konnte deutlich die große Delle knapp über der Stelle sehen, an der der Kopf in das Genick überging.
Der Wachführer trat selbst neben den Toten und beugte sich zu ihm hinunter. Mit einem zögernden Finger strich er über die eingedrückte Stelle.
»Was ist das?« hörte ich ihn murmeln.
»Das wird von seinem Aufprall auf das Wehr verursacht worden sein«, sagte einer der Wappner. Ich blickte unwillkürlich zu den Wehrwächtern hinüber und sah, wie einer von ihnen stumm den Kopf schüttelte. Auch für meine Augen sah es nicht so aus, als wäre die Verletzung durch die Konstruktion des Wehrs entstanden. Wäre die Strömung stark genug gewesen, um ihn mit einer solchen Wucht gegen die Pfosten zu schmettern, hätte sie vermutlich das halbe Wehr davongerissen.
Der Wachführer zuckte mit den Schultern. Er brummte etwas Unverständliches. Ich dachte plötzlich an den Sohn des Sebastian Löw. Ein weiteres Objekt, an dem er seinen Scharfsinn unter Beweis hätte stellen können.
Der Gürtel, den der Tote um den Leib trug, hatte dem Druck des aufgeschwemmten Gewebes standgehalten; er lag wie der Einschnitt einer tiefen Schlucht zwischen den Fleischmassen, die den Stoff seiner Kleidung an Rücken und Hintern spannten. Der Wachführer faßte um den Körper herum und strich den hochgezerrten Rock nach unten; ein kleiner Lederbeutel kam zum Vorschein. Die Menge, die bisher eher stumm den Bemühungen zugesehen hatte, stieß einen einheitlichen Seufzer aus.
Der Wachführer öffnete den Beutel und holte ein paar Tonscherben und ein regelmäßiges, zweifingerdickes Stäbchen daraus hervor. Er starrte beides an, ohne einen Ton zu sagen oder den Eindruck zu machen, daß er sehr viel schlauer daraus wurde. Zuletzt legte er sie neben dem Toten in den Kies.
»So, wie er aussieht, liegt er nicht erst seit gestern im Wasser«, sagte er. Er hob den Kopf und wandte sich an die Männer, die das Wehr überwachten. »Wie kommt es, daß ihr ihn erst jetzt herausgeholt habt?«
»Weil er gerade erst angetrieben wurde«, sagte einer von ihnen herablassend.
»Merkwürdig«, brummte der Wachführer.
»Was ist daran so merkwürdig?« erwiderte der Wehrwächter. »Wer weiß, wo der Kerl ins Wasser gefallen ist.«
»Der Fluß ist lang«, rief eine Stimme aus der Menge.
»Er ist hier in Landshut ins Wasser gefallen«, sagte der Wachführer.
Der Wehrwächter sah plötzlich interessiert aus.
»Wie kommst du darauf?« fragte er.
Der Wachführer hob das Stäbchen vom Boden auf und hielt es in die Höhe.
»Das hier ist ein Siegel, wie es ein Schreiber bei sich trägt. Es trägt das Landshuter Wappen.«
Der Wehrwächter schlenderte heran und ging auf der anderen Seite des Toten in die Hocke. Er nahm das Stäbchen und betrachtete es mit zusammengekniffenen Augen, bevor er es dem Wachführer zurückgab.
»Wenn er hier ins Wasser gefallen ist«, sagte er langsam und nachdenklich, »kann er sich höchstens irgendwo verfangen haben und dort ein paar Tage hängengeblieben sein. Seit heute morgen ist der Wasserspiegel wegen der Regenfälle in den Bergen stark angestiegen; vielleicht wurde er davon losgerissen.«
Der Wachführer verzog das Gesicht.
»Warum nicht?« sagte der Wehrwächter. »Selbst der herzogliche Fischweiher ist über sein Ufer getreten; sein Wasser fließt in die Isar hinein.«
»Woher willst du denn das wissen?«
»Weil man’s mir gesagt hat«, brummte der Wächter und zwinkerte mit einem Auge. »Und weil man seit heute morgen vor unserem Wehr prächtige Hechte aus dem Wasser angeln kann.«
»Ich denke, wir sollten dem Stadtrichter Bescheid geben«, sagte der Wachführer und richtete sich ächzend auf. »Soll er sich um den Kerl kümmern.«
Er steckte das Siegel in seine Tasche und stapfte zurück zum Tor. Ich hörte, wie er im Vorbeigehen zu einem seiner Männer sagte: »Treibt mir die Leute auseinander«, und die Wappner begannen, die Zuschauer mit waagrecht vor den Körper gehaltenen Spießen zurückzudrängen. Einer von ihnen pflanzte sich breitbeinig vor dem Toten auf; allerdings drehte er ihm den Rücken zu. Die Menschen ließen sich davonschieben, wandten sich schließlich ab und kehrten in die Stadt zurück. Auch ich zerrte mein Pferd vom Ufer weg. Ich war nachdenklich. Es war anscheinend niemandem aufgefallen: Der Tote trug keine Schuhe, und um einen seiner bloßen Knöchel lag tief im Heisch versunken ein Rest der Schlinge, mit der seine Füße zusammengebunden gewesen waren.
Während des Ritts nach Hause tauchte ständig das Bild vor meinen Augen auf, wie sie den Ertrunkenen über den flachen Uferkies aus dem Wasser herausgerollt und geschleift hatten, als sei er ein seltsamer, gestrandeter Fisch – oder mehr noch, als sei er ein kompakter Haufen Abfall, der endlich beiseite geräumt wurde, weil er die Augen beleidigte. Er hatte ein seltsames Pathos besessen, wie er da auf dem Rücken lag, seine zu Pratzen aufgeschwemmten Hände mit jener halb erstaunten Geste erhoben und sein Gesicht vom Wasser und den scharfen Zähnen der Fische zu einer Monstrosität verformt, die weniger erschrocken als traurig machte und die keinen Hinweis mehr darauf zuließ, ob die Züge häßlich oder fein gewesen waren, und die jegliche Individualität leugnete. Wie hatte der eine der Stadtknechte gesagt? Nicht einmal seine Mutter würde ihn so wiedererkennen.
Der Gedanke, daß der Körper ein unwichtiges, pathetisches Ding war, wenn die Seele ihn verlassen hatte und das Fleisch nicht mehr beschützen konnte, war mir nicht neu. Zu oft war ich in den ersten Monaten nach Marias Tod schreiend aufgewacht, wenn ich mit schrecklicher Realität davon geträumt hatte, wie ihr Leib verfiel; und nicht nur einmal konnte ich mich nur zähneknirschend davon abhalten, mitten in der Nacht zu den beiden Gräbern hinauszutaumeln und stöhnend und schluchzend die Erde beiseite zu scharren, um sie und das Kind davor zu bewahren.
Doch mehr noch als all diese Überlegungen kreiste der Anblick der Schlinge in meinem Kopf herum, deren Rest sich noch tief im Fleisch eingegraben um den Knöchel des Ertrunkenen befunden hatte. Ich war mir sicher, daß seine Füße zusammengebunden gewesen waren. Hatte man ihn erhängt? Aber wie war er dann ins Wasser gelangt? Wenn er ein Verbrechen begangen hätte, wäre er je nach Strenge des jeweiligen Gerichts am Galgen hängen gelassen worden, bis die Raben ihn von der Schlinge gepickt hätten, oder seine Angehörigen hätten ihn nach drei Tagen abnehmen und verscharren dürfen; in den Fluß wäre sein Leichnam aber keinesfalls geworfen worden. Zudem hätte sich das Siegel und die Tonscherben, von denen ich annahm, daß sie zu einem Gefäß für seinen Tintenstein, einen Lappen und ein oder zwei Federn gehört hatten, nicht mehr in seiner Tasche befunden.
Ich dachte an die beinahe unbedeutend wirkende Delle in seinem Hinterkopf. Vielleicht war er überfallen und totgeschlagen und seine Leiche danach in den Ruß gestoßen worden; die Füße konnten sie ihm zusammengebunden haben, weil sie ihn vorher eine Strecke weit befördern mußten. Aber Räuber hätten nicht nur seine Schuhe gestohlen, sondern seine Taschen ebenfalls leergeräumt, wenngleich sie das Siegel vermutlich fortgeworfen hätten: sicher hätten sie es nicht zurück in die Tasche gesteckt. Vielleicht war er auch nur im Vollrausch ins Wasser gerollt und ertrunken, und das Seil hatte sich später um seine Knöchel gewickelt; es lag genug Abfall und Zeug auf dem Grund des Flusses.
Ich vergaß den Toten wieder, denn zu Hause überfiel mich der Verwalter mit der Frage, ob ich wegen der ausbleibenden Stofflieferung etwas herausbekommen habe, und ich erschrak; weniger aufgrund der Tatsache, daß die Lieferung noch immer auf sich warten ließ, sondern weil ich nicht mehr daran gedacht hatte. Ich habe ein Geschäft, dachte ich grimmig, und ich sollte mich eigentlich auch damit befassen. Ich sagte kurz, daß ich mich auf jeden Fall morgen darum kümmern werde, und beendete das Thema. Mein Verwalter leistete mir daraufhin beim Essen Gesellschaft, ohne noch irgendein geschäftliches Gespräch anzufangen. Er war zu taktvoll, um mich zu fragen, ob man schon etwas über den Mörder wisse, und da wir sonst kein gemeinsames Gesprächsthema hatten, verlief das Essen schweigend. Ich ging früh zu Bett und wälzte mich lange Zeit schlaflos darin herum. Zum ersten Mal seit langen Jahren hatte ich das Gefühl wieder, das mich während meiner Dienstzeit für Bischof Peter ständig begleitet hatte: Das Gefühl, in einen wirbelnden Strudel zu blicken und zu erkennen, daß sich darin Muster ausmachen ließen; zu ahnen, daß man nur den richtigen Blickwinkel finden mußte, um die Muster entschlüsseln zu können; und zu wissen, daß man in der Lage war, diesen Blick zu tun. Es war ein Gefühl der Rastlosigkeit, das einen atemlos machte und zugleich mit Freude erfüllte. Wahrscheinlich war es nicht mehr als das: Jagdfieber.
Ich dachte an die Ereignisse, die zu meinem Bruch mit Bischof Peter geführt hatten; die Ereignisse während des mehrjährigen Krieges zwischen Herzog Ludwig und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg, die mich regelmäßig als Alptraum heimsuchten. Während all der Zeit hatte ich vermieden, mich bewußt mit ihnen zu befassen; der Gedanke daran würde nur die Gewißheit meiner verzweifelten Ohnmacht und meines Versagens auslösen. Jetzt, zu wach, um dösen oder gar schlafen zu können, und meine Sinne in dem gleichen fiebrigen Aufruhr, in dem sie sich damals die ganze Zeit befunden hatten, konnte ich es jedoch nicht verhindern. Ich starrte in die Dunkelheit und erinnerte mich, ohne es wirklich zu wollen, und ich war beinahe erstaunt, wie leicht es war, wenn die Erinnerung nicht in die surreale Welt eines Alptraums verpackt war.
Die politischen Wirren nahmen ihren Anfang auf dem Türkentag zu Regensburg im Jahre des Herrn 1455, als die deutschen Fürsten versuchten, der Tatenlosigkeit Kaiser Friedrichs mit der Wahl eines der ihren zum König entgegenzutreten. Schon dort verfeindeten sich Herzog Ludwig von Niederbayern und Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg, die einstigen Jugendfreunde, wegen der Aufstellung des Kandidaten ernsthaft miteinander. Bis zum Jahr 1459 hatten sie es vermocht, den Großteil der deutschen Fürsten in zwei Lager zu spalten. Selbst Kaiser Friedrich ergriff Partei: Auf der Seite des Markgrafen mischte er sich in die Streitigkeiten ein. Jedem mußte klar sein, daß eine kriegerische Auseinandersetzung jetzt nur noch eine Frage der Zeit war.
Im Frühsommer 1459 verhängte der Kaiser über Ludwig die Reichsacht und betraute Markgraf Albrecht mit der Vollstreckung der Acht. Der Krieg ging in die erste Runde.
Zu diesem Zeitpunkt hatten weder der Bischof noch ich mit den Kriegshandlungen selbst zu tun. Der Bischof weilte die längste Zeit des Jahres in Rom, um sich mit den Plänen von Papst Pius herumzuschlagen, einen Kreuzzug gegen die Türken ins Leben zu rufen; und ich selbst führte einen Teil meiner weltlichen Geschäfte in Augsburg, vollauf damit und mit dem Versuch beschäftigt, meinem fünfjährigen Sohn Daniel das Lesen beizubringen. Das Kriegsgeschehen war ein weit entferntes Rumoren, das sich nachteilig oder vorteilig auf die Handelsgeschäfte des Bischofs auswirkte, meine Sphäre aber ansonsten nicht berührte. Herzog Ludwig geriet ins Hintertreffen und bot Verhandlungen an, während derer er einen halbwegs ehrenhaften Friedensschluß für sich erwirken konnte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ihm aufging, daß er trotz alledem von Markgraf Albrecht vermittels einiger mißverständlich formulierter Paragraphen hereingelegt worden war.
Der Krieg brach im Frühjahr 1460 erneut aus, noch während die päpstlichen Legaten in der halben christlichen Welt Frieden und Einheit gegenüber den Türken predigten. Diesmal erhielt Ludwig die Unterstützung seitens König Georgs von Böhmen, und der eingekreiste Markgraf bot nun seinerseits Friedensverhandlungen an. Papst Pius, in Dingen weltlicher Macht von großer Weitsicht, beauftragte Bischof Peter von Augsburg, die Entwicklung der Angelegenheit weiter im Auge zu behalten, und stattete ihn mit großen Vollmachten aus. Sein Ziel war, seinen Namen in den Chroniken mit einem Sieg über die Türken zu verzieren, und er wußte, daß mit einem in sich zerstrittenen Reich dieser Sieg nicht zu erringen war.
Pius hatte richtig gedacht; die Sache war weder für die beiden streitbaren Fürsten Albrecht und Ludwig bereinigt, noch für den Kaiser, der seine Stellung durch Ludwigs Bündnis mit Böhmen aufs äußerste gefährdet sah. Nach einigen verhältnismäßig ruhigen Monaten überschlugen sich die Ereignisse wieder, als Herzog Ludwig den mit dem Kaiser in Fehde stehenden österreichischen Erzherzog mit Truppen unterstützte. Friedrich ergriff die Gelegenheit beim Schopf (angesichts seines ansonsten sprichwörtlichen Zauderns möglicherweise eindringlich beraten durch Markgraf Albrecht) und erklärte den Reichskrieg gegen den Landshuter. Papst Pius schlug sich auf die Seite Ludwigs, der Bischof und ich begannen mit den ersten Verhandlungen, aber der Krieg hatte sich mit der ihm eigenen Logik zum dritten Mal in Bewegung gesetzt und war bereit, Städte, Dörfer und Menschenleben zu verschlingen.
Im Herbst 1462 belagerte Herzog Ludwig die Stadt Ansbach; das heißt, er beobachtete sie aus der Ferne. Er wagte nicht, einen festen Ring um die Stadt zu legen, der das wirtschaftliche Leben darin zum Erlöschen gebracht hätte. Vielmehr hatte er ein Feldlager in kurzer Entfernung zur Stadt aufbauen lassen, nahe genug, daß man von den Wach- und Kirchtürmen die Staubwolke sehen konnte, die darüber in der Luft schwebte, und vermied es ansonsten tunlich, die Ansbacher zu belästigen. Vielleicht hoffte er, durch seine stumme, drohende Anwesenheit die Ansbacher so weit zu verunsichern, daß sie ihm eine gewaltfreie Kapitulation anboten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Krieg schon wieder festgefahren, und der Bischof und ich folgten abwechselnd dem Troß Herzog Ludwigs und dem des Markgrafen Albrecht; der Bischof wußte, daß unter diesen Umständen, mit der Drohung des nahenden Winters, die Gelegenheit günstig war, einen Waffenstillstand oder gar einen neuerlichen Frieden zu schließen.
Wir bezogen Quartier im Haus eines Landadligen, der sich mit den Erträgen seiner Pächter ein Auskommen gestaltete, das ihm und seiner Familie gerade das Überleben sicherte, ohne ihm Wohlstand zu bescheren, aber auch ohne ihn besorgt in die Zukunft blicken zu lassen. Mit unserer Ankunft und damit dem Beginn des Krieges verwandelte sich seine Sorglosigkeit rasch in Düsternis: Er war nicht reich und nicht gebildet, aber er hatte Augen und Ohren, die weit geöffnet waren, und diese hatten die Nachrichten wohl empfangen, die über die Brandschatzungen und Plünderungen der Söldner beider Kriegsgegner im Umlauf waren. So unglücklich er aber auch darüber war, daß die Kämpfe nun in seine Nähe gekommen waren, so glücklich schätzte er sich doch, uns zu beherbergen. Bischof Peter war ein mächtiger Kirchenfürst, und in seiner (und meiner unbedeutenden) Gegenwart fühlte der Mann sich und seine Familie sicher.
Ich mochte das Quartier. Ansbach lag für einen guten Reiter nicht mehr als eine lange Tagesreise von Augsburg entfernt, mit der Erhebung des Ries als einzigem bedeutenden Weghindernis zwischen hier und dort, und die Möglichkeit, im Zweifelsfall meine Familie relativ schnell erreichen zu können, beruhigte mich. Ich hatte meine Frau und meine Kinder schon seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen; aber obwohl ich wußte, daß es mir der Bischof in diesem Stadium der Geschehnisse niemals erlauben würde, mich für mindestens zwei Tage von ihm zu entfernen, beruhigte mich der Gedanke doch, daß es wenigstens denkbar war, zu ihnen zu gelangen. Ich mochte das Quartier auch noch aus anderen, viel unmittelbareren Gründen. Die Familie des Landadligen bestand aus zwei Töchtern und einem alten Mann, der der Oheim des Landadligen war; die Mutter der Mädchen war vor wenigen Jahren verstorben. Das ältere der beiden Mädchen erinnerte mich an meine älteste Tochter Sabina; sie war zwar um viele Jahre älter, aber sie besaß die gleiche Unbekümmertheit und hatte sich jenes kindliche Maß an Freude und Überschwang bewahrt, das auch Sabina zu eigen war. Sie war angenehm; es machte Freude, sich mit ihr zu unterhalten, und ihre Ansichten glichen in vielem meinen eigenen Gedanken. Wenn ich sie ansah, hatte ich das Gefühl, Sabinas Zukunft zu sehen, und diese Erwartung machte mir Freude. Sie kümmerte sich zusammen mit dem alten Mann um den Haushalt und um ihre jüngere Schwester. Da es der Bischof für unter seiner Würde hielt, sich mit ihr abzugeben, blieb es mir überlassen, mich mit ihr auf die Bedingungen unseres Hierbleibens zu verständigen, und es wurde ein beständiger Ideenaustausch daraus. Sie war begierig zu lernen; sie war noch nie von ihrem heimatlichen Hof fortgekommen und brannte vor Neugierde auf andere Menschen, andere Gegenden und Städte. Sie betrachtete mich bald als einen Freund, ungeachtet des Altersunterschiedes zwischen uns; und sogar ihre Schwester schien mich zu mögen, wenn auch nur aus dem Grund, daß der bärbeißige und ständig übelgelaunte Bischof wenigstens in meiner Gegenwart ab und zu auftaute und ein Lächeln sehen ließ. Ich war gern in ihrer Nähe, ich sah gern ihr Gesicht, ich hörte gern ihre Stimme und fühlte eine seltsame Art von Befriedigung in ihrer Gegenwart, als würde ich mich inmitten meiner eigenen Familie befinden, die ich ansonsten schmerzlich vermißte.
Der Bischof und ich hielten uns beinahe täglich bei Herzog Ludwig auf, der die Kampfhandlungen satt hatte und seine größte Chance, die Front seiner Gegner zu durchbrechen, auf dem Verhandlungswege sah. Zuweilen begleitete uns der Landadlige in das Kriegslager, um seine Neugier zu befriedigen oder um sich wichtig zu machen. Er trieb sich zumeist den ganzen Tag bei den Rittern oder bei den Offizieren der Söldner herum, und auf dem Heimweg glühte er gewöhnlich vor Begeisterung darüber, welches rege Kommen und Gehen unter den kriegerischen Truppen herrschte und wie die Befehlshaber dennoch alles unter Kontrolle hatten. Mehr als einmal drückte der Bischof danach mir gegenüber seine Befürchtung aus, daß die Offiziere ihre das Plündern gewohnten Soldaten bei weitem nicht so sehr im Griff hatten, wie unser einfältiger Gastgeber es vermutete.
»Dieser Tor sollte sich lieber Gedanken machen, wie er seine Familie von hier wegbringt«, sagte er. »Der Winter steht vor der Tür, die Landsknechte wie die Ritter schlafen im Dreck und haben Hunger, und die Lagerhuren sind entweder zu alt oder zu häßlich, um sie auf die Dauer zu befriedigen.«
Seine Worte erfüllten mich mit klammer Sorge, und ich nahm die ältere Tochter eines Abends zur Seite und teilte ihr die Befürchtungen des Bischofs mit; aber sie lachte und sagte halb im Scherz: »Wie sollte ich mich in Eurer Nähe ängstigen?«, und ich war geschmeichelt genug, daß ich meine Ängste für dieses Mal vergaß und auch den Umstand, daß ihr in ihrem Zustand naiver Unbekümmertheit das wirkliche Ausmaß der Gefahr, die ihr und ihrer Schwester drohte, nicht im mindesten bewußt war.
»Wenn die Leute hier so gefährdet sind«, sagte ich einmal zum Bischof, »warum versuchen wir dann nicht, die Verhandlungen so schnell wie möglich zu Ende zu bringen, damit die Truppen aus der Gegend abziehen?«
»Es wäre unklug, die Geschehnisse forcieren zu wollen. Unser Vorteil besteht darin abzuwarten, bis sich eine Konstellation ergibt, an der wir einhaken können.«
»Können wir selbst denn gar nichts tun?«
»Wir könnten eine ganze Menge tun, mein Sohn. Aber wer weiß, ob es das Richtige wäre? Glaube mir, es ist immer besser, so lange zu warten, bis man die Richtung klar erkennen kann, in der man sich zu bewegen hat. Und du wirst zugeben, daß man bei diesen Verhältnissen’ wie sie zwischen den Kriegsgegnern herrschen, froh sein muß, auch nur den Punkt klar zu erkennen, an dem man steht.«
An einem Tag im Oktober – es hatte seit einer Woche ununterbrochen geregnet, und der Schlamm im Feldlager des Herzogs war so tief, daß es möglich schien, ein ganzes Pferd aufrecht darin zu versenken – befanden wir uns in gedrückter Stimmung auf dem Heimweg; nur unser Gastgeber war aufgekratzt. Er saß auf einem neuen Pferd; sein altes hatte er bei einem der böhmischen Offiziere eingetauscht, und wenn er auch sonst von nichts etwas verstand – Pferdekenntnis besaß er. Er war nicht schlecht bei dem Tausch gefahren und saß voller Selbstzufriedenheit fröhlich schnatternd auf dem Rücken seines neuen Gauls. Der Bischof war schweigsam und machte ein grimmiges Gesicht. Der Feldpriester hatte ihn zuvor zu zwei Männern geführt, die man an einem Baum unweit des Lagers aufgeknüpft hatte: Sie waren schuldig befunden worden, Vorräte der Truppe gestohlen zu haben.
»Wenn sie schon Diebe mit dem Tod bestrafen, sind die Verhältnisse schlechter, als ich angenommen habe«, hatte der Bischof dumpf gesagt, während wir mit gesenkten Häuptern zu Füßen der Baumelnden gestanden hatten und der Priester ein Gebet gemurmelt hatte. »Wer weiß, was sich sonst noch alles zugetragen hat, von dem wir nur nichts mitbekommen haben.«
Unser Gastgeber sah die dünne Rauchfahne als erster, die sich über dem geduckten Schatten eines Waldstücks in den grauen Abendhimmel erhob. Sein Plaudern erstarb, und er starrte den Rauch an und danach den Bischof. Die gute Laune verließ sein Gesicht und enthüllte die nackte Panik. Dann kam das Lächeln wieder, als wollte er sich selbst einreden, daß nichts passiert sei; zuletzt verschwand es vollkommen, als er sah, wie sich das finstere Gesicht des Bischofs noch mehr verschloß. Er wurde bleich und schwankte. »Mein Gott«, flüsterte er. »Jesus, Maria und Josef.«
Er schrie auf und hieb seinem Gaul die Fersen in die Weichen; das Tier machte einen Satz und preschte los. Ich spürte, wie sich mein Magen schmerzhaft verkrampfte, und ich starrte den Bischof nicht weniger hilfesuchend an als unser Gastgeber. Er zog die Mundwinkel nach unten und sah böse hinter dem davonsprengenden Mann her.
»Ich habe es ja gesagt«, murmelte er. Sein Kopf ruckte zu mir herum, und an dem plötzlichen Erstaunen in seinem Gesicht konnte ich ermessen, wie schreckensbleich ich selbst sein mußte. Ich hatte Mühe, meine Zügel festzuhalten. Die Umgebung ertrank in einer körperlichen Woge der Angst, die selbst den Bischof ansteckte.
»Komm, mein Sohn«, flüsterte er und trieb sein Pferd an.
Unser Gastgeber war längst im Haus, als wir seinen kleinen Hof erreichten. Zwei der vielen Hunde, die das Gut bewacht hatten, lagen zerhauen in Blutlachen gleich hinter dem Tor, von den anderen war nichts zu sehen. Das neue Pferd schnupperte angewidert an den Kadavern und trottete ungebunden im Hof herum. Die Hälfte des Hauses, die als Stall gedient hatte, war ausgebrannt; daß das Feuer nicht auch auf den Wohntrakt übergegriffen hatte, war nur dem nassen Wetter zu verdanken. Vor dem verkohlten Stalltor schwammen weitere Blutlachen; ein paar nasse Kügelchen ausgerissenen Schaffells rollten im leisen Wind hin und her. Die Eingangstür des Wohntraktes war eingetreten und lag zerbrochen zur Hälfte drinnen, zur Hälfte draußen. Der alte Mann schien noch versucht zu haben, die Plünderer aufzuhalten. Er lag mit eingeschlagenem Schädel unter den Trümmern der Haustür. Neben der Türöffnung an der Außenwand des Hauses war ein dunkler Fleck geronnenen Blutes, als hätte jemand etwas Lebendiges gepackt und mit aller Macht dagegen geschmettert.
All das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste waren die heiseren Schreie, die aus dem Inneren des Hauses drangen und die völlig ohne jede Artikulation den wilden Schmerz dessen herausschrien, der neben den Leichen seiner Kinder auf dem Boden kniete. Ich glitt vom Rücken des Pferdes und wollte in das Haus hineinlaufen, aber der Bischof brachte seinen Gaul mit einem Sprung zwischen mich und die gähnende Eingangstür.
»Bleib hier, mein Sohn«, rief er scharf.
»Sie sind tot!« schrie ich und sah zu ihm auf. Ich konnte nur seinen Umriß gegen den dämmrigen Himmel ausmachen: Die Tränen strömten aus meinen Augen und trübten meine Sicht.
»Sie sind seine Familie«, erwiderte er.
Ich spürte, wie mich die Kraft verließ; im nächsten Moment hockte ich auf dem Boden und versuchte, das heiße Würgen in meiner Kehle zu unterdrücken. Es gelang mir nicht: ich saß mit dem Hintern im Dreck und schluchzte.
Undeutlich sah ich, wie der Bischof abstieg und sich neben mich stellte. Ich versuchte, sein Gesicht zu erkennen, aber meine Augen verweigerten ihren Dienst. Er setzte an, etwas zu sagen, aber es dauerte einen Moment, bis seine Stimme klar war. Aus dem Haus drangen noch immer die gepeinigten Schreie unseres Gastgebers.
»Es ist unsere Schuld«, knurrte der Bischof. »Wir haben zu lange abgewartet. Und wir haben noch Glück gehabt, daß wir nicht selbst hiergewesen sind.«
Ich hörte ihn kaum; ich erinnerte mich, wie sie gesagt hatte, in meiner Gegenwart brauche sie sich nicht zu ängstigen. Ich wollte nicht daran denken, was der Mann, dessen Schreie wir bis hierher hörten, dort drinnen vorgefunden hatte. Ich senkte den Kopf, und die Tränen fielen in meinen Schoß.