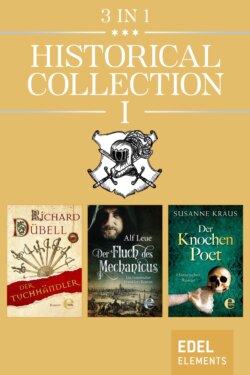Читать книгу Historical Collection I - Susanne Krauß - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAm Samstagmorgen erreichte mich ein Bote; ein erschöpfter Reiter, dem das Unbehagen deutlich ins Gesicht geschrieben stand. Er begrüßte mich mit vertrautem Respekt: Er war einer der Angestellten meines Geschäfts, Jörg Tannberger, dessen älterer Bruder ein Bekannter des Stadtkämmerers war und als Ordonnanz am Hof des Herzogs diente. Tannberger war derjenige, der den Transport meiner Leinenlieferung zu überwachen hatte und gleichzeitig als mein Vertreter bei Walther vom Feld auftrat; es war sein erster größerer Auftrag, und ich hatte ihn damit betraut, weil ich der Ansicht gewesen war, daß die Aufgabe unkompliziert genug war und er außerdem unter den Fittichen des Holländers stand. Ich war zuerst erleichtert, als ich ihn zur Tür hereintreten sah, denn ich dachte, er sei zusammen mit dem Warentransport in Landshut eingetroffen; aber dann bemerkte ich sein düsteres Gesicht und den Schmutz, der von einem langen Ritt ohne Pausen stammte, und das Essen schmeckte mir plötzlich fad. Er war naß vom Regen, der in der Nacht eingesetzt hatte und seitdem ununterbrochen fiel, und ich hieß ihn am Feuer Platz nehmen; er bedankte sich, wischte sich über sein Gesicht, wo seine Hände braune Spuren hinterließen, und nahm dankbar eine Schüssel mit warmer Suppe an.
»Schlechte Nachrichten, Herr«, sagte er, noch bevor er etwas zu sich nahm. Ich warf meinem Verwalter einen raschen Blick zu; dieser hatte sich nach vorn gebeugt und starrte den Boten voller Erwartung an. Sein Gesichtsausdruck wechselte von Spannung zu Bestürzung. »Die Stofflieferung kommt nur zum Teil. Der Treck mit der Seide für die Hofkleidung, den der Holländer beaufsichtigt, ist unterwegs. Sie haben sich gestern in Innsbruck in Marsch gesetzt; sie dürften im Laufe des heutigen Tages Kufstein erreichen und dort auf den herzoglichen Pfleger treffen. Aber die Lieferung Zwilch für die Tischwäsche sitzt noch in Innsbruck fest.«
Die ganze Zeit über hatte ich darauf gewartet, daß die Schwierigkeiten noch größer würden; jetzt war der Moment gekommen. Ich war nicht überrascht. Ich schüttelte den Kopf und sagte ruhig: »Erzähle der Reihe nach.«
Er schniefte und holte tief Luft. Als er die Suppenschüssel neben dem Kaminfeuer abstellte, sah ich, wie seine Hände zitterten. Er war übernächtigt und aufgeregt und voller Angst, weil sein erstes Geschäft sich in ein Fiasko verwandelt hatte. Er war nicht dumm; er wußte, daß es grundsätzlich eine einfache Aufgabe gewesen war, und er wußte auch, daß ein hübscher Batzen Geld darin steckte.
»Wie Ihr mir aufgetragen habt, habe ich mich Herrn vom Feld als Schreiber angedient«, sagte er. »Er war sehr dankbar für Eure Großzügigkeit. Daß ich auf Eure eigene Rechnung noch Leinwand einkaufen sollte, erfreute ihn hingegen weniger, und er war einige Tage lang nicht gut auf mich zu sprechen. Als er jedoch merkte, daß ich besser Italienisch spreche als sein eigener Gehilfe, war ich wieder in seiner Gnade. Es war nicht schwierig, die Samt- und Seidenstoffe in Venedig zu bekommen. Ihr glaubt nicht, über welche Verbindungen dieser Holländer verfügt; selbst beim Dogen wurde er empfangen, und er nahm mich in den Palast mit. Dort stellte ich fest, daß er selbst ausgezeichnet Italienisch spricht. Ich nehme an, er hielt es nur für unter seiner Würde, mit den Krämern und Tuchfärbern zu reden. Der Doge sprach ein paar Minuten mit ihm und versicherte ihm, daß die venezianische Kaufmannsgilde über seinen Auftrag sehr erfreut sei und alles tun werde, um ihm die besten Stoffe zu liefern. Es war allerdings leicht festzustellen, daß die venezianischen Händler die Preise für die Stoffe extrem erhöht haben. Es hieß, man habe alle anderen Aufträge ablehnen müssen, um das große Kontingent an braunem, weißem und grauem Samt herzustellen, und dadurch erhöhte Kosten gehabt.«
»Diese Gauner«, sagte ich beinahe amüsiert. »Sie wollten nur den Umstand ausnützen, daß Herzog Ludwig seinen ganzen Hofstaat einheitlich in seinen Hoffarben einkleiden will.«
»Sie jammerten außerdem, das Angebot sei sehr knapp, weil einige Lagerhäuser überschwemmt und viele Ballen ruiniert worden wären, aber ich hörte, wie Herr vom Feld zu einem seiner Gehilfen sagte, er hätte erst in diesem Sommer Venedig besucht, und die Kanäle wären fast ausgetrocknet gewesen. Ich glaube, die Venezianer haben nur zu gut gewußt, daß wir ihnen ausgeliefert waren.«
»Habt ihr das Fondaco Tedesci nicht eingeschaltet?«
»Die deutsche Zunftniederlassung? Nein, Herr. Sie sind dem Holländer dort nicht grün, weil er sie bei der Anknüpfung des Handels übergangen hat, um bessere Bedingungen zu erzielen. Er dachte, mit seinen eigenen Verbindungen würde er besser abschneiden, als wenn er den Zunftmeistern dort ein paar Prozente abtreten müßte. Vielleicht haben sie auch die venezianischen Händler aufgehetzt.«
»Er hatte sich aber verrechnet«, sagte ich und machte mich darauf gefaßt, gleich zu hören, mein Gewinn wäre zusätzlich zu der Lieferverzögerung auch noch ins Bodenlose abgesunken.
»Nicht ganz, Herr. Wie gesagt, er hat dort sehr gute Verbindungen. Aber es war ein hartes Feilschen, und es zog sich viel länger hin als ursprünglich geplant. Ich mußte ihm wegen meiner Sprachkenntnisse die meiste Zeit assistieren und kam kaum dazu, mich um das Leinengeschäft zu kümmern. Gott sei Dank gibt es so viele Leinenweber in Venedig, daß sie sich nicht alle absprechen und die Preise erhöhen konnten, und so mußte ich nicht viel herumlaufen. Ich habe zu Eurer Zufriedenheit abschließen können, Herr.«
»Bis auf die Tatsache, daß die Lieferung nicht ankommt«, brummte ich, und er verzog wieder das Gesicht.
»Zuerst wollte ich die Leinwand zusammen mit der Seidenlieferung transportieren lassen, aber der Herr vom Feld wollte es mir nicht erlauben. Er sagte, wenn dieses Geschäft auf Eure Rechnung ginge, so müßte ich den Rücktransport auf Eure Rechnung organisieren. Also stellte ich eigene Wagenlenker an; sie durften aber bei der großen Karawane bleiben und in ihrem Schutz reisen. Wir zogen ohne Zwischenfälle bis zum Fuß der Berge. Dort, am Anfang des Brennerpasses, trafen wir auf einen anderen großen Treck. Es stellte sich heraus, daß es der von Herrn Halterspiel war, der eine Samtlieferung aus Florenz nach Landshut transportierte. Es war ihm ähnlich ergangen wie uns in Venedig, nur daß Herr Halterspiel sein Problem mit Hilfe der dort ansässigen deutschen Kaufleute löste. Wir legten die Karawanen zusammen, um besseren Schutz vor den Wegelagerern am Brennerpaß zu haben, aber das Wetter war während der ganzen Überquerung so schlecht, daß keiner von den Buben sich blicken ließ. Die Schwierigkeiten begannen erst in Innsbruck, als wir alle glaubten, das Schlimmste läge schon hinter uns. Wir verbrachten dort ein paar Tage, um die Pferde und Zugochsen zu schonen. Während dieser Zeit muß jemand den beiden Karawanenführern erzählt haben, daß Türkenbanden die Gegend unsicher machen.«
»Lächerlich«, entfuhr es mir. »Die Türken sind wohl schon in der Steiermark gesehen worden, aber doch nicht am Inn.«
»Wie auch immer«, sagte er achselzuckend. »Die Karawanenführer verlangten eine Sonderzahlung wegen der Türkengefahr, und die Herren Halterspiel und vom Feld argumentierten sich mit ihnen die Köpfe heiß. Die Wagenlenker und die Ochsentreiber wollten nicht nachgeben. Ich bin beinahe verzweifelt, Herr; es war zum Wahnsinnigwerden, wenn man den Gesprächen beiwohnte. Die Kerle waren stur wie die Ochsen, die ihre verdammten Karren die Berge hochzogen, und dabei so ängstlich wegen der Türken wie ein Haufen alter Weiber.«
Aus der Ecke, in der die alten Frauen meines Gesindes saßen, erhob sich aufgebrachter Protest. Ich brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Nach einigem Verhandeln einigten sich die Karawanenführer und die beiden Herren auf die Hälfte des geforderten Preises, und die Ochsentreiber luden die Wägen wieder auf. Gestern morgen brachen sie auf.«
Ich wußte, was kommen würde. Ich sagte: »Ohne die Wägen mit der Leinwand.«
Er sah auf und rang beinahe die Hände.
»Herr, Ihr habt mir keinen Ermessensspielraum gegeben, was die Entlöhnung der Wagenführer angeht. Ich konnte auf ihre Forderungen nicht eingehen. Beinahe hätte ich sie soweit gehabt, daß sie auf das Versprechen hin, Ihr würdet Euch die Sache bei der Ablieferung anhören, weitergezogen wären. Aber sie wollten ein Versprechen, das weiter ging als das: Sie wollten hören, daß Ihr Ihnen bei der Ablieferung zahlen würdet, was sie verlangen. Dies konnte ich ihnen nicht zusagen. Als zuletzt der Großteil der Karawane weg war, hatte ich überhaupt keine Chance mehr. Um allein weiterzuziehen, fehlte ihnen der Mut; sie hätten es nicht für noch soviel Geld getan. Es tut mir leid, Herr. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit.«
Es entsprach nicht ganz meinen Gefühlen, als ich sagte: »Schon gut. Es ist nicht dein Fehler.«
Tatsächlich hätte ich ihm ins Gesicht springen mögen. Aber ich zeigte ihm meinen Ärger nicht. Ich hatte die Situation falsch eingeschätzt, und wenn Tannberger sich tatsächlich so schwerfällig betragen hätte, wie ich im ersten Unmut dachte, wäre die Leinwand noch immer auf den Webrahmen der venezianischen Händler. Es war mir klar, daß es ganz allein meine Schuld war. Ich hatte ihm zuwenig Spielraum gelassen. Ich biß die Zähne zusammen und fragte: »Wo ist die Lieferung jetzt?«
»In einem Lager in Innsbruck. Als sie erkannten, daß ich ihnen keine Zugeständnisse machen konnte, brachen die Wagenführer gestern mittag auf zurück nach Venedig. Ich suchte den ganzen Nachmittag noch nach Fuhrleuten in Innsbruck, die bereit wären, die Lieferung zu übernehmen; aber anscheinend war mein Problem bereits überall bekannt, denn die dortigen Kärrner wußten um ihren Vorteil und verlangten ebenfalls viel zu hohe Preise. Am Abend brach ich schließlich auf und ritt die ganze Nacht durch, um Euch Bescheid zu sagen.«
Ich lehnte mich zurück und schwieg eine lange Weile. Zuletzt sagte ich: »Ich danke dir. Iß etwas und leg dich hin. Ich muß nachdenken.«
Der Bote nickte und schlich mit gesenktem Kopf aus der Stube. Das übrige Gesinde nahm seinen Abgang zum Anlaß, ebenfalls so leise wie möglich zu verschwinden.
»Ein großes Unglück«, sagte der Verwalter vorsichtig. Ich stieß den Atem aus. »Das kann man wohl sagen.« »Was sollen wir jetzt tun?«
»Ich weiß es nicht.« Ich war verärgert; gerade jetzt konnte ich ein Problem dieser Art am allerwenigsten gebrauchen. Mein Gehirn war leer. Es machte mir sogar Mühe, mir die in einem Lagerhaus in Innsbruck lagernden Stoffballen vorzustellen. »Ich weiß es nicht«, seufzte ich nochmals.
»Zumindest kommt die Seidenlieferung einigermaßen rechtzeitig an. Darin steckt das größte Kapital«, sagte mein Verwalter. Ich rief ärgerlich: »Ich habe fast hundertfünfzig Gulden in die Leinwand investiert. Glaubst du, ich will diesen Batzen einfach abschreiben?«
»Natürlich nicht. Ich wollte Euch nur vor Augen führen, daß nicht alles verloren ist.« Er breitete die Hände aus, wie ein erschrockener Hund einem anderen seine Kehle darbietet.
»Schon gut«, sagte ich. »Ich wollte dich nicht anschreien.« Er winkte ab; wie immer versuchte er mich nicht nur zu verstehen, sondern auch, mir zu verzeihen.
»Selbst wenn wir gewillt sind, diesen Halsabschneidern in Innsbruck zu zahlen, was sie verlangen, bekommen wir niemals mehr rechtzeitig eine Karawane zusammengestellt. Wir brauchen mindestens zehn Wagen, wenn mich nicht alles täuscht.«
»Das schätze ich auch«, brummte der Verwalter. »Wir können den Boten nochmals genauer fragen.«
»Was nützt es schon? Es würde mindestens eine Woche dauern, bis wir die Lieferung hier in Landshut haben. Bis dahin hat Meister Krel aus Nürnberg sein Zeug zweimal hierher geschafft.«
»Wir können noch froh sein, daß wir die Stoffe nicht aus Ungarn geliefert bekommen«, sagte der Verwalter. »Den Landweg vom Schwarzen Meer über Pest und Preßburg her haben die Türken vollständig unsicher gemacht. Wenngleich auch das kein großer Trost ist«, fügte er hastig an, um nicht einen weiteren Ausbruch meinerseits zu provozieren. Aber ich war weit davon entfernt, wieder aufzufahren. Ich starrte ihn überrascht an. In meinem gelähmten Gehirn war plötzlich eine Idee entstanden; nein, nicht eine Idee, sondern eher ein Fünkchen, ein kleiner Schimmer, der eine Idee ankündigte. Ich bemühte mich krampfhaft, ihn nicht zu verlieren. Was hatten seine Worte in mir geweckt? Welche Assoziation ließ sich mit seinem unzulänglichen Versuch, mich zu trösten, verbinden?
Ungarn.
Ungarische Ochsen und Schafe.
Ich hörte die Stimme von Sebastian Löw: Ein unproblematisches Zusatzgeschäft für den Besitzer des Floßes, nicht wahr?
– den Besitzer des Floßes.
Ich keuchte auf, als mir die Lösung beinahe wie ein vollständiger Plan vor Augen stand. Ich beugte mich nach vorne und packte ihn an den Oberarmen, und er zuckte so erschrocken zurück, daß er beinahe von der Sitzbank gefallen wäre.
»Aus Ungarn!« rief ich. »Ungarisches Rosenöl. Ungarische Ochsen und Schafe!«
Sein Gesicht zog sich in einer Maske des Nichtbegreifens zusammen.
»Ich verstehe nicht...«, stammelte er.
»Gestern«, sagte ich und zwang mich zur Ruhe. Ich ließ seine Arme los und ballte die Hände nervös zu Fäusten. »Gestern sah ich, wie von den Floßländen Hunderte von Ochsen und Schafen zu den Fleischbänken getrieben wurden. Ein Zuschauer sagte mir, die Tiere stammten aus Ungarn.«
»Und?«
»Verstehst du denn nicht?« rief ich. »Sie haben die Tiere mit den Flößen hergebracht. Vermutlich hätte es viel zu lange gedauert, sie aus der ungarischen Tiefebene über Mähren und das böhmische Reich nach Bayern her zu treiben; sie haben sie einfach auf Flöße verladen und die Donau und die Isar hochgetreidelt.«
Er starrte mich an und versuchte, meinem Gedankengang zu folgen. Es dauerte nicht lange; mit einemmal begann er breit zu lächeln.
»Ihr meint, wir lassen die Stoffe auch auf Flöße verladen ... «
»Richtig! Wie lange braucht man von Innsbruck zum Isaroberlauf mit Transportwagen? Das dürften um die vierzig Meilen sein, über den Paß – höchstens zwei Tage. Und mit dem Floß bis nach Landshut? Man braucht die Flöße in dieser Richtung nur mit dem Fluß treiben zu lassen. In vierundzwanzig Stunden lassen sich bestimmt die hundert Meilen von Scharnitz bis nach Landshut zurücklegen. Nochmals zwei Tage. In spätestens vier Tagen haben wir die Stoffe hier; wenn die Näherinnen, die du angestellt hast, fleißig arbeiten, werden sie noch rechtzeitig fertig. Die Prinzessin trifft noch mal sechs Tage danach ein.«
»Meister Krel aus Nürnberg wird schneller liefern können, fürchte ich«, sagte mein Verwalter. Ich kniff die Augen zusammen und lächelte böse.
»Wahrscheinlich«, sagte ich. »Er war von Anfang an eine ernstzunehmende Konkurrenz bei diesem Geschäft. Aber zur Zeit habe ich die besseren Beziehungen. Wenn ich zusichern kann, daß alles zur rechten Zeit bereit steht, werde ich den Auftrag bekommen.«
»Wenn Ihr meint... «
Ich nickte; ich dachte an den Kanzler. Ich hatte kaum jemals gute Beziehungen irgendwohin gehabt, und wenn, hatte ich mich immer gescheut, diese zu benutzen. Jetzt schien einmal eine wirkliche Gelegenheit dazu gekommen zu sein. Ich lachte auf.
»Verlaß dich drauf«, sagte ich.
»Das größte Problem wird dann wohl sein, die Flößer zu beauftragen.«
»Ich glaube nicht«, sagte ich. »Nach dieser Ochsen und Schafelieferung befinden sich eine Menge von ihnen unten am Fluß; sie werden froh sein, einen neuen Auftrag zu erhalten. Flöße und Floßbesitzer, bei denen man die Gefährte mieten kann, dürfte es dann genügend im Gebirge geben.«
»Wir werden eine ganze Menge Flöße brauchen. Eines faßt doch kaum mehr Ladung als ein Ochsenkarren.«
»Na und? Schlimmstenfalls kaufen wir die Flöße auf und verkaufen hier in Landshut das Holz. Ich sehe eher ein Problem, die Leute rechtzeitig zum Oberlauf der Isar zu bringen.«
»Sie könnten mit mehreren unserer Pferde losreiten und die Tiere wechseln, sobald eines müde wird. Wenn sich Ochsen auf den Flößen transportieren lassen, tun es Pferde auch; sie könnten die Gäule auf den Flößen wieder zurückbringen.«
»Gut. Wie bekommen wir die Stoffe rechtzeitig dorthin, wo die Flöße ablegen? Die Wegstrecke ist nicht weit – nur dauert es einige Zeit, eine Karawane zusammenzustellen.«
Ich dachte eine Weile darüber nach.
»Hol mir Jörg Tannberger«, sagte ich schließlich. »Er kann uns weiterhelfen.«
Tatsächlich war er so begierig darauf, seinen vermeintlichen Fehler wiedergutzumachen, daß er darum bat, sofort wieder losreiten zu dürfen, um in Innsbruck alles vorzubereiten.
»Bist du nicht zu erschöpft?« fragte ich ihn.
»Nein, Herr! « rief er. »Ich kann mich bei der Rückfahrt auf dem Floß ausruhen. Bitte laßt mich gehen.«
»Ich habe vermutlich keine andere Wahl«, brummte ich. »Bis sich jemand anderer in Innsbruck zurechtfindet, vergeht zuviel Zeit. Du kennst dich dort schon aus.«
»Sicher, Herr. Ich danke Euch«, sagte er eifrig.
Ich sah die tiefen Ringe unter seinen Augen und daß er seine schmutzigen Kleider noch nicht einmal abgelegt hatte, aber ich kannte den Zustand, in dem er sich befand. Er brannte darauf, seine Scharte auszuwetzen. Ich sagte: »Du bist der Ansicht, daß du den Transport von Innsbruck das Inntal aufwärts schnell genug auf die Beine stellen kannst?«
»In dieser Richtung hat noch niemand einen Türken auch nur von weitem gesehen. Es wird nicht einmal mehr kosten als den üblichen Preis. Und für eine Fahrt von zwei Tagen bedarf es keiner großen Vorbereitungen; ein Treck ist in wenigen Stunden abmarschbereit. Wir müssen den Paß südlich von Scharnitz überwinden, da wird es sogar besser sein, mit so wenig Zuladung wie möglich zu fahren.«
»Dann laß dir für mehrere Männer Essen richten und besorge dir Pferde. Ich reite zur Stadt und treibe ein paar Flößer auf. Komm mir so bald wie möglich nach; wir treffen uns bei der Floßlände.«
Er verneigte sich und verschwand. Ich blieb noch einen Moment sitzen und schaute meinen Verwalter an. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich sollte ihn damit beauftragen, die Flößer unten am Fluß auszusuchen und auf den Weg zu schicken. Ich öffnete den Mund und schloß ihn wieder; es war ein zu großes Risiko. Alles hing jetzt davon ab, wie schnell gute und willige Männer aufzutreiben waren. Ich mußte es selbst erledigen. Ich richtete mich auf und sagte: »Ich reite sogleich los. Du weißt, was du zu tun hast.«
Er nickte und erwiderte: »Ich lasse hier alles für die Abreise richten.«
Ich wußte so gut wie er, daß diese Aufgabe eine Arbeit für die Küche und den Pferdeknecht war und nicht für meine rechte Hand. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber ich konnte mich nicht dazu bringen, das Geschäft jetzt aus der Hand zu geben. Es wäre das Vernünftigste gewesen, besonders in Anbetracht der Tatsache, daß die Aufklärung eines Mordfalles auf mich wartete. Und hatte ich diese Art von Arbeit nicht immer gehaßt? Einen Handel zu organisieren? Aber ich konnte mir nicht vorstellen, meinen Verwalter damit zu betreuen; ich wußte, wie schwierig die Aufgabe war.
Das Gesicht des Verwalters war undurchdringlich, als er mich am Hoftor verabschiedete, und ich konnte nur raten, was in ihm vorging. Ich packte die Zügel, sprang auf mein Pferd und sprengte davon.
Es waren noch genügend Flößer auf dem kiesigen Schwemmlandstück vor der Stadtmauer, daß ich doppelt soviel Leinwand hätte nach Landshut transportieren können. Sie saßen und standen um die Reste eines Feuers herum, das sie in der Nähe der Stadtmauer entzündet hatten; man konnte diejenigen, die aus Landshut waren und in den kleinen Häusern entlang der Stadtmauer lebten, nicht unterscheiden von den Auswärtigen, denn beide Gruppen waren unrasiert und verdreckt, und ich hätte die achtlos herumgeworfenen Knochen und die schräg im Kies liegenden Bierfässer nicht sehen müssen, um zu wissen, daß sie die Nacht hindurch gefeiert hatten. Ich war nicht gerade glücklich über den verkaterten Anblick, den die meisten von ihnen boten: Wie viele würden sich unter diesen Umständen für einen Auftrag entscheiden, der eine Menge Arbeit versprach? Mein Pferd kam auf dem losen Kies ins Stolpern, und ich stieg ab und zerrte es hinter mir her auf die Ansammlung zu.
Als ich näher gekommen war, bemerkte ich, daß einige der Männer sich um einen weiteren Mann gruppierten, der so aussah, als hätte er die Nacht auf anständige Weise verbracht. Ich hörte ihn reden und erkannte, daß es einer der vom Stadtkämmerer mit dem Ankauf des Holzes Beauftragten sein mußte: Er verhandelte den Preis für die schweren Baumstämme, aus denen die Flöße zusammengebunden waren. Die Antworten, die die Flößer mit rauhen Stimmen gaben, waren vernünftig genug. Vielleicht fühlten sie sich nicht so unausgeschlafen und elend, wie einige von ihnen aussahen.
Nachdem sie ihren Handel mit dem Holzbeauftragten abgeschlossen hatten, wandten sie sich mir zu. Es schien, daß sie einen Dreierrat gebildet hatten, der für die Gruppe sprach, solange sie hier vor den Toren der Stadt beisammen waren. Sie grüßten mich mit freundlicher Aufmerksamkeit, als ich mich vorstellte.
»Wären einige von Euch an einem Auftrag interessiert?« fragte ich, und sie sahen sich an und scharten sich dann um mich.
Zuerst waren die Flößer nicht sonderlich begeistert; vermutlich hatten sie damit gerechnet, einen kleineren Auftrag zu erhalten, der sie lediglich ein paar Meilen flußab- oder -aufwärts führen würde. Als ich ihnen auseinanderlegte, worum es ging, schüttelten sie die Köpfe und winkten ab.
»Seht einmal«, sagte einer der von ihnen gewählten Sprecher, während wir auf Holzklötzen um das wiederaufflackernde Feuer saßen und ein paar der Männer die letzten Schlucke schalen Bieres kreisen ließen. »Wenn es stimmt, was man hört, werden zu dieser Hochzeit alle Bürger der Stadt kostenlos mit Speisen und Getränken versorgt; was bedeutet, daß auch die ärmsten unter uns einmal die Gelegenheit erhalten, sich die Bäuche vollzuschlagen und sogar noch etwas mit nach Hause zu bringen. Wir Landshuter Flößer haben die Erlaubnis erhalten, unsere auswärtigen Kameraden zu beherbergen, damit auch ihnen die Großzügigkeit des Herzogs zuteil wird. Keiner will sich das entgehen lassen; darum will keiner zu einer Mission aufbrechen, die ihn vielleicht nicht rechtzeitig zurückbringt.«
»Sie wird ihn rechtzeitig zurückbringen!« rief ich. »Nur dann hat die ganze Sache überhaupt Sinn. Versteht Ihr das nicht?«
»Das Risiko ist zu groß. So eine Freigiebigkeit wie bei dieser Hochzeit erfährt man nur einmal im Leben.«
Ich stöhnte. Als ich mir aufgeregt durch die Haare fuhr, fiel mein Blick auf die im Wasser schaukelnden Flöße. Ich fragte: »Haben die auswärtigen Flößer schon alle ihr Holz verkauft?«
»Nein, noch nicht. Der Holzmeister des Herzogs hat uns mitteilen lassen, daß die Stapelplätze vorerst voll sind und das Holz reichen wird. Ich wage das zu bezweifeln, aber er läßt sich nicht umstimmen.«
»Wie wäre es«, sagte ich, »wenn ich anbiete, daß ich jedem auswärtigen Flößer, der meine Fuhre übernimmt, das Holz zu verkaufen versuche, und ihm vom Gewinn – sagen wir, achtzig Prozent übergebe? Wie wird der Gewinn üblicherweise aufgeteilt? Sechzig zu vierzig?«
»Das hört sich nobel an«, sagte der Sprecher. Er beriet sich eine Weile mit seinen beiden Kollegen, dann rief er die versammelten Flößer zu sich und unterbreitete ihnen meinen Vorschlag. Die hageren, bärtigen Gesichter der Männer wurden nun nachdenklich, und ein paar warfen mir lange Blicke zu, als wollten sie ermessen, inwiefern ich in der Lage war, mein Angebot auch einzulösen. Einige nickten schließlich, aber die Mehrzahl hatte immer noch ein Problem, und diese stimmten die Zaudernden wieder um. Der Sprecher der Flößer wandte sich wieder mir zu.
»Was hattet Ihr Euch als Entlohnung für die Fuhre gedacht?«
»Den üblichen Fuhrlohn, was sonst?«
»Das ist lächerlich.«
»Wieso ist das lächerlich?« fuhr ich auf. »Ich besorge Euch einen Auftrag, mit dem Ihr Geld verdienen könnt, anstatt tagelang hier im Kies zu liegen und auf den Beginn der Hochzeitsfeierlichkeiten zu warten, ohne auch nur einen halben Pfennig einzunehmen. Ich garantiere Euch, daß Ihr rechtzeitig zurück sein werdet, weil auch das ganze Gelingen meines Handel davon abhängt. Und«, ich erhob meine Stimme noch lauter, aber es hatten mir ohnehin schon fast alle zugehört, »und zusätzlich biete ich Euch an, während Eurer Abwesenheit Eure im Wasser verschimmelnden Holzbalken zu verkaufen und Euch fast den gesamten Gewinn davon zu übergeben, obwohl ich die ganze Arbeit damit haben werde.«
Sie steckten die Köpfe wieder zusammen und berieten sich aufs neue, und wiederum war ich gezwungen, der trägen Prozedur hilflos zuzusehen. Die Zeit brannte mir unter den Nägeln, und ich war so überrascht von der Halsstarrigkeit der Flößer, daß ich die in Geschäftsangelegenheiten übliche Diplomatie völlig vergessen hatte. Womöglich hatte ich es mir mit ihnen jetzt vollends verdorben. Ich verdrehte die Augen, während ich mit schmerzendem Gesäß auf dem Holzstumpen saß und ihre Diskussion verfolgte, und ich konnte mir nicht helfen, aber der Gedanke, aufzuspringen und zu rufen: Vergeßt die ganze Geschichte! und meine hundertfünfzig Gulden in den Wind zu schreiben, stieg immer stärker in mir hoch. Ich war beinahe erstaunt über meine eigene Resignation; sonst war ich zäher.
Endlich waren sie zu einem Ergebnis gekommen. Das Stimmengewirr flaute wieder ab.
»Einige der Männer sind aus der Scharnitzer Gegend«, sagte der Sprecher der Flößer. »Sie haben sich bereit erklärt, die Fuhre zu übernehmen; sie sagen, sie wären am besten in der Lage, den Transport so schnell wie möglich abzuwickeln, weil sie die Leute am Ausgangsort kennen und notfalls schnell Hilfe rekrutieren können.«
Ich schloß die Augen und sagte: »Ihre Kinder und Kindeskinder sollen vor Gesundheit strotzen.«
Der Sprecher ließ sich nicht beeindrucken; mit ruhiger Stimme fuhr er fort: »Sie bestehen allerdings darauf, daß Ihr ihnen die Entlohnung sofort auszahlt.«
Ich öffnete die Augen wieder und starrte ihn bestürzt an. Er gab meinen Blick fest zurück, und ich sah, daß sich viele Augenpaare auf mein Gesicht gerichtet hatten. Ich sagte eisig: »Man bezahlt den Fährmann nicht, bevor man übergesetzt hat.«
»Dies ist aber eine ganz besondere Fuhre«, erwiderte der Sprecher und lächelte.
Ich sah von ihm zu den anderen, zu denjenigen, die mich mit brennenden Augen musterten. Kaum einer schlug den Blick nieder. Ich atmete ein und wieder aus; ich wußte, wann ich geschlagen war.
»Also gut. Ich bin einverstanden.«
Der Sprecher der Flößer grinste; er spuckte kräftig in seine rechte Hand und hielt sie mir hin, und ich tat es ihm nach und schlug ein. Auch ich grinste; dann kam mir schlagartig etwas zu Bewußtsein, und meine Freude verflog. Ich ließ seine Hand los und suchte unter meinem Wams herum, aber ich wußte, daß ich nicht finden würde, was ich suchte. Ich hatte keine Veranlassung gesehen, mehr als ein paar Pfennige einzustecken.
»Ich habe nicht soviel Geld bei mir«, sagte ich.
Ein paar der Umstehenden verzogen die Gesichter, und einer zischte hörbar. Der Sprecher der Flößer schüttelte den Kopf.
»Es gibt kein neues Angebot«, sagte er fest. »Die Bezahlung im voraus, oder Ihr könnt den Handel vergessen.«
Ich biß die Zähne zusammen und erwiderte: »Mein Hof ist eine ganze Strecke weit vor der Stadt. Ich muß eigens dorthin zurückreiten.«
»Dann leiht Euch in der Stadt Geld.«
Ich schnaubte unlustig; ich hatte noch nicht daran gedacht. Sebastian Löw kam mir in den Sinn, doch zu ihm zu gehen war mir peinlich. Andererseits war der Weg zu meinem Hof und wieder hierher zurück zu lange; sie mochten es sich nochmals anders überlegen, während ich weg war, oder wieder mit der Sauferei beginnen und dann unbrauchbar sein.
In die Gruppe der Flößer kam plötzlich Bewegung, und mir wurde bewußt, daß sie alle mit einem seltsamen Gesichtsausdruck über meine Schulter spähten. Ich dachte: Tannberger ist schon angekommen; aber er hätte mit den Pferden mehr Lärm gemacht. Ich drehte mich um.
»Guten Morgen«, sagte sie mit ihrer sanften Stimme und neigte mir lächelnd den Kopf zu.
»Was wollt Ihr schon wieder?« entfuhr es mir. Ich hörte, wie ein paar der Männer in meinem Rücken albern zu kichern begannen.
»Ich wollte ein wenig an die frische Luft«, sagte sie unschuldig. Ihre Nervosität von unserer ersten Begegnung schien geschwunden zu sein. Sie verzog die Lippen zu einer amüsierten Schnute. »Ich ahnte nicht, daß sie durch all die Feilscherei mittlerweile so zäh geworden ist.«
»Wie lange steht Ihr denn schon hinter mir?«
»Wenn Ihr damit andeuten wollt, ich hätte Euch belauscht, so scheint diesmal Ihr mich beleidigen zu wollen. Man konnte Euch mit den Männern hier bis hinter die Stadtmauer streiten hören.«
Sie hatte ihr Haar nicht hochgesteckt; es legte sich in einer widerspenstigen Welle um ihre Schultern, und obwohl es nicht den reichen Glanz hatte, der zu einer solchen Kaskade langen Haares gewöhnlich gehört, stand es ihr doch besser als die strengen Zöpfe, die sie gestern um ihren Kopf gewunden hatte. Sie trug wieder ihren dunkelblauen Mantel, den sie in der Art einer Schaube vorne geöffnet hatte; diesmal lag zusätzlich ein schwerer Chaperon um ihre Schultern, dessen Rand mit Goldstickereien abgesetzt war. Ihr Kleid war heute von goldfarbenem Brokat mit einem Blütenmuster und einem weiten Ausschnitt; das Tuch darin war aus blauem Taft. Ich wandte mich wieder an den Sprecher der Flößer, aber meine absichtliche Unhöflichkeit schien sie nicht im mindesten zu veranlassen, sich zurückzuziehen. Sie stellte sich neben mich, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Unruhe über ihr plötzliches Erscheinen stieg in mir hoch und brachte mich aus dem Konzept. Ich mußte mich zwingen, auf den Mann vor mir zu achten.
»Was ist nun?« fragte der Flößer.
»Es dauert zu lange, das Geld zu holen«, rief ich. »Ich gebe Euch mein Ehrenwort; wenn Ihr wollt, unterzeichne ich Euch auch ein Papier.«
»Wer, glaubt Ihr, kann das von den Männern hier lesen?« brummte er. »Zahlt im voraus, wie ich gesagt habe.«
Ich knirschte mit den Zähnen und warf meiner ungewollten Begleiterin einen Blick zu. Sie hob die Augenbrauen und sagte halblaut zu mir: »Laßt es sein, mein Freund. Die Fuhrleute drüben in der Stadt haben inzwischen zugesagt, ohne irgend etwas im voraus zu verlangen.«
Der Sprecher der Flößer und ich riefen gleichzeitig: »Was!?«
Sie richtete den Blick auf den Flößer und lächelte ihn freundlich an. »Wir würden natürlich den Auftrag lieber Euch erteilen«, erklärte sie. »Wenn es darum geht, die Zuverlässigkeit der Flußfahrer mit derjenigen der Fuhrleute zu vergleichen ...«
»Das will ich meinen«, grollte er und blickte mich finster und gleichzeitig geschmeichelt an.
»Wißt Ihr«, sagte sie, als wäre es ihr eben erst eingefallen, »zuerst wollten die Fuhrleute auch einen Teil der Bezahlung im voraus; aber ihr Sprecher – ich habe den Namen vergessen ...«
»Herbert Wagner«, unterbrach der Flößer, »ein feister Mensch mit einem Vollbart und einer eingefetteten Glatze.«
»Das kann sein«, erklärte sie. »Die Namen in Eurer Sprache sind schwer zu behalten. Nun, auf jeden Fall wurde er angesichts dieses Ansinnens seiner Männer wütend. Er sagte ...«
Sie verstummte und senkte den Kopf. Als wollte sie ihre nächsten Worte bei sich behalten, hielt sie sich die Hand vor den Mund. Von meinem Standpunkt aus konnte ich sehen, daß sie amüsiert die Lippen spitzte.
»Was hat er gesagt, dieser Wegelagerer?« fragte der Sprecher der Flößer voll dunkler Vorahnung.
»Daß nur die Gauner von Flußschiffern die Bezahlung im voraus verlangen würden, weil sie wüßten, daß die Hälfte ihrer Flöße ohnehin untergeht«, sagte sie hastig. »Es tut mir leid: Ihr habt gewollt, daß ich das sage.«
Er weitete die Augen und starrte aufgebracht von ihr zu mir. Ich besaß soviel Geistesgegenwart, mit den Schultern zu zucken. Die Flößer hinter ihm begannen laut zu murren und die Fäuste zu ballen.
»Es ist nichts Ehrloses dabei, wenn man den Lohn vorab verlangt – unter diesen Auftragsbedingungen!« rief der Sprecher der Flößer anklagend.
»Selbstverständlich nicht«, sagte sie, und wie sie es sagte, hörte es sich wie das genaue Gegenteil davon an. Er kniff ein Auge zusammen.
»Also gut!« knurrte er dann und sah mich wütend an. »Die Hälfte des Lohns vorab. Was sagt Ihr dazu?«
Ich starrte ihn an.
»Ihr habt die Aussage der Fuhrleute gehört«, sagte ich dann wie im Traum und sah aus dem Augenwinkel, wie die junge Frau neben mir lächelte.
Er stampfte mit dem Fuß auf und ballte die Hände ebenfalls zu Fäusten. Die Hößer hinter ihm riefen durcheinander; ich hörte einen davon sagen: »Gib schon nach!«
Er biß sich auf die Lippen und funkelte die Männer zornig an. Aber seine Schultern sanken herab; er wußte, daß er verloren hatte. Er drehte sich wieder um.
»Ihr seid ein zäher Geschäftspartner«, sagte er zu mir, aber der Blick, den er der Frau neben mir zuwarf, verriet, für wen das Kompliment eigentlich gedacht war. Sie lachte hell auf, kramte in der kleinen Tasche an ihrem Gürtel und holte ein paar glänzende Münzen daraus hervor. Bevor ich einschreiten konnte, hielt sie sie dem Flößer entgegen.
»Betrachtet das als Spende für die Gilde«, sagte sie. »Bestimmt gibt es Waisen, die auf Eure Unterstützung angewiesen sind.«
Ich spürte, wie es heiß in mir emporstieg. Sie hatte mich mit all ihrer Raffinesse übertölpelt wie einen kleinen Jungen; ebenso den Sprecher der Flößer, der die Münzen mit einem verlegenen Grinsen entgegennahm. Was immer sie von mir wollte; nun stand ich zumindest in ihrer Schuld. Ich funkelte sie an, und sie wurde ernst und trat ein paar Schritte beiseite. Sie öffnete den Mund, aber was sie sagte, wurde von dröhnendem Getrappel auf der hölzernen Isarbrücke verschluckt. Ich drehte mich um und sah eine Gruppe von mehreren Pferden mit zwei Reitern über die Brücke sprengen und auf die Kiesbank herunter traben. Einer der beiden Reiter war Jörg Tannberger. Ich warf der jungen Frau noch einen Blick zu, dann eilte ich ihm entgegen. Sie folgte mir zögernd nach.
Ich hob die Hand, und Tannberger hielt an. Er warf meiner Begleiterin einen erstaunten Blick zu, dann beugte er sich eifrig über den Rücken seines Pferdes zu mir herunter.
»Ich – wir – haben uns mit den Flößern einigen können«, sagte ich grimmig. »Die Kerle lagern dort drüben. Geh du schon vor und erkläre ihnen im einzelnen, worum es geht. Von mir haben sie nur einen Überblick bekommen.«
Er fragte nicht, was ich in der Zwischenzeit zu tun gedachte. Er nickte nur knapp und trieb seine kleine Herde wieder an. Ich sah ihm hinterher. Sein Verhalten gefiel mir; er hatte sogar den Pferdeknecht mitgenommen, um mit seinem halben Dutzend Pferde ohne Verzögerungen zur Floßlände zu kommen. Ich selbst hätte es nicht besser machen können.
Ich drehte mich mit einem Ruck zu der jungen Frau um, die die Hände vor dem Schoß übereinandergelegt hatte und mich ruhig ansah.
»Wer seid Ihr?« fragte ich heftig.
»Mein Name ist Jana Dlugosz«, erwiderte sie. »Euer Name ist...«
»Wie mein Name lautet, weiß ich«, unterbrach ich sie unwirsch. » Was seid Ihr?«
»Ich bin die Zofe von Gräfin Jagiello.«
»Hört auf damit«, brummte ich. »Ihr gebt beileibe nicht das Bild einer Zofe ab.«
»Wenn es danach ginge«, sagte sie fröhlich, »wäret auch Ihr nicht, was Ihr seid, denn Ihr gebt manchmal beileibe nicht das Bild eines Kaufmanns ab.«
Ich schluckte es, aber es weckte meinen Zorn.
»Warum habt Ihr Euch vorhin eingemischt?« zischte ich.
»Hätte ich es nicht tun sollen? Es hat sich doch alles zum Guten für Euch gewandt.«
Ich brachte mein Gesicht in die Nähe des ihren. Ich roch den leichten Duft von frischen Äpfeln, der ihr Parfüm zu sein schien, aber ich beschloß, mich nicht davon beeindrucken zu lassen.
»Ihr seid nicht, was Ihr zu sein vorgebt«, sagte ich leise. »Ich weiß nicht, was Ihr vorhabt, und ich weiß vor allem nicht, warum Ihr Euch für mich interessiert.«
»Natürlich wißt Ihr es«, erwiderte sie scharf. Ich zuckte zurück.
Sie seufzte und schien einen Moment nachzudenken. Etwas veränderte sich in ihrem Gesicht, als sei sie zu einem Schluß gekommen. Sie nickte.
»Ich will es Euch so erklären«, sagte sie. »Ihr habt vorgegeben, mit meinen Landsmännern in der Vorausdelegation Geschäfte abschließen zu wollen, entgegen eines Verbots, das von Eurer Stadt erlassen wurde. Kein Kaufmann, der seine fünf Sinne beieinander hat, würde jedoch auf die Idee kommen, mit einem Haufen verschuldeter Raufbolde in Rüstungen Handelsbeziehungen anzuknüpfen. Als ich Euch darauf ansprach, habt Ihr Euch in die Ausrede geflüchtet, Ihr hättet eigentlich mit der Gräfin Jagiello in Verbindung treten wollen; immerhin der Nichte von König Kasimir. Ich sage Euch nun, daß ich auch das für eine Lüge halte. Ich möchte wissen, was Ihr wirklich sucht.«
Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich krächzte: »Ihr redet Unsinn!«
Sie ließ sich nicht beirren.
»Denn«, fuhr sie fort und hob einen Finger, »wenn Ihr als Kaufmann auch nur einen Federstrich in Euren Rechnungsbüchern wert seid, hättet Ihr Euch erkundigt, wie die Verbindungen der Gräfin zum Königshaus und zu ihrem Oheim sind, um festzustellen, ob sich wenigstens mit ihr ein Geschäft lohnt und wie es Eure Chancen verbessern könnte, mit dem Hof selbst in Kontakt zu treten. Ihr hättet nicht bloß auf den Rat Albert Moniwids und seiner Streithähne gehört – und dann wäre Euch unweigerlich zur Kenntnis gelangt, daß zwischen der Gräfin und der Prinzessin nur gegenseitige Verachtung besteht – und dann hättet ihr das Märchen nicht geglaubt, Prinzessin Jadwiga habe nach ihrer Cousine geschickt. Sie würde lieber Kröten schlucken, als sich in irgendeinem Fall an die Gräfin zu wenden.«
Ich sah sie bestürzt an. Wenn Moniwids Ausrede so leicht zu durchschauen war, warum hatte er sie dann gewählt? Oder war die Frage anders zu stellen: Wenn die Ausrede nicht leicht zu durchschauen war, weshalb wußte dann die junge Frau vor mir darüber Bescheid? Als hätte sie meine Gedanken gelesen, sagte sie: »Als Zofe der Gräfin ist mir dieser Umstand natürlich bekannt.«
Es war, als würde mich der Teufel selbst drängen; aber ich mußte herausfinden, was sie noch alles wußte. Ich fragte: »Und wo befindet sich Eurer geschätzten Meinung nach die Gräfin dann?«
Ich hielt meine Ungeduld nur mühsam im Zaum, während sie an ihrer Unterlippe kaute.
»Das weiß ich auch nicht«, sagte sie dann, und zu meiner Enttäuschung klang es ehrlich. Sie lächelte plötzlich: »Vielleicht hat sie einen Liebsten in der Stadt oder auf der Burg?«
»Was wollt Ihr damit sagen?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Nichts«, sagte sie. »Nur ein ganz leises Gerücht.«
»Nennt das Gerücht auch Namen und Adressen?«
Sie legte die Stirn in Falten und sah mich von unten herauf an.
»Nun frage ich mich aber doch, warum Ihr Euch trotz allem, was ich Euch mitgeteilt habe, noch immer für die Gräfin interessiert«, sagte sie.
Ich biß die Zähne aufeinander.
»Reine Neugier«, sagte ich lahm. »Als Kaufmann muß man alles wissen.«
»Wie ich bereits gesagt habe«, erwiderte sie und sah mich nachdenklich an. Ich verfluchte mich für meine Tölpelhaftigkeit und dafür, daß dieses Frauenzimmer offensichtlich schneller denken konnte als ich.
»Ich habe jetzt zu tun«, sagte ich barsch und zeigte mit dem Daumen über meine Schulter hinweg. Ich darf sie nicht aus den Augen verlieren, dachte ich gleichzeitig. Ich muß herausfinden, welche Rolle sie spielt. »Ich wäre Euch dankbar, wenn wir dieses Gespräch ein andermal fortführen könnten.«
»Jederzeit«, sagte sie und betrachtete mich noch immer mit jenem merkwürdig nachdenklichen Gesichtsausdruck, als würde sie gerade versuchen, ihrem Bild von mir einen anderen Anstrich zu geben. »Ihr wißt ja, wo Ihr mich finden könnt«, setzte sie zerstreut hinzu. Sie schüttelte den Kopf, und ihre Augen klärten sich plötzlich auf. Mit einer überraschend offenen Geste hielt sie mir die Hand hin. Ich ergriff sie verblüfft, und sie drückte kräftig zu.
»Auf Wiedersehen«, sagte sie und drehte sich um. Sie schritt zielstrebig über den Kies davon.
Ich spürte, daß ich Kopfschmerzen bekam. Als ich mir mit der Hand über das Gesicht fuhr, roch ich einen Hauch ihres Apfelparfüms. Es roch bestürzend nach Sommer an diesem grauen, kalten Novembertag hier am Fluß, und ich fühlte einen plötzlichen Schmerz, von dem ich nicht wußte, woher er kam.
Es wurde schließlich Nachmittag, bis Tannbergers Gruppe endlich aufbrechen konnte. Ich sah dem Häuflein Männer und Ersatzpferden zu, das mit schnellem Trab durch das Ländtor in die Stadt hinein verschwand, und wußte, daß eine lange Nacht vor ihnen lag und nochmals ein anstrengender halber Tag, ehe sie auch nur Scharnitz erreichten. Jörg Tannberger würde von dort weiterreiten und hoffentlich am Abend in Innsbruck eintreffen, um den Transport der vielen Dutzend Leinwandballen bis zum Mittag des folgenden Tages zu organisieren. Mir wurde das Herz eng, als ich daran dachte, welche Aufgaben noch zu bewältigen waren, bis die Lieferung heil in Landshut einträfe; meine Finger und Zehen juckten, so sehr drängte es mich, den Handel selbst zu retten, und so sehr widerstrebte es mir, die ganze Verantwortung nun dem jungen Mann überlassen zu müssen. Ich seufzte und wandte mich ab, als der letzte Reiter hinter den wuchtigen Flankentürmen des Tores verschwand. Ich konnte nichts mehr tun. Ich wünschte mir, nach Hause zurückzukehren und mich in der Stube vor das Feuer zu setzen, um nachzudenken und mich beruhigen zu können. Doch das war nicht alles, und ich wußte es nur zu gut: Was ich mir eigentlich wünschte, war, nach Hause zu kommen und Maria zu erzählen, was geschehen war. Ich wünschte mir, das Lachen Marias zu hören und ihre Stimme, wie sie sagte: Wenn du alles getan hast, dann vergiß es, bis es wieder soweit ist, daß du etwas tun kannst; und völlig unvermittelt ertappte ich mich dabei, wie ich mich suchend auf der Kiesbank umblickte, ob Jana Dlugosz noch zu sehen wäre. Ich stellte mir vor, daß sie in etwa das Gleiche sagen würde. Ich starrte einen Moment verwirrt zu Boden.
Als ich den Kopf wieder hob, blickte ich die Mauer an, hinter der sich die Stadt duckte. Unwillkürlich suchte ich nach dem Dach des leerstehenden Hauses, aber ich konnte es im Gewirr der Schindeln nicht entdecken. Ich dachte an die verhängten Fenster und die Kerze, die man auf einer Fensterbank hatte stehen lassen; an die Stimmen, die Sebastian Löw gehört haben wollte. Ich war durchaus nicht der Meinung, daß er sich diese Dinge eingebildet hatte.
Jemand bewohnte das Gebäude, ohne daß der Stadtkämmerer davon wußte; oder sollte ich sagen, jemand verbarg sich darin? Gestern hatte ich vorgehabt, Hanns Altdorfer danach zu fragen. Heute dachte ich anders darüber: Altdorfer hätte ein paar Büttel in das Haus geschickt, und diese hätten womöglich nur die Spuren eines nächtlichen Liebeslagers gefunden oder diejenigen verschreckt, die sich tatsächlich darin versteckten. Keines dieser Ergebnisse wollte ich erreichen. Ich mußte mehr darüber in Erfahrung bringen, bevor ich mich wieder an den Stadtkämmerer wandte.
Ich weiß nicht genau, was ich mir vorgestellt hatte, als ich den Plan faßte, das alte Haus zu beobachten; vermutlich eine überwältigende Entdeckung, einen buckligen, vernarbten Riesen mit Mörderhänden und blutunterlaufenen Augen, der aus dem Haustor schlurfte und dem noch das Blut der Ermordeten von den Krallen troff – etwas in dieser Art. Natürlich geschah nichts dergleichen, kein Riese und auch kein normaler Sterblicher ließen sich in oder um das Haus blicken, sooft ich auch meine Runden darum zog: von der Ländgasse durch das Ländtor hinaus zum Landeplatz der Flößer vor der Stadtmauer und von dort durch eines der kleinen Flößertore wieder zurück in die Ländgasse, um die Runde von neuem zu beginnen. Die Männer an den Flößen schenkten mir keine Beachtung; nachdem ein Teil von ihnen in meinem Auftrag davongeritten war, beschäftigten sich die meisten der Übriggebliebenen damit, ihrem Rausch vom Vorabend neue Nahrung zuzuführen. Einige legten jedoch wieder ab und stakten in die Mitte des flachen Isarbetts hinaus, um sieh flußabwärts unter der Holzbrücke beim Spital treiben zu lassen, wo sie außer Sicht gerieten. Ich legte hier und dort Pausen ein, um nicht allzuoft an dem alten Haus vorbeizukommen. Einmal besuchte ich mein Pferd, das ich eingedenk der gestrigen Erfahrung bei den Flößern gelassen hatte, und fütterte es mit einer holzigen kleinen Rübe, die gestern von einem der Vorratskarren gefallen und im Rinnstein der allgemeinen Aufmerksamkeit entgangen sein mußte. Aber sooft ich mich aus der Nähe des Hauses entfernte, plagte mich der Gedanke, gerade jetzt in diesem Moment würde etwas Wichtiges geschehen, und ich eilte voller Unruhe an meinen Beobachtungsort zurück.
Ich trieb dieses Spiel mit wachsendem Unmut und sinkender Begeisterung, bis ein leichter Nieselregen einsetzte, der das schwächer werdende Licht des Nachmittags vollends in eine kalte, unfreundliche Dämmerung verwandelte. Ich begann zu frieren; als der Regen stärker wurde und länger anhielt, verwandelte sich der Boden in der Gasse in eine knöcheltiefe Mischung aus Kot und Lehm, und meine Schritte verursachten unangenehm saugende Geräusche. Mehr als einmal hatte ich das Gefühl, die Stiefel würden mir von den Füßen gezogen. Vorher war ab und zu noch jemand durch die Gasse gekommen; jetzt war ich ganz alleine, und endlich wurde mir klar, wie sehr ich auffallen mußte, wenn ich weiter meine Runden zog. Ich beschloß, meine Wache für diesen Tag aufzugeben, wenn auch mit einem Gefühl der Versäumnis: Mit einsetzender Dunkelheit hätte es durchaus sein können, daß sich ein Licht hinter den verhängten Fenstern entzündet und mir die allerletzte Gewißheit gegeben hätte, daß sich jemand in dem verfallenden Gebäude herumtrieb, der dort nicht hingehörte. Aber nachdem sich die ganzen Stunden über nichts geregt hatte, war ich unsicher geworden. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr schien mir die brennende Kerze gestern wie eine Täuschung der Augen oder eine Spiegelung im Fensterglas, und ich ritt unbefriedigt nach Hause, ohne den Stadtkämmerer aufzusuchen.
Ich nahm meine Runden am Sonntag morgen wieder auf, diesmal in der Menge der morgendlichen Kirchenbesucher versteckt, die in jeglicher Richtung durch die Gasse zogen. Das Wetter war nun schon den zweiten Tag schlecht, mit einzelnen nieselnden Regenfällen und einer feuchten Kälte, die einem den Atem vor dem Mund stehen ließ, wenn man tief genug ausatmete. Ich kannte diese Witterung mittlerweile gut genug. Sie würde lange anhalten und den üblichen Unmut der Landshuter Bürger wecken: Jeden November klagten sie über die trübselige, neblige Feuchtigkeit, die sie nun fast ein halbes Jahr einhüllen würde, und fragten sich, womit sie diese Unbill verdient hätten.
Infolge der tiefhängenden Wolkerfdecke wurde es zu keiner Stunde richtiggehend Tag. Vor allem das Schwemmlandstück vor der Stadtmauer, auf dem die Flößer lagerten, schien sich unter dem düsteren Licht zu ducken, in dem sich Menschen und Bauwerke nur verschwommen abbildeten und das flackernde Feuer am Flußufer einen grellen goldfarbenen Punkt darstellte. Ich hatte mir etwas zu essen in einen Beutel eingesteckt, und ich stand am Flußufer vor der Stadtmauer und kaute hungrig an einem Kanten Brot, während das Licht noch düsterer wurde und sich schließlich von Grau zu Blau färbte. Ich war überrascht, als ich die Vesperglocken hörte; der Tag war leise und unbemerkt zwischen meinen Fingern zerronnen, wie es solche zwielichtigen Herbsttage an sich haben.
Ich fühlte mich ratlos. Ich war mir mittlerweile beinahe sicher, daß meine Runden tagsüber vergebene Liebesmüh darstellten; wenn sich jemand blicken ließ, dann vermutlich zur Nachtzeit. Andererseits sah ich keine Möglichkeit, nachts unauffällig einem Menschen zu folgen, der etwa das Haus verließ; tagsüber wäre es eine leichte Übung gewesen. Ich wußte nicht, wie ich diesem Dilemma begegnen sollte. Wie oft, wenn man nicht weiß, wie man weitermachen soll, setzt man seine bisherige Tätigkeit fort und hofft, der Heilige Geist möge dabei über einen kommen – und so tat auch ich das gleiche: Ich beschloß, noch eine letzte Runde zu drehen, bevor ich mich nach Hause zurückbegab.
Ich hatte die Front des Hauses vorhin erst passiert, bevor ich nach draußen vor die Stadtmauer getreten war; daher marschierte ich zunächst in die Altstadt, um etwas Zeit verstreichen zu lassen. Die Gasse, in der Sebastian Löws Apotheke lag, war düster. Das unruhige Licht der Fackeln, die an der Fassade des Rathauses drüben in der Altstadt steckten, warf matte Flecken und graufarbene Schatten herein und störte eher, als es half. Ich schritt hindurch und hörte meine Tritte an den Häuserwänden widerhallen. Als vorne eine gedrungene Gestalt wie ein Schattenriß auftauchte, stockte ich unwillkürlich, aber es war nur ein Stadtknecht, der neugierig in die Gasse hereinspähte und auf meinen Gruß mit einem gelassenen Kopfnicken reagierte. Ich drückte mich an ihm vorbei in die Altstadt hinaus und war aus keinem bestimmten Grunde froh, die Gasse hinter mir gelassen zu haben.
Ich wandte mich südwärts, in Richtung der Baustelle. Als ich am herzoglichen Zollhaus vorüberkam, sah ich, daß dessen Türen weit offen waren; zwei Männer standen mit einer Fackel gleich hinter dem Eingang und blickten mir entgegen. Einer der beiden machte ein finsteres Gesicht; der andere schien mir vage bekannt, aber erst, als ich näher herangekommen war, erkannte ich Wilhelm Trennbeck, den Stellvertreter des Stadtrichters. Sein Begleiter bewegte sich nicht, sondern starrte nur weiter düster vor sich hin. Gestern nachmittag hatte ich Lärm und Klopfen aus dem ersten Stock des Zollhauses und seines Nachbargebäudes gehört und einen der müßig herumstehenden Gaffer gefragt, was dort vor sich gehe. Ich hatte erfahren, daß man Türen in die Trennwand zwischen den beiden Gebäuden brach, um Platz für einen Speisesaal für die geladenen Fürsten zu schaffen, und daß dies dem Besitzer des dem Zollhaus benachbarten Gebäudes, dem Herrn Contzen von Asch, trotz einer ansehnlichen Entschädigungssumme nicht recht gefallen wollte. Ich nahm an, daß der schlecht gelaunte Mann Contzen von Asch selbst war; aber ich drehte mich nicht um, auch nicht, als die Stimmen der beiden sich plötzlich erhoben wie im Streit. Ich wußte, daß ähnliches auch im Haus von Hanns Altdorfer passierte, in welchem das Brautgemach eingerichtet wurde: Man brach eine Tür vom Tanzsaal des Rathauses in den Raum, der das Brautgemach beherbergen sollte, um den ungehinderten Zugang vom Brauttanz zum Beilager zu gewährleisten.
Ich nahm die zweite, weiter südlich liegende Gasse, über die man von der Altstadt aus die Ländgasse erreichen konnte. Sie führte in einer weiten Rechtskrümmung von der Altstadt fort und an den Fronten einiger Stadel vorüber, deren Ladebalken wie leere Galgen von den Dachfirsten ragten. Sie war ebenso ausgestorben wie die Gasse, in der Sebastian Löws Apotheke lag, und noch um einiges trüber. Ich stolperte durch den aufgeweichten Lehmboden und versuchte, mich von den Rändern der Gasse fernzuhalten. Wie kleine, unregelmäßige Bäche flössen die Fäkalien unten an den Hausmauern entlang; ich hatte kein Verlangen danach, daß sich zu dem klebrigen Lehm auch noch Kot und verfaulende Essensreste an meine Stiefel hefteten. Es war gar nicht so einfach, dem Dreck auszuweichen: Die Hauswände standen eng zueinander, und in dem aufgewühlten Boden suchten sich die flüssigen Bestandteile der Jauche ihren eigenen Weg. Als ich endlich in die Ländgasse hinaustrat, war ich erleichtert. Ich blickte in den Himmel, der sanft und tiefgrau über den Hausdächern lag. Es roch nach Rauch und nassem Lehm. Der Duft des Abendmahls, das überall gekocht wurde, vermochte nicht bis hierher vorzudringen, auch nicht das Scheppern aus dem einen oder anderen Kellerfenster, hinter dem eine Küche arbeitete. Ich hörte nichts außer einem gelegentlichen gedämpften Ruf aus der Altstadt und das leise Gezeter der Möwen und Krähen draußen am Flußufer. Ich wandte den Blick vom Himmel ab, dann wanderte ich wieder an dem altem Haus vorüber und versuchte, nicht zu auffällig in die blinden Fensterscheiben zu starren.
Es gab mehrere Möglichkeiten, sich eine Weile auf unverdächtige Weise in der Nähe eines Hauses aufzuhalten. Ich hatte sie im Laufe der letzten beiden Tage alle ausprobiert: Man konnte einen zufällig des Weges kommenden Menschen aufhalten und sich als Ortsfremder ausgeben, der um einige Auskünfte bat; man konnte gerade vor dem zu beobachtenden Haus ein Problem mit seinen Schuhen (mit dem Mantel, der Mütze, dem Gürtel, als Berittener: mit allen möglichen Utensilien an und um das Pferd) bekommen und anhalten müssen; man konnte mit weitausholenden Armbewegungen so tun, als würde man Häuser zählen und die Ergebnisse auf eine imaginäre Tafel kritzeln; man konnte an einem der benachbarten Stadel klopfen, als suche man jemanden, und hoffen, daß einem für eine lange Weile niemand öffnen würde. Wichtig war, daß man nicht immer die gleiche Erscheinung bot, und so hatte ich meinen Mantel entweder angezogen oder als Umhang um die Schultern gehängt oder lose im Arm (man mußte nur aufpassen, daß man mit der jeweils herrschenden Witterung konform ging) oder gar das Innenfutter nach außen gewendet, was ihm ein völlig neues Aussehen und Farbe gab. Mit der Zeit war ich so damit beschäftigt, meinen jeweiligen Aufenthalt vor dem alten Haus deutlich sichtbar zu erklären, daß meine Konzentration sich eher auf meine wechselnden Verstellungen als auf das Haus selbst richtete. Dies und wohl auch meine mittlerweile eingetretene Erschöpfung mochten daran schuld sein, daß ich den Mann erst nach einigen Momenten erblickte.
Den Mann, der im ersten Stock des Hauses in einem der Fenster stand und finster auf mich herabblickte.
Ich hatte die ganze Zeit überlegt, was ich tun würde, sollte ich unverhofft auf einen der mysteriösen Hausbewohner stoßen. Ich würde mit einem nachlässigen Kopfnicken grüßen, an ihm vorbeigehen, mir sein Aussehen und seine Kleidung einprägen, in die nächste Seitengasse huschen und ihm dann mit weitem Abstand folgen. Ich würde mir jedes Haus und jeden Menschen merken, bei dem der Verfolgte vorsprach, und mit diesem Wissen Hanns Altdorfer versorgen, damit er entweder weitere Erkenntnisse abwarten oder mit einem großen Aufgebot an Stadtknechten zuschlagen und Verhaftungen vornehmen konnte.
All das war meinem Gehirn jetzt völlig entschwunden. Ich sah die dunkle Gestalt im Fenster stehen, vage erleuchtet von einer kleinen Lichtquelle, die sich hinter ihr im Zimmer befinden mußte, und prallte vor Schrecken zurück; fast wäre ich gestolpert. Erst später wurde mir klar, daß er sich so aufgestellt hatte, daß ich ihn sehen mußte; er hatte sogar noch dafür gesorgt, daß ein wenig Licht auf ihn fiel. Ich stand im Schmutz der Gasse, mein Herz klopfte so wild, daß es mich in der Kehle würgte, und ich starrte gebannt zu dem Fenster empor, ohne mich noch zu regen.
Ich weiß nicht, wieviel Zeit so verging: Ich in der finsteren Gassenschlucht, reglos, starr vor Schreck und Überraschung, mit offenem Mund nach oben gaffend, und er oben hinter der blinden Fensterscheibe und der zerbröckelnden Mauer, schweigend, eine massige Gestalt, die sich vom helleren Hintergrund des beleuchteten Zimmers abhob wie ein Schatten, der jeden Moment dunkle Schwingen entfalten und sich auf mich herabstürzen würde. Dann kehrten Leben und Verstand in mich zurück, und ich tat, was ich für das Nächstliegende hielt: Ich räusperte mich, spuckte auf den Boden und begann, mit lallender Stimme ein Trinklied zu grölen; ich tat, als könne ich mich nur mühsam auf den Beinen halten, und torkelte die Gasse hinunter, ohne mich noch einmal umzublicken, bis ich die nächste Stichgasse zu einem der Flößertore erreichte. Dort stolperte ich hinein, prallte gegen eine Hausmauer und lehnte mich dagegen. Mein Herz wollte fast zerspringen, und meine Hände zitterten. Mir war so übel, daß ich mich hätte übergeben können, aber mein Magen war leer, und ich würgte nur trocken. Plötzlich merkte ich, daß mein Körper naß von Schweiß war.
Als ich zu frieren begann, stieß ich mich wieder von der Hausmauer ab und spähte zurück in die Ländgasse hinein. Von hier war die Front des Hauses nicht zu sehen, aber man konnte die Gasse bis zu ihm hin überblicken. Ich versicherte mich, daß niemand in der Gasse stand und nach mir Ausschau hielt. Ich zog den Kopf zurück und atmete auf. Ich spürte mein Herz noch immer in der Kehle, aber mein Atem hatte sich wieder beruhigt. Ich fühlte Erleichterung, daß mir niemand auf den Fersen war, und zugleich dachte ich erbittert: Ich habe es verdorben. Im nachhinein erschien mir meine Verstellung als Betrunkener so lächerlich, daß ich am liebsten meinen Kopf gegen die Wand geschlagen hätte.
Ich schlich nach draußen vor die Stadtmauer, um mein Pferd zu holen; mein Hirn war leer. Ich sagte mir: Es war zu dunkel in der Gasse; er hat dein Gesicht nicht gesehen und von deiner Gestalt bestenfalls einen vagen Umriß. Aber ich wußte selbst, daß es leeres Geschwätz war. Der Mann im Fenster hatte auf mich gewartet; er hatte gewußt, daß ich über kurz oder lang nochmals vorbeikommen würde, und das hieß, er hatte gewußt, daß ich das Haus beobachtete. Während all der Zeit, in der ich mir eingebildet hatte, ihn zu belauern, hatten seine Augen auf mich herabgestarrt.
Die Flößer winkten, als ich mein Pferd losband, und riefen mir etwas zu, aber ich ignorierte sie. Ich fühlte mich schlecht. Das Pferd stolperte durch den Kies, flußaufwärts am Ufer der Isar entlang, bis ich das Ländtor erreichte. Die Wappner dort wiesen mich ab, und ich mußte bis zum Judentor reiten, an den herzoglichen Fischweihern vorbei und die steile Böschung hoch, die zur Straße hinaufführte. Die Torwachen dort ließen mich ein. Ich ritt durch die einsame, dunkel liegende Altstadt, passierte ohne Zwischenfall das Spitaler und das Innere Isartor, ritt mit weit hallendem Hufgeräusch über die erste der beiden Holzbrücken, von der aus man den kleinen Lichtpunkt des Flößerfeuers über das Wasser tanzen sah, und durchquerte das provisorische Gerüst des Äußeren Isartors. Ich wurde von einem Wappner aufgehalten und ausgefragt, doch ich erregte keinerlei Aufsehen. Schließlich stand ich an der Stelle, wo das Terrain gleich hinter dem Tor in die weite Flußniederung überging, in der das Kloster der Zisterzienserinnen und die kleine Pfahlsiedlung darum lagen. Das Gelände war dunkel, und es war keine Menschenseele zu erblicken. Ich fühlte, wie ein Kribbeln meinen Rücken hinunterlief. Ich wandte mich um, aber der Wappner hatte das Tor bereits geschlossen. Es dauerte einen Moment, bis ich den Impuls unterdrückt hatte, dagegen zu schlagen und wieder Einlaß zu fordern.
War es schon in der Stadt nicht ratsam, allein in den verlassenen, nachtdunklen Straßen umherzuspazieren, so galt dies erst recht für eine Pfahlsiedlung außerhalb der Stadtmauern, für die nicht einmal die Gesetze der Stadt galten. Ich hatte mir bislang darüber noch niemals Gedanken gemacht. Ich war ein bulliger Mann, an den sich so schnell kein Gesindel herangewagt hätte, und ich wirkte sicherlich verteidigungsbereiter, als ich es in Wirklichkeit war. Durch mein Pferd hatte ich einen zusätzlichen Vorteil sowohl im Kampf als auch auf der Flucht – wäre in meinem Pferd nur etwas mehr von einem Streitroß und etwas weniger von einem Ackergaul gewesen. Aber auch das konnte man nicht sofort erkennen. Dennoch sah ich mich mit argwöhnischen Blicken um, ehe ich weiterritt. Die schweigende, düstere Gestalt im Fenster, die so offensichtlich auf mein Erscheinen gewartet hatte, hatte mein Gleichgewicht ins Wanken gebracht.
Das Pferd setzte vorsichtig einen Schritt vor den anderen, während es mich den sanften Abhang hinab und den ersten Häusern entgegentrug. Es hielt den Kopf gesenkt, als könnte es so den Boden besser sehen, und ich verfluchte mich dafür, nicht an eine Fackel gedacht zu haben. Ich hing über seinen Nacken gebeugt und spähte voraus, um auf ein Stolpern des Gauls vorbereitet zu sein. Plötzlich stoppte das Pferd, und ich geriet ins Schwanken. Ich richtete mich auf und sah, daß sich mehrere Gestalten in unseren Weg stellten.
Es war eine merkwürdige Situation: Ich sah die Männer, aber ich könnte heute noch nicht sagen, wie viele es eigentlich waren; ihr plötzliches Auftauchen aus dem Dunkeln war wie ein Schock. Ich erblickte sie, und mein Magen zog sich zusammen wie eine Faust, das Blut schoß mir aus dem Hirn, und meine Oberschenkel wurden so weich, daß ich ohne die Unterstützung meines Sattels vom Pferd gefallen wäre. Die Männer traten einen Schritt auf mich zu. Das Pferd warf den Kopf zur Seite, machte einen Satz zurück und blieb daraufhin wieder stehen, den Hals nach hinten gereckt. Ich drehte mich wie in Trance um und sah dort eine weitere Gestalt, die mit verschränkten Armen mitten auf dem Weg stand. Mein Pferd schnaubte und war dann still; die Metallteile an seinem Zaum klinkerten noch einen Augenblick nach. Ich hob die rechte Hand vom Sattelrand und schloß sie um den Zügel und merkte, daß keine Kraft in meinen Fingern war. Ich dachte unzusammenhängend: Nun ist es soweit.
Einer der Männer trat einen weiteren Schritt nach vorne. Eine Armlänge von meinem Pferd entfernt blieb er stehen und sagte deutlich: »Gott zum Gruße, Herr.«
Ich wollte etwas erwidern und brachte nichts hervor. Er wartete einen Moment, dann fuhr er fort: »Hättet Ihr etwas dagegen, Euch einen Moment mit uns zu unterhalten?«
Er stand allein vor seinen Kameraden. Ich dachte: jetzt kannst du ihn niederreiten und in wilder Flucht davongaloppieren, und meine Hand zuckte am Zügel, ohne etwas zu bewirken. Der Mann schien meine Gedanken gelesen zu haben. Er faßte mit beiden Händen die Zügel gleich hinter dem Beißstück, und der Augenblick war vertan. Das Pferd schnaubte widerwillig, aber er ließ nicht los, und es fügte sich in sein Schicksal.
»Worüber?« krächzte ich.
»Vielleicht über Eure Absichten?« sagte er leichthin. Er hatte einen zähen Dialekt, den ich erst vor kurzem gehört hatte, aber mein Gehirn drehte sich zu sehr im Kreis, als daß ich diesen Gedanken hätte festhalten können.
»Wie meint Ihr das?« fragte ich.
»Steigt doch ab, Herr, dann können wir uns besser unterhalten. Meint Ihr nicht?«
»Den Teufel werde ich tun«, stieß ich hervor. Ich hoffte, daß er nicht merkte, wie meine Stimme fast in meinem Hals erstickte.
Er machte eine knappe Kopfbewegung, und seine Begleiter rückten näher. Ich blickte mich um; ich war von einem lockeren Ring umgeben. Ich hörte das Blut in meinen Ohren rauschen. Meine Handflächen juckten plötzlich unerträglich.
»Es ist unhöflich, wenn Ihr auf dem Pferd sitzen bleibt«, sagte er mit unerschütterlicher Ruhe. Ich schüttelte den Kopf.
»Bleibt, wo Ihr seid«, keuchte ich, »wenn Ihr nicht wollt, daß mein Gaul Euch die Gesichter zertritt.«
Der Mann vor mir lachte amüsiert. Plötzlich zog er die Zügel nach unten, und das Pferd mußte den Kopf vor ihm beugen.
»Ich habe Euren Gaul in der Hand, seht Ihr?« sagte er. »Wenn er etwas tut, dann das, was ich will. Steigt ab.«
Ich sah zu ihm hinunter. Ich hätte gerne gesagt: Holt mich herunter, wenn Ihr könnt!; aber ich wußte nur zu gut, daß es ohne weiteres in ihrer Macht stand, mich aus dem Sattel zu holen. Ich hatte Angst davor abzusteigen, und ich hatte noch viel mehr Angst davor, gewaltsam vom Pferd gezerrt zu werden. Ich bewegte meine Beine. Meine Glieder waren steif.
»Also gut«, sagte ich.
Es kostete mich Kraft, auf den Boden hinunter zu kommen. Als ich stand, hämmerte mein Herz so gewaltig, daß es mich schmerzte.
»Nun?« sagte ich und blinzelte; ich rechnete jeden Moment damit, daß sie sich auf mich stürzen würden. Aber alle blieben an ihren Plätzen. Der Mann, der die Zügel meines Pferdes hielt, schien eine Weile nachdenken zu müssen.
»Wie ist Euer Name, Herr?« fragte er schließlich.
Ich antwortete: »Wie ist Eurer?«
Er lachte wieder, und es schien, als würde er verständnisvoll nicken. Dann sagte er scharf: »Euer Name ist Peter Bernward. Ihr seid Kaufmann. Wo ist Euer Geschäft?«
Ich wiederholte stur:
»Wie ist Euer Name?«
»Mein Name ist Wohlbefinden!« zischte er so plötzlich, daß ich zusammenzuckte und das Pferd einen kleinen Sprung zur Seite machte. »Falls Ihr mir sagt, was ich wissen will. Im anderen Fall heiße ich Unbehagen. Äußerstes Unbehagen.«
Ich wünschte, mir würde irgendeine freche Antwort einfallen; aber alles, was mir durch den Kopf ging, war: laßt mich in Frieden.
»Fragen wir andersherum«, sagte der Mann. »Ist Euer Geschäft in der Nähe des herzoglichen Zollhauses?«
Als ich nichts erwiderte, sagte er: »Das war doch eine einfache Frage. Wollt Ihr sie mir nicht beantworten?«
»Geht zum Teufel.«
Er grunzte unzufrieden. Ohne jede Vorwarnung ließ er plötzlich die Zügel los, sprang auf mich zu und packte mich vorne am Mantel. Er war ebenso groß und mindestens ebenso schwer wie ich. Er zog mich zu sich heran; ich ruderte erschrocken um Gleichgewicht. Er brachte sein Gesicht vor meines und brüllte mit voller Lautstärke: »Antwortet!«
Ich zuckte zusammen und sackte gegen seinen Oberkörper. Die Angst und der plötzliche Schrecken über seine Reaktion ließen meine Eingeweide rumoren. Nicht weit entfernt begann ein Hund zu bellen.
»Nicht so laut«, zischte einer der anderen Männer.
Er schüttelte mich, und ich gewann so viel Kraft zurück, daß ich wieder alleine stehen konnte. Ich hielt noch immer seine Oberarme umspannt. Unter dem groben Stoff seiner Jacke konnte ich spüren, wie seine Muskeln bebten.
– Er hat Angst.
Er hat Angst. Plötzlich konnte ich wieder atmen. Ich holte Luft.
»Ihr habt mich erschreckt«, sagte ich so ruhig ich konnte, und meine Stimme klang fast normal.
Er ließ mich los und trat wieder einen Schritt zurück. Sein Gesicht verschmolz mit der Dunkelheit. Ich hatte es versäumt, mir seine Gesichtszüge einzuprägen. Er fuhr sich mit dem Ärmel über die Nase und packte die Zügel meines Pferdes aufs neue.
»Sprecht, dann passiert so etwas nicht mehr«, knurrte er.
»Mein Geschäft ist nicht in der Nähe des herzoglichen Zollhauses«, sagte ich.
»Wo arbeitet Ihr dann?«
»Überall. Ich kaufe und verkaufe leerstehende Häuser.«
»Was?« keuchte er. »Wollt Ihr mich auf den Arm nehmen?«
»Durchaus nicht.«
Ich sah, wie er den Kopf schüttelte und einen Blick zu einem der anderen Männer sandte. Ich folgte seiner Kopfbewegung, aber ich konnte den anderen noch weniger erkennen als ihn. In meinem Mund formten sich bereits die nächsten Sätze, die ich vorbringen wollte; ich mußte mich krampfhaft daran hindern, sie hervorzusprudeln.
»Nun werdet Ihr mir sicher sagen, was Ihr von mir wollt?« fragte ich und bemühte mich, soviel Sicherheit wie möglich in den Klang meiner Stimme zu legen. Im Moment war er zu verblüfft; das und die Erkenntnis, daß er ebensolche Angst hatte wie ich, gab mir die Oberhand. Meine Furcht war nicht weniger geworden, aber nun gelang es mir, sie zu beherrschen.
»Ich stelle die Fragen«, rief er aufgebracht.
»Im Moment nicht mehr ...«, sagte ich und hätte mir gleich danach auf die Zunge beißen mögen. Er trat wieder auf mich zu und hob die Hand. Es gelang mir, nicht zurückzuzucken.
»Halt’s Maul!« schrie er.
»Sprich doch leise, um Gottes willen!« drängte einer der Männer. Er fuhr herum und breitete beide Hände aus.
»Warum denn!?« zischte er. »Denkst du, es kommen gleich die braven Bürger herausgerannt, um nachzusehen, ob sie jemandem helfen können? Du kannst hier die ganze Nacht liegen und vor Schmerzen schreien, und sie werden dir höchstens einen Schuh an den Kopf werfen, damit du das Maul hältst. Was glaubst du, wo du hier bist?«
Er ließ die Arme sinken und schnaubte angewidert; er drehte mir noch immer halb den Rücken zu. Ich stieß ein »Jesus, steh mir bei!« hervor, hob den Fuß und trat ihm mit aller Kraft ins Kreuz. Der Stoß ließ mich gegen die Flanke meines Pferdes taumeln; er aber flog förmlich nach vorne, riß beide Arme hoch, prallte in zwei seiner Gesellen und riß sie mit um. Ich wirbelte zu meinem Pferd herum; ich merkte nicht, daß ich einen gellenden Schrei ausstieß. Das Pferd stieg vor Schrecken mit den Vorderbeinen in die Höhe. Irgendwie kam ich halb in den Sattel und strampelte mit den Beinen nach den Steigbügeln. Das Pferd fiel mit den Vorderhufen wieder zur Erde zurück, und ich wurde nach vorne geworfen, quetschte mir mit einem Ruck die Hoden an der Sattelkante, daß es wie ein glühendes Schwert in meine Eingeweide fuhr; ich hing über dem Hals meines Gauls, er warf den Kopf zurück und stieß gegen meine Stirn, aber der Schmerz in meinen Lenden ließ mich alles andere vergessen. Ich holte Atem und brüllte dem Pferd so laut ich konnte ins Ohr: »Lauf!«
Es wieherte und stieg erneut in die Höhe. Ich rutschte in den Sattel zurück und saß auf einmal so darin, wie es sich gehörte. Undeutlich nahm ich wahr, wie zwei oder drei Männer auf mich zuliefen, aber die wirbelnden Hufe des Pferdes hielten sie auf Distanz. Einem gelang es, nach den Zügeln zu fassen, aber ich riß sie ihm mit einem Ruck wieder aus der Hand. Mein Gaul drehte sich wie verrückt einmal um sich selbst, ich spürte einen Aufprall und sah, wie noch einer der Angreifer zu Boden stürzte, und dann ging der Gaul durch, sprengte mitten durch zwei Männer, die links und rechts da vongeschleudert wurden und sich auf dem Boden überschlugen, und wir waren beide frei. Ich ließ die Zügel schießen und krümmte mich vor Schmerzen, während mich der wilde Galopp im Sattel umherschleuderte.
Ich hörte, wie mir jemand in wilder Wut hinterherschrie: »Wir kriegen dich, Pfeffersack, wir kriegen dich!«; aber ich drehte mich nicht um, und das wütende Gebrüll wurde schnell leiser und verstummte schließlich. Meine Eingeweide revoltierten, mir war zum Erbrechen übel, und jeder Schrittwechsel des Pferdes fuhr mir mit einem wühlenden Ruck durch den Leib, aber ich ließ dem Gaul die Zügel, und er lief und lief, bis er vor dem geschlossenen Tor meines Hofs haltmachte und mit zitternden Beinen stehenblieb. Ich rutschte aus dem Sattel und fiel neben dem Pferd zu Boden, wo ich ausgestreckt liegenblieb, bis ich wieder zu Atem kam und das quälende Pochen in meinem Unterleib verebbte.
Als ich wieder ruhig atmen konnte, lag ich noch immer mit dem Rücken auf dem kalten Erdreich und konnte mich nicht bewegen, weil mich die Angst in ihren Krallen hatte. Wie sie aus dem Dunkel aufgetaucht waren. Wie sie mir die Zügel meines Pferdes aus der Hand genommen hatten; wie sie mich in ihrer Gewalt gehabt hatten. Wie sie mir ungerührt gedroht hatten. Ich wünschte mir mit aller Kraft, daß ich dergleichen nicht wieder erleben mußte – ja, daß ich es gar nicht einmal erlebt hatte, daß ich träumte und binnen kurzem in meinem Bett aufwachen würde. Ich hatte schon von Überfällen gehört, sowohl auf Handelskarawanen als auch auf einzelne, doch ich selbst war immer davon verschont geblieben. Es war eine Sache, die den anderen passierte; niemals einem selbst. Ich blieb ausgestreckt auf der Erde liegen, und es schien mir die einzige Stellung zu sein, in der ich das Wanken meiner aus dem Gleichgewicht geratenen Welt nicht spürte. Dann aber begann ich die Kälte zu fühlen, die durch meine Kleider kroch, und die Feuchtigkeit, die an meine Haut drang. Meine Glieder begannen zu schmerzen; ich kroch mühsam auf die Knie, umfaßte ein Vorderbein meines Pferdes und zog mich daran in die Höhe.
Das Tor war nicht versperrt, die Flügel nur geschlossen. Ich schob einen davon auf und zerrte das Pferd hinter mir in den Hof hinein. Noch während ich das Tor schloß, hörte ich das leise Traben von krallenbewehrten Hundepfoten auf dem festgestampften Boden innerhalb meines Hofes, und ich drehte mich um. Zwei der vier Hunde, die auf dem Hof mit durchgefüttert wurden, standen hinter mir und blickten schwanzwedelnd und mit heraushängenden Zungen zu mir auf. Mein Verwalter hatte sich die Mühe gemacht, sie abzurichten: Einen Fremden hätten sie verbellt und mit entblößten Gebissen in Schach gehalten, bis der gesamte Haushalt zusammengelaufen wäre. Ich hatte seine Bemühungen immer belächelt; nun plötzlich hatte ich das starke Bedürfnis, die Hunde zu küssen, und ich kniete mich schwerfällig auf den Boden. Die beiden kamen auf mich zugetrottet und schmiegten sich in meine ausgebreiteten Arme, und ich klopfte ihnen auf die sehnigen Rücken und streichelte ihr Fell, roch den dumpfen, säuerlichen Hundegeruch, der von ihren Körpern ausging, und fühlte, daß sie mir ein wenig Sicherheit zurückgaben.
Ich hatte erwartet, daß ich nicht würde schlafen können; statt dessen lag ich wie bewußtlos in meinem Bett, bis mich der Lärm meines erwachenden Haushalts im Morgengrauen weckte. Während des Essens war ich schweigsam; ich hörte weder, was um mich herum gesprochen wurde, noch gab ich selbst einen Kommentar ab.
Die Männer, die mich gestern
– überfallen?
hatten. War es tatsächlich ein Überfall gewesen? Nicht, daß ich es für unmöglich hielt, daß Straßenräuber mit süffisantem Spott um ein Gespräch bitten würden. Wer den Knüppel in der Hand hält, kann sich einen gesunden Humor leisten. Was mich stutzig machte, war die Tatsache, daß sie meinen Namen gekannt hatten. Strauchdieben wäre er nicht nur unbekannt, sondern zudem in höchstem Maße egal gewesen; es zählte, was im Beutel drin war, nicht, was darauf stand. Also waren es keine Strauchdiebe gewesen – wenigstens keine gewöhnlichen.
Wenn sie meinen Namen herausgefunden hatten, konnte es sich nur um eine Frage der Zeit handeln, bis sie auch wußten, wo ich lebte. Was würden sie dann tun? Meinen Hof belagern? Sei nicht albern, sagte ich mir. Selbst wenn sie auf eine derartige Idee kommen, du hast genug kräftige und ergebene Männer, um dich von einem Ende der Altstadt zum anderen durch eine Schar von Stadtknechten zu schlagen. Aber der Gedanke, in meinem eigenen Heim plötzlich zur Zielscheibe dunkler Absichten zu werden, war äußerst beunruhigend. Jedoch war es wahrscheinlicher, daß sie mir irgendwo auflauern würden; eine Variante, die mich noch heftiger beunruhigte. Sollte ich in Zukunft nur noch in Begleitung erwachsener Männer meinen Hof verlassen oder nur noch im hellen Tageslicht? Verlassene Gassen und Plätze meiden? Und selbst wenn: Auch im dichtesten Gedränge konnte man ein Messer zwischen die Rippen bekommen, wenn der Täter nur kaltblütig genug war.
Ein drittes Szenario tauchte in meinem Geist auf: Ein Attentäter, der sich lautlos auf den Hof schlich, in das Haus und in meine Kammer und mir die Kehle durchschnitt, um wieder ungesehen zu verschwinden, vorbei an den vergifteten (erschlagenen, erdolchten) Hunden, während ich ebenso lautlos in meinem Bettkasten verröchelte und mein Blut gemächlich aus dem Türspalt auf den Boden tropfte. Ich schüttelte mich und verschüttete etwas Suppe, die eine der alten Frauen mit vorwurfsvollem Blick und einem Kanten Brot auftunkte.
Was hatten sie von mir gewollt? Die Frage ließ sich nur im Zusammenhang mit einer anderen beantworten. Wer hatte sie geschickt?
Ich dachte an eine dunkle Gestalt, die hinter einem Fenster stand und den Kerzenschein auslöschte.
Nach dem Frühstück brach ich auf und besuchte Hanns Altdorfer. Die Stadt war still, ohne den Bauernmarkt leblos; die Geschäfte würden nach dem morgendlichen Kirchgang öffnen, und dieser hatte eben erst begonnen. Das Rathaus war unverschlossen. Der Wappner, der neben der Tür an der Mauer lehnte, schien eher dekorativen Zwecken denn als Wächter zu dienen: er beantwortete meine Frage nach dem Stadtkämmerer mit einem bejahenden Brummen und zuckte nicht einmal, als ich die Tür aufstieß und ins Innere des Hauses vordrang. Die Schreibstube war leer, die Schreiber noch bei ihren Familien oder in der Kirche. Zum ersten Mal fiel mir der provisorische Schlafplatz in einer Ecke des weiten Raumes auf. Ich trat näher heran und erkannte den Mantel meines Freundes auf der Strohmatratze; dafür, daß dies nun für längere Zeit seine Schlaf statte sein würde, war sie äußerst spartanisch eingerichtet. Ich kannte Hanns Altdorfer: Er würde es noch nicht einmal bemerken, daß er nicht besser schlief als ein Knecht. Ich schüttelte den Kopf und drückte an die Tür seines Arbeitszimmers. Zu meinem Erstaunen war sie verschlossen; ich klopfte dagegen und bekam keine Antwort.
Als ich zurücktrat, vernahm ich Stimmen aus dem Obergeschoß. Ich stieg die breite Treppe hinauf und stolperte an ihrem oberen Ende in Bretter, Vorhangstangen und eine Menge Schutt hinein. Die Stimmen, die ich gehört hatte, waren aus einer offenen Doppeltür gekommen. Ich kletterte über die herumliegenden Teile und trat ein. Es war der Ratsherrensaal; aber nicht einmal sein Erbauer hätte ihn wiedererkannt.
Er war nun größer; man hatte Wände herausgenommen. Im hinteren Teil fehlte ein großes Stück in der Außenwand, und Teile eines Gerüsts waren durch die Öffnung zu sehen. Dort, wo ich stand, verkleideten Bahnen aus rotem Samt die Wände. An den Seitenwänden und der Wand mit der Öffnung fehlte die Verkleidung. Man würde sie vermutlich anbringen, wenn die Arbeiten dort abgeschlossen waren. Inmitten des Raumes standen zwei Männer: Hanns Altdorfer und Wilhelm Trennbeck. Bei meinem Eintreten drehten sie sich um und sahen mich fragend an.
»Der Wächter hat mich hereingelassen«, sagte ich.
Altdorfer verdrehte die Augen und schnaubte.
»Wahrscheinlich hat er dich für den Zimmermann gehalten«, sagte er. »Wir haben ihn herbestellt.«
Er wandte sich zu Trennbeck um und fragte: »Kennt Ihr den Kaufmann Peter Bernward, Richter?«
Trennbeck schüttelte den Kopf, und ich trat näher und drückte ihm die Hand. Er war breit gebaut, aber nicht füllig; er machte den Eindruck eines sehnigen Menschen, dem die Arbeit mit den Händen nicht unbekannt war. Sein Gesicht war lang und kantig, mit einem vorspringenden, blauschimmernden Kinn. Als er lächelte, entblößte er eine Reihe großer, gut gepflegter Zähne, mit denen er hätte Nüsse knacken können. Ebenso strahlend wie sein Gebiß waren seine Augen: ein helles Blau mit einem dunklen Rand um die Iris, das selbst von seinen im düsteren Raum geweiteten Pupillen nicht beeinträchtigt wurde. Ich hatte auf Anhieb das Gefühl, daß er mir als Richter in einem Streitfall lieber gewesen wäre als der kleine, verkrüppelte Girigel.
Er ließ meine Hand los und sagte: »Ich freue mich, Euch kennenzulernen. Habt Ihr auch mit den Hochzeitsvorbereitungen zu tun?«
»Nur am Rande«, sagte Hanns Altdorfer hastig, und ich setzte hinzu: »Ich bin an der Stofflieferung des Herrn vom Feld beteiligt.« Der Stellvertreter des Stadtrichters nickte.
»Es gab Schwierigkeiten, nicht wahr?«
»Ja. Der Treck wurde in Innsbruck aufgehalten.«
»Mittlerweile befindet er sich irgendwo zwischen Rosenheim und Landshut«, sagte er. »Der Pfleger des Herzogs zu Kufstein, Christoph Paumgartner, hat Nachricht bringen lassen, daß er die Lieferung gestern entgegengenommen und den Holländer ausbezahlt hat. Wir haben schon dringend darauf gewartet.« Er drehte sich um und wies auf die unverkleideten Wände des großen Saales. »Seht Ihr, wir konnten nicht weitermachen mit dem Ausschlagen der Wände. Nur dort vorn, wo der Kaiser und die Fürsten sitzen sollen, sind wir schon fertig.«
Ich warf Altdorfer einen raschen Blick zu. Er trat vor Ungeduld von einem Fuß auf den anderen und sah mich drängend an.
»Was wird das hier?« fragte ich den Richter. »Ich dachte, der Speisesaal sei drüben im Zollhaus?«
»Wir bauen hier den Tanzsaal auf«, sagte er. »Der Ratsherrensaal erwies sich jedoch als zu klein. Wir lassen dort draußen einen neuen Aufgang errichten, damit man vom Innenhof direkt herauf gelangen kann. Die Treppe, die Ihr gerade heraufgekommen seid, wird verschlagen.«
»Ein hübsches Stück Arbeit, das noch vor Euch liegt.«
»Das ist richtig«, seufzte er. »Hier greift mir wenigstens der Herr Stadtkämmerer unter die Arme. Aber drüben beim Zollhaus, wo wir den Speisesaal errichten, muß ich mich mit dem Eigentümer des Nachbarhauses herumschlagen, der mir Knüppel zwischen die Beine wirft, wo er nur kann.«
»Ich sah Euch gestern, wie Ihr mit ihm diskutiert habt«, sagte ich lächelnd. »Ich hatte zufällig in der Stadt zu tun.«
»Diskutiert?« dehnte der Richter. »Dann seid Ihr aber in einem frühen Stadium des Gesprächs vorbeikommen. Der Herr von Asch hat uns die Zimmer im ersten Stock seines Gebäudes zur Verfügung gestellt, aber daß wir Türöffnungen vom Zollhaus zu seinen Räumen brechen müssen, wurde ihm angeblich niemals mitgeteilt. Jetzt beklagt er sich, daß er weder schlafen noch arbeiten könne und seine Töchter von den Handwerkern belästigt würden.«
Er hob die Hände und lächelte ebenfalls. Ich sah, daß er dunkle Schatten unter den Augen hatte, aber ich sah auch, daß er die Aufregung und die Hetze genoß.
»Ich glaube, ich werde einmal zu ihm hinübergehen«, sagte er. »Mittlerweile dürfte er von der Messe zurück sein. Vielleicht hat er den Heiligen Geist in sich und ist friedlicher Stimmung. Wenn der Zimmermann eintrifft, schickt einfach nach mir, Herr Stadtkämmerer. Es hat mich gefreut, Euch kennenzulernen, Herr Bern ward.«
Ich drückte ihm die Hand zum Abschied und sah ihm zu, wie er durch die Wandöffnung hinaustrat und die provisorischen Treppen hinunterkletterte. Als er außer Reichweite war, drehte ich mich zu Hanns Altdorfer um.
»Er redet und redet!« stöhnte er. »Dabei verbrenne ich vor Ungeduld. Was hast du bisher herausgefunden, Peter?«
»Jemand hat mich gefunden«, sagte ich düster.
Er zog die Brauen zusammen.
»Wie darf ich das verstehen?«
»Hanns«, sagte ich und nahm ihn beim Arm, »ich bin gestern überfallen worden.«
»Was?«
»Mehrere Kerle; frag mich nicht, wie viele es genau waren. Wenn ich nicht mein Pferd so erschreckt hätte, daß es durchging, hätten sie mir wohl die Haut abgezogen.«
»Straßenräuber?« fragte er, obwohl ich ihm vom Gesicht ablesen konnte, daß er selbst nicht daran glaubte.
»Nein; ich bin sicher, daß sie nicht an mein Geld wollten.«
Er starrte mich entgeistert an; er war merklich blasser geworden.
»Komm mit nach unten«, sagte er. »Dort können wir uns besser unterhalten.«
Drunten schloß er die Tür zu seiner Stube auf. Es war kalt im Rathaus, und die große Maueröffnung im Obergeschoß machte es nicht besser. Er warf seinen Mantel über, ließ sich schwer in einen Stuhl fallen und sah mich fragend an.
»Hanns«, sagte ich, »erinnerst du dich an das alte Haus in der Ländgasse? Das unbewohnt ist und seit langer Zeit leer steht?«
»Was ist damit?« fragte er mißtrauisch.
»Einer der Nachbarn hat Gespenster darin gehört«, fing ich an und stockte, weil der Stadtkämmerer die Augen aufriß. »Ich habe nachgesehen«, fuhr ich fort, »Gespenster habe ich keine gefunden; wer darin umgeht, ist aus Fleisch und Blut.«
»Würdest du dich etwas genauer ausdrücken?« würgte er.
»Laß mich von vorne anfangen.« Er nickte, und ich beugte mich seufzend nach vorne.
»Ich habe die letzten beiden Tage damit zugebracht, die Polen auszuhorchen; zuerst Moniwids Leute, dann den polnischen Gesandten. Danach hatte ich ein Treffen mit dem Apotheker Löw, dem ich Geld schuldete; er erzählte mir beiläufig, er habe Stimmen in einem alten Haus in seiner Nachbarschaft gehört. Es handelt sich um das Haus, das in deinem Plan als leerstehend gekennzeichnet ist. Ich habe es gestern und den Tag davor beobachtet. Es versteckt sich jemand darin.«
»Beobachtet? Warum?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Aus Neugier, zuerst. Weil es mir schon auf deinem Plan aufgefallen war. Ich fand es merkwürdig, daß es leerstand. Und als ich es zum ersten Mal aufsuchte, sah ich eine brennende Kerze in einem der oberen Fenster.«
Er schüttelte ungläubig den Kopf, und ich sagte: »Ich habe beim polnischen Gesandten ein paar Dinge erfahren, die es mir gar nicht so abwegig erscheinen lassen, daß sich jemand in dem alten Gebäude versteckt.« Ich machte unwillkürlich eine Pause, aber Altdorfer regte sich nicht.
»Der Rat Priamus glaubt, daß eine Verschwörung im Gange ist«, sagte ich dann. »Jedoch nicht gegen Herzog Ludwig – gegen König Kasimir. König Matthias von Ungarn liegt im Krieg gegen Polen, der nur durch einen unsicheren Waffenstillstand stillsteht.«
»Glaubst du, der Mord wurde deswegen...«, flüsterte er.
»Ich weiß noch nicht, was ich glaube«, erwiderte ich. »Der polnische Rat behauptet, Matthias sitze unrechtmäßig auf dem ungarischen Thron, weil Kaiser Friedrich die ungarische Krone König Kasimir zugesprochen habe; daneben versuche er sich auch noch Böhmen anzueignen, auf dessen Thron Kasimirs ältester Sohn sitzt. Und nicht zuletzt scheint Matthias ein Auge auf die Prinzessin geworfen zu haben, wurde aber wohl mehrfach ziemlich schnöde abgewiesen. Ich weiß nicht, ob das alles Grund genug ist, mit einem Mord die Hochzeit ins Wanken zu bringen. Aber ich weiß, daß ich letztens zu dir sagte, wer immer den Mord begangen habe, würde sich möglicherweise ein zweites Opfer suchen. Erinnerst du dich?«
»Natürlich«, sagte er ohne Begeisterung.
»Nun«, fuhr ich fort, »sieht es so aus, als würde sich jemand in einem leerstehenden alten Haus verstecken, das nur einen Steinwurf weit weg ist von der Unterkunft Kaiser Friedrichs. Jemand, der möglicherweise ein zweites Opfer sucht. Kannst du mir folgen?« Er ächzte.
»Sie verüben einen Anschlag auf den Kaiser und schieben ihn König Kasimir in die Schuhe. Ob er gelingt oder nicht, ein Großteil des Reichs wird dem Polen daraufhin den Krieg erklären.«
»Und Mathias Corvinus wird sich auf der richtigen Seite zu finden wissen«, ergänzte ich.
Altdorf er schloß die Augen und verbarg das Gesicht in seinen Händen.
»Reckeis Geist«, sagte er dumpf. »Man hätte das Haus damals abreißen sollen, wie es die Gesetze vorschreiben; es entwickelt sich nur Unglück darin.«
»Was willst du damit sagen?«
Er nahm die Hände herunter und sah mich an. Er wirkte noch müder und blasser als bei meinem Eintreten.
»Das alte Haus«, sagte er. »Es gehörte Dietrich Reckel, dem Baumeister.«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Hat er die Martinskirche geplant?« fragte ich. Altdorfer schnaubte. »Nein«, sagte er. »Er hat einen Aufstand gegen Herzog Ludwigs Vater angezettelt und das größte Blutgericht entfacht, das die Stadt jemals erlebt hat.«
Ich starrte ihn überrascht an.
»Wann war das?« brachte ich hervor. »Vor zweihundert Jahren?«
»Vor fünfundsechzig«, sagte er, und beinahe huschte ein Lächeln über sein Gesicht. »Das ist kein Märchen, Peter.«
»Ich habe niemals davon gehört«, erklärte ich. Er zuckte mit den Schultern und ging nicht näher darauf ein. Vielleicht wollte er nicht sagen, daß es möglicherweise daran lag, daß ich mich anfangs nur um meine Familie und später nur um mein Geschäft gekümmert hatte, ohne mich sonderlich in der Stadt zu engagieren.
»Womöglich haben sich heute wieder Verschwörer dort eingenistet«, sagte ich. »Das erscheint mir nicht unpassend.«
Er schniefte und wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. Ich sah, daß seine Hand zur Faust geballt war.
»Der Überfall auf dich ...?« fragte er.
»Man hat mich entdeckt, als ich das Haus beobachtete«, sagte ich. »Wahrscheinlich wußten sie schon die ganze Zeit über, daß ich um ihr Versteck herumstrich. Sie hatten sogar genug Zeit, um meinen Namen auszuspionieren. Der Himmel weiß, wie ihnen das gelungen sein mag; Gott sei Dank wußten sie weiter nichts über mich, oder sie hätten mich wohl zu Hause überfallen.«
»Was machen wir jetzt?« überlegte er. »Willst du eine Wache? Ich könnte ein paar Wappner von ihren momentanen Aufgaben abziehen.«
Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte genügend Männer, die mir beistehen konnten. Und ich konnte selbst auf mich aufpassen. Im Tageslicht war es leichter, tapfer zu sein, dachte ich.
»Wann wird der Kaiser erwartet?« fragte ich.
»In etwa einer Woche. Man hat die Herren von Stain und von Rechberg dem Kaiser nach Nördlingen entgegengesandt, um das herauszufinden. Er wollte gestern in Nördlingen ausreifen und über Neuburg, Ingolstadt und Mainburg nach Landshut kommen.«
Ich nickte.
»Eine Woche. Soviel Zeit haben wir noch. Moniwids Vorgabe war gnädiger.«
Altdorf er fuhr sich mit den Händen über das Gesicht.
»Peter«, sagte er drängend, »was sollen wir tun? Der Richter ist noch immer in Burghausen, und auch der Kanzler hat die Stadt wieder verlassen. Es hat sich herausgestellt, daß der Kaiser wohl am gleichen Tag wie der Brautzug in Ingolstadt eintreffen wird. Man will alles tun, um das zu verhindern, sonst reichen die Quartiere nicht aus. Die beiden herzoglichen Räte sollen ihn überreden, auf dem schnellsten Wege nach Landshut zu kommen. Außerdem kommen noch der Graf von Württemberg, der Herzog von Vorderösterreich, der Kurfürst von Brandenburg und was weiß ich wer noch alles über Ingolstadt. Das sind über dreieinhalbtausend Menschen, den Brautzug noch gar nicht mit eingerechnet. Das Weiterkommen auf den Straßen, die Übernachtungsmöglichkeiten, das alles will koordiniert sein.«
Ich fühlte mich für einen Moment versucht zu erwidern, daß die ganzen Vorbereitungen möglicherweise vergeblich waren. Statt dessen sagte ich: »Ich werde nachdenken«, und stand auf. »Ich bin noch eine Weile in der Stadt. Kann ich das Pferd in der Obhut deiner Wappner lassen?«
»Selbstverständlich. «
Er begleitete mich zur Tür und blieb darin stehen, während ich davonschritt. Ich drehte mich noch einmal nach ihm um; er stand bewegungslos im gefältelten Spitzbogen, der das Eingangsportal zum Rathaus umrahmte, und wirkte in all seiner Hagerkeit gebückt und verlassen. Ich wandte mich wieder um und drängte mich durch die Menschen, die vom Kirchgang zurückkamen und ihre Geschäfte öffneten. Seine Verlassenheit wirkte ansteckend. Plötzlich sehnte ich mich nach Maria.
Ich hatte bereits nachgedacht und war zu dem Ergebnis gekommen, daß das alte Haus im Licht der neuen Ereignisse um so mehr unter ständige Beobachtung gestellt werden mußte. Ich selbst konnte es nicht mehr tun; ich mußte jemanden damit beauftragen. Dazu bestanden mehrere Möglichkeiten. Eine war, einen der jungen Tunichtgute dafür einzuspannen, die die Gastwirtschaften und Schänken bevölkerten – aber wie hätte ich wissen können, wer darunter halbwegs vertrauenswürdig war? Ich hätte mich auch an Sebastian Löw wenden können (wieder einmal), doch dessen Interesse an den Vorgängen im alten Haus war schon durch seine vermeintlichen Gespenstererscheinungen zu nachhaltig geweckt, als daß ich mich bei ihm nach einem Spitzel hätte erkundigen können, ohne ihn vollends mißtrauisch zu machen. Der Totengräber, den Löw mir vermittelt hatte, fiel gleichermaßen aus. Zuerst war er mein Hauptfavorit gewesen, bis mir klarwurde, wie merkwürdig es gewirkt hätte, wenn er sich in der Stadt herumgetrieben hätte; außerdem war es mehr als fraglich, ob er an dem Auftrag interessiert wäre. Der Sohn des Sebastian Löw? Er wohnte in der Nähe und konnte das Haus im Auge behalten, ohne Verdacht zu erregen. Aber abgesehen davon, daß auch er mein Ansinnen mit aller Wahrscheinlichkeit ablehnen würde, war er zu impulsiv und ehrlich, um einen guten Spion abzugeben.
Es mußte jemand sein, der wenig genug Bekannte und Freunde in der Stadt hatte, so daß er nicht in Versuchung käme zu plaudern. Gleichzeitig durfte er nicht auffallen, wenn er sich in der Nähe des Hauses herumtrieb; sein Aufenthalt dort mußte plausibel sein. Nicht zuletzt mußte er auch an meinem Angebot interessiert sein, die zu erwartende Belohnung mußte ihn also locken. Ich war sicher, daß ich jemanden finden würde, auf den die drei Kriterien einigermaßen zutrafen; es gab jedoch ein viertes Kriterium, das mir von allen am wichtigsten schien: Er mußte zuverlässig sein. Wie sollte ich diese Tatsache feststellen können?
Dann fielen mir die Flößer ein, die vor den Toren der Stadt am Flußufer kampierten. Die Auswärtigen unter ihnen erfüllten die ersten drei Kriterien: Sie waren in der Stadt fremd; sie fielen nicht sonderlich auf, wenn sie ab und zu in der Ländgasse auftauchten; und sie waren auf Geld scharf, weil sie die Tage bis zum Fest mit großer Wahrscheinlichkeit ohne einen Fährauftrag vertrödelten. Was die Zuverlässigkeit anging, so war mir durch den Auftrag über den Transport der Leinwand wenigstens der Sprecher der Flößer gewogen: Er mochte mir einen Mann nennen, auf den ich mich verlassen konnte.
Die Erinnerung an die Verhandlungen mit den Flößern ließ mich auch wieder an Jana Dlugosz denken. Ich würde einen Teil meiner Aufmerksamkeit auf ihre Person richten müssen; was sie bisher über sich ausgesagt hatte, war widersprüchlich genug, um auch sie in Verdacht geraten zu lassen. Ich dachte an das fröhliche Funkeln in ihren Augen und daran, wie sich die Grübchen in ihren Wangen vertieften, wenn sie amüsiert lächelte. Ich schüttelte den Kopf und verschob es auf später.
Das Häuflein der Flößer war merklich kleiner geworden; vermutlich hatten sich angesichts des feuchtkühlen Wetters alle Einheimischen in ihre Häuser verdrückt. Ich grüßte das halbe Dutzend verbliebener Männer, die eine verblichene Plane zum Schutz vor der Witterung an eisernen Haken in der Stadtmauer befestigt hatten und mit zwei aufrecht in den Kies gesteckten Stangen abspannten. Ich hatte mir die Gesichter der Flößer nicht gemerkt, und ich konnte nicht sagen, ob ich einen davon hätte wiedererkennen sollen. Es war unerheblich; sie erkannten mich. Die Eifrigkeit, mit der sie aufsprangen und meinen Gruß erwiderten, ließ mich vermuten, daß sie sich mittlerweile dafür ohrfeigten, meinen Auftrag ihren Kameraden überlassen zu haben.
»Ich möchte gerne mit Eurem Sprecher reden«, sagte ich. »Ist es noch der Mann, mit dem ich neulich verhandelt habe, oder habt Ihr einen neuen gewählt?«
»Nein, Steckenhauser ist noch immer unser Sprecher«, erwiderte einer. »Er ist bei seiner Familie. Soll ihn jemand holen?«
»Ich bitte darum.«
Sie diskutierten kurz, dann rannte einer von ihnen in leichtem Trab los. Sie hätten mich auch zu seinem Haus führen können, aber darauf kamen sie nicht. Ich stand halb verlegen unter ihnen, während wir auf die Rückkehr des Boten und die Ankunft Steckenhausers warteten, und wünschte mir, ich hätte etwas gehabt, was ich ihnen hätte anbieten können – einen Schluck Wein oder wenigstens etwas frisches Wasser. Ich lächelte sie an, und sie lächelten unbeholfen zurück, sichtlich bestrebt, einen guten Eindruck zu machen. Sie standen ebenso befangen wie ich unter der Plane herum und ließen ihre Arme pendeln, weil sie nicht wußten, wohin sie die Hände stecken sollte.
»Es tut mir leid, daß das Wetter so schlecht ist«, sagte ich schließlich.
Sie winkten großzügig ab; sie waren die Nässe gewohnt.
»Wenn die Hochzeit stattfindet, werdet Ihr sicherlich die Belohnung für Euer Ausharren erhalten«, fuhr ich angestrengt fort.
Sie nickten begeistert. Die Belohnung würden sie sich holen, darauf war Verlaß.
Ich beugte mich unter der Plane nach draußen und kniff die Augen zusammen, um in den Himmel zu spähen. Er war mit einer konturlosen hellen Schicht aus Wolken überzogen, die keinerlei farbliche Abstufung erkennen ließ und aus der sanfter Nieselregen zur Erde geweht wurde. Die Flößer taten es mir nach, starrten ebenfalls mit kritischem Gesicht unter ihrer ärmlichen Deckung hervor und musterten den Himmel mit fachmännischen Blicken.
»Das ändert sich so schnell nicht«, sagte ein älterer Mann, der die allgemeine Wetterlage in Landshut rasch erfaßt hatte. An sein Gesicht konnte ich mich vage erinnern.
»Während der Hochzeit wird bestimmt die Sonne scheinen«, sagte ich.
»Da ist es mir dann egal«, sagte er gelassen, und seine Kumpane lachten.
Endlich kam der Bote zurück, in Begleitung des Mannes, mit dem ich gestern verhandelt hatte. Er reichte mir die Hand zum Gruß.
»Herr Bern ward«, sagte er. »Was können wir diesmal für Euch tun?« Ich legte ihm die Hand auf die Schulter und schob ihn sanft unter der Plane heraus zum Flußufer hin. Zuerst dachte ich, die anderen würden uns folgen, aber dann blieben sie zurück und blickten uns gespannt hinterher.
»Ich hätte noch einen Dienst für einen Eurer Männer«, sagte ich.
»Ihr werdet feststellen, daß sie alle froh sind, ein wenig Geld verdienen zu können.«
»Ich werde nicht geizig sein«, versprach ich. »Allerdings ist der Auftrag, den ich habe, auf den ersten Blick ein wenig merkwürdig.«
Er antwortete nicht, aber seine Brauen zogen sich zusammen.
»Ich möchte, daß er ein bestimmtes Haus in der Nähe überwacht und sich alle Bewegungen darin merkt«, sagte ich.
Er machte ein verständnisloses Gesicht, und ich sah mich gezwungen anzufügen: »Es ist eine geschäftliche Sache, wenn Ihr versteht.«
Er verstand nicht, aber er wagte auch nicht nachzufragen.
»Um welches Haus handelt es sich?« fragte er schließlich.
»Ihr müßtet es kennen. Es heißt Reckel-Haus.«
»Ich kenne es«, sagte er. »Dort geht es nicht mit rechten Dingen zu.«
Ich wußte nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, das Haus zu erwähnen. Ich dachte an Hanns Altdorfers Gesicht; er war unangenehm berührt gewesen, daß das ehemalige Haus des Baumeisters und Anführers einer Bürgerrevolte seinem dahinmodernden Vergessen entrissen werden sollte.
Ich sagte vorsichtig: »Wie meint Ihr das?«
»Nun, Lichter, Stimmen – was weiß ich. Die alten Weiber zerreißen sich immer wieder einmal das Maul darüber. Jedenfalls hat noch keiner lange darin gewohnt. Wißt Ihr, was ich glaube?«
»Nein.«
»Ich glaube, daß die Lichter von Liebespaaren kommen, die sich in die verlassenen Räume schleichen, um dort heimlich... « Er kniff ein Auge zusammen und stieß mich leicht mit dem Ellbogen an. »Ihr könnt es Euch ja denken.«
Sicher dachte er jetzt, auch bei meinem »Geschäft« würde es sich darum handeln. Ich ließ ihn in seinem Glauben.
»Könnt Ihr mir einen zuverlässigen Mann empfehlen?« fragte ich.
»Den grauen Bertold«, sagte er, ohne lange nachzudenken. »Er ist einer meiner beiden Sprecherkollegen. Er ist nicht von hier, aber auf ihn ist Verlaß. Ich kenne ihn von früher her.«
»Gut«, erwiderte ich. »Ich werde mich täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt hier mit ihm treffen.«
»Soll ich ihn holen?«
»Bitte.«
Er schritt über den Kies davon; einen Augenblick später kam er mit dem älteren Mann zurück, der die Bemerkung über das Wetter gemacht hatte. Ich setzte ein freundliches Lächeln auf, als die beiden Männer vor mir standen, und begann meine Geschichte aufs neue.
Bis ich mich endlich wieder bei Hanns Altdorfer einfand, war es bereits Nachmittag. Der Nieselregen hatte alle, die sich vielleicht noch vor der Abendmesse die Beine vertreten hatten wollen, in ihre Behausungen verscheucht. Die Fackeln an den Hauswänden kämpften lustlos gegen die Nässe an, die sich über das holprige Pflaster senkte. Mein Pferd stand noch da, wo ich es verlassen hatte, mit hängendem Kopf dem Regen ergeben. Die Wachen vor dem Rathauseingang waren auf zwei verstärkt worden; einer davon streichelte dem Pferd über die Flanke, während sich der andere so weit wie möglich in den Bogen über der Eingangstür drückte, um dem Regen zu entgehen. Als ich mich ihnen näherte, versperrten sie mir mit gekreuzten Spießen den Durchgang. Ich wandte mich an denjenigen, den ich von heute morgen kannte.
»Laßt mich ein«, sagte ich. »Ich war bereits heute morgen hier. Ich bin ein Freund des Stadtkämmerers. Dies ist mein Pferd.«
»Stimmt«, sagte er. Er zeigte entschieden mehr Elan als heute früh; vielleicht weckte die weite, einsame Straße und die hereinbrechende Dämmerung ein Gefühl des Mißtrauens. Unwillkürlich dachte ich an den gestrigen Abend. Würden sie mir heute nochmals auflauern?
Er ließ mich passieren. Der zweite Wächter war ein junger Mann, dessen Gesicht unter dem Helm das eines kleinen Buben war und dessen Nase in der Kälte lief. Er hatte bereits davor resigniert, und ein kleiner, zäher Tropfen hing ihm an der Nasenspitze. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, ihm einen Kanten Brot in die Hand zu drücken, damit er das Pferd füttern konnte: Er war es, der meinen Gaul gestreichelt hatte. Ich nickte ihm zu und trat durch die Tür in das Rathaus.
Hanns Altdorfer studierte im Schein einer Kerze seinen Plan.
»Ich wollte noch einmal bei dir vorbeikommen, bevor ich nach Hause reite«, sagte ich.
Er hatte seinen Mantel angezogen und vorne zugeknöpft; auf seinem Kopf saß ein Barett. Er sah auf und lächelte.
»Gibt es etwas Neues?«
»Nichts Besonderes. Ich habe einen Mann gedungen, um das alte Haus weiter zu überwachen. Bei dir?«
»Der Zimmermann hat versprochen, mit den Arbeiten rechtzeitig fertig zu sein. Außerdem hat Trennbeck sich wieder mit dem alten von Asch gestritten. Und ich erlebte den Auftritt eines Propheten.«
»Eines was?«
»Eines Verrückten«, sagte er. »Er ist bekannt in der Stadt; sie nennen ihn den Heiligen Rochus.« Altdorfer kurbelte mit der Hand vor seiner Stirn.
Ich schnaubte belustigt.
»Woher hat er diesen Namen?«
»Er ist ein alter Mann, der sich von Abfällen ernährt und auf der Straße oder in den Auwäldern um die Stadt herum lebt. Bevor er den Verstand verlor, war er Medicus; nicht einmal ein schlechter, habe ich mir sagen lassen. Er gehörte zum Troß der Leibärzte von Herzog Heinrich, dem Vater von Herzog Ludwig. Während der Pest vor fünfundzwanzig Jahren hat er nicht nur einen Großteil seiner Familie verloren, sondern auch noch seinen hochwohlgeborenen Patienten Heinrich. Er konnte nicht verschmerzen, daß seine Künste völlig belanglos waren gegen den Schwarzen Tod. Seitdem ist er von Jahr zu Jahr verrückter geworden.«
»Und was hat er dir erzählt?«
»Er kam hier hereingeplatzt und erklärte mir, daß die Hochzeit zum Scheitern verurteilt sei. Du kannst dir vorstellen, wie sehr ich erschrak, das zu hören; bis mir klar wurde, worauf er hinauswollte. Er sieht die Wiederkehr der Pest voraus. Das tut er jedes Jahr.«
»Wie ist er denn hier hereingekommen?«
»Er kommt überall hinein. Im Grunde ist er harmlos, aber wenn man ihn aufzuhalten versucht, zieht man seinen heiligen Zorn auf sich, und es kann passieren, daß er einem den halben Tag auf Schritt und Tritt nachläuft und wüst beschimpft. In dieser Beziehung ist er hartnäckig; deshalb gewährt man ihm für gewöhnlich dort Eintritt, wo er hin will. Er plaudert ein bißchen, dann geht er friedlich wieder. Es ist die bessere Lösung, anstatt ständig mit ihm zu streiten.«
Ich lächelte, und er schüttelte mit komischer Verzweiflung den Kopf.
»Und – kommt die Pest nun?« fragte ich ihn.
Er zuckte mit den Schultern.
»So wie jedes Jahr«, sagte er resigniert. Er rückte seinen Mantel zurecht.
»Was sitzt du in dieser Aufmachung herum? Gehst du noch aus?«
»Ich wollte in die Abendmesse gehen«, erwiderte er. »Ich bin den ganzen Sonntag nicht zur Kirche gekommen und wollte es heute nachholen. Begleitest du mich?«
»Ich hatte vor, auf dem schnellsten Weg nach Hause zu reiten. Ich will nicht wieder bei völliger Dunkelheit unterwegs sein. Seit gestern bin ich ein wenig nervös, um die Wahrheit zu sagen.«
»Ich habe keine rechte Lust, alleine in die Andacht zu gehen. Komm doch mit.«
»Ich verzichte«, erwiderte ich mit einem schiefen Lächeln.
Altdorfer erhob sich und schüttelte den Kopf. »Man möchte nicht glauben, daß dieser Heide einmal ein eifriger Diener der Kirche war.«
»Laiendiener«, sagte ich. Er nickte und lächelte schwach. Mit zwei angefeuchteten Fingern löschte er die Kerze aus.
»Gehen wir«, meinte er und stapfte aus dem Raum. Unter dem Eingangsportal blieb er stehen und spähte mit zusammengekniffenen Augen in den Regen.
»Es ist noch recht hell«, sagte er über die Schulter zu mir. »Du könntest mich wenigstens ein paar Schritte begleiten.«
»Also gut«, seufzte ich und dachte daran, daß ich, sollte die Dunkelheit mich einholen, immer noch einen Umweg über das Ländtor und das weite Flutland der Pfettrach machen konnte, um mich meinem Hof von hinten zu nähern. Kaum jemand würde vermuten, daß ich diesen Weg nähme; er führte an ein paar verstreut liegenden Pachthöfen vorbei und durch nur teilweise trockengelegtes Marschland. Niemand war dort freiwillig bei Nacht unterwegs; man wollte Irrlichter gesehen haben, die die Reisenden in den Sumpf lockten. Irrlichter jedoch waren das, was mir im Augenblick die geringste Sorge bereitete.
Ich sagte zu den Wachen: »Ich lasse das Pferd hier; ich komme gleich zurück und hole es ab.« Sie nickten gleichmütig.
Altdorfer wünschte den Wappnern eine gute Nacht und setzte sich in Bewegung. Vom Rathaus führte die Grasgasse direkt hinüber zur Neustadt, die schon bei Tage deutlich weniger belebt war als die Altstadt und jetzt, bei hereinbrechender Dunkelheit und dieser Witterung, weit, düster und verlassen dalag. Hinter der herzoglichen Münze am Südende der Neustadt erhob sich die steile Flanke des Lenghart, bekrönt vom Burgsöller und den Maueranlagen, die sich bis herunter zu den Gebäuden des Franziskanerklosters zogen; sonst ein massiger Schatten, der sich über den Bürgerhäusern in die Höhe reckte, jetzt unsichtbar hinter den feinen Schleiern des allgegenwärtigen Nieselregens.
Noch auf der Höhe der Fleischbänke hinter dem Rathaus hatte uns eine Gruppe von Männern überholt, die eiligen Schrittes ebenfalls zur Neustadt strebten und uns hastig grüßten; ich hörte, wie einer von ihnen sich laut ärgerte, daß sie die Kirche vor Meßbeginn nicht mehr erreichen würden. Altdorfer nahm diesen Umstand gelassen hin. Ich hatte den Eindruck, daß er froh war, sich an der frischen Luft bewegen zu können. Als wir in die Neustadt kamen, war die Gruppe bereits verschwunden, vermutlich angespornt durch die Befürchtung, in der Kirche nur mehr die Plätze zu bekommen, an denen es sich weder bequem stehen noch unbemerkt dösen ließ.
Im Gegensatz zur Altstadt war die Neustadt nicht gepflastert. Der festgetretene Boden wies bereits die ersten Furchen und weichen Stellen auf; bald würde er sich, wie jeden Herbst, in knöcheltiefen Schlamm verwandeln, den nur ein selten auftretender Frost zu knochenbrecherischen Formen erstarren ließ und der sich erst im Verlauf des darauffolgenden Frühlings langsam und widerwillig wieder ebnete. Wir marschierten über die Straße und in die breite Gasse zwischen Lagerhäusern und Stadeln hinein, die zugleich die Zufahrt zum Kloster der Dominikaner bildete. An dem freien Platz, der vor dem Kloster lag, öffneten sich mehrere Gassen in alle Himmelsrichtungen; eine davon führte auch zur Kirche des heiligen Jobst, die sich inmitten der großzügigen Freyung erhob. Der Weg über das Dominikanerkloster war die kürzeste Verbindung vom Rathaus zur Kirche.
Sie hatten ihren Überfall gut geplant; wahrscheinlich waren sie mir schon gefolgt, als ich mich zu Hanns Altdorf er ins Rathaus begeben hatte. Da sie unser Ziel nicht gekannt hatten, waren sie hinter uns hergelaufen, bis ihnen klar wurde, daß wir zur Kirche strebten, hatten uns bei den Fleischbänken überholt und sich in der Neustadt getrennt, um beide möglichen Wege zur Kirche – den über das Dominikanerkloster und den über das Südende der Neustadt und das Franziskanerkloster – abzuriegeln. Es sprach für ihre Geschicklichkeit, daß weder Hanns noch ich etwas ahnten von ihrem Hinterhalt. Die Gruppe, die uns überholt hatte, hatten wir völlig arglos betrachtet; besonders ich, der ich mit einem weiteren Überfall gerechnet hatte, erwartete sie weder um diese Zeit noch an diesem Ort. Im Gegenteil – innerhalb der Stadtmauern und zudem in Begleitung des Stadtkämmerers fühlte ich mich trügerisch sicher.
Wir machten es ihnen leicht, uns zu überfallen: Die Messe hatte bereits begonnen, die Straßen waren leer, und wir nahmen den Weg zwischen den finsteren Lagerhäusern. Der Boden in der Gasse war von den schweren Lastkarren, die von und zum Kloster und den Stadeln fuhren, zerwühlt und tief gefurcht, und in der Dunkelheit mochte ihn kaum jemand gehen; üblicherweise nahm man den Umweg über das Franziskanerkloster in Kauf. Sie hatten die finsterste Stelle in der Gasse gefunden, sich dort in den dunklen Tordurchfahrten der Lagerhäuser versteckt und besaßen genug Geduld abzuwarten, bis wir uns in ihrer unmittelbaren Nähe befanden, durch die Krümmung der Gassenführung sowohl den Blicken von der Neustadt als auch denen vom Kloster her entzogen. Dann schlugen sie rasch und geplant zu.
Ich hörte die hastigen Schritte hinter mir, und ich spürte die körperliche Annäherung eines Menschen mit einer plötzlichen Dringlichkeit, die mir einen Schauer den Rücken hinunter sandte. Der Aufprall traf mich, als ich mich schon halb herumgedreht hatte: Der Mann rannte mit voller Wucht in mich hinein. Ich spürte keinen Schmerz, eher einen Schock, als habe jemand eine Tür direkt vor meinem Gesicht zugeschlagen. Ich verlor den Boden unter den Füßen, hatte das unwirkliche Gefühl zu fliegen, noch während der Anblick des auf mich zustürmenden Mannes wie in meine Augen eingebrannt war, und stürzte zu Boden.
Die Wucht des Zusammenstoßes ließ meinen Angreifer taumeln. Er stolperte in meine Richtung, brachte die Füße übereinander, dann fing er sich und nutzte den eigenen Vorwärtsschwung, um sich auf mich zu werfen. Ich lag ohne Regung am Boden, atemlos durch den wuchtigen Sturz, und erst, als ich sein Gewicht plötzlich auf meinem Körper spürte und seinen Versuch, mit dem Bein meine Knie auf der Erde festzunageln, erwachte ich aus der Überraschung. Die Dinge verloren ihre seltsame Trägheit. Auf einmal war mir klar, daß ich unsere unbekannten Feinde bei weitem unterschätzt hatte.
Er richtete sich halb auf und holte mit einer Faust weit aus. Meine Hände hoben sich vor mein Gesicht, aber darauf hatte er gewartet: Er schlug mich unterhalb der Rippen in die Seite, zweimal, dreimal hintereinander, so schnell es ging. Die Stelle wurde mit dem ersten Schlag gefühllos, beim zweiten begann sie zu glühen, und der dritte Schlag war, als hätte jemand mit aller Kraft in eine offene Wunde geschlagen. Ich keuchte und versuchte, einen weiteren Treffer dort unten abzuwehren, worauf er mir mit derselben Leichtigkeit zwei Schläge ins Gesicht versetzte, die meine linke Gesichtshälfte in eine pochende Zone des Schmerzes verwandelten. Ich spürte, wie mir das Wasser in die Augen trat. Zuerst war ich zu erschrocken gewesen, um Angst zu fühlen; jetzt richtete sich mein Denken schlagartig nur noch darauf aus, weitere Faustschläge abzuwehren. Ich fürchtete nicht um mein Leben. Ich hatte keine derart abstrakten Gedanken. Ich war eine Ansammlung bloßliegender Nervenenden, die an zwei Stellen vor Schmerz bebten, und ich hatte das einzige Ziel, jeglichen weiteren Schmerz von diesen Stellen abzuhalten. Er hob die Faust nochmals, und auf irgendeine Weise gelang es mir, einen Arm nach oben zu bringen und den herabzuckenden Schlag von meinem Gesicht abzuwehren: Er traf die Seite meines Unterarms und schrammte daran entlang, und der Schmerz schoß mir bis in die Fingerkuppen.
Er rief nicht und schrie nicht. Er keuchte nur laut vor Aufregung und Konzentration. Mit einer raschen Bewegung drückte er meinen erhobenen Arm zur Seite. Sein Knie rutschte über mein Schienbein, als er sich besser abstützte. Ich schielte voller Panik auf seine rechte Faust und fuchtelte mit beiden Händen vor meinem Gesicht hin und her. Sein Knie rutschte noch weiter ab, bis er breitbeinig über mir kniete. Plötzlich griff er mit der linken Hand nach meinem Hals und drückte mit erstaunlicher Kraft zu, preßte mir den Atem so vollständig ab, daß ich nicht einmal mehr ein Keuchen zustande brachte. Ich konnte sein Gesicht in der Dunkelheit nicht sehen, aber ich wußte, daß es blaß sein und der Mund weit offenstehen und die Augen zusammengekniffene Schlitze sein würden, in denen die Mordlust funkelte. Ich stieß ihn mit meinem freigewordenen Knie in den Unterleib, zwischen die Beine, und es war ein Ruck, den ich bis in meine eigenen Zähne herauf spürte, und wenn ich überhaupt einen Wunsch hatte in diesem Moment, dann den, daß ich so hart zustoßen möge, daß ihm seine Hoden zerplatzten. Wenn ich Luft gehabt hätte, hätte ich gekreischt.
Seine erste Reaktion war, meinen Hals noch fester zu umklammern. Der Druck schoß mir bis in die Augenwinkel und ließ meine Augen schmerzhaft hervortreten. Dann erschlaffte seine Hand, und er gab seinen ersten Laut von sich: ein dumpfes Grollen, das mehr aus seinem Bauch als aus seiner Kehle zu stammen schien. Er fiel steif zur Seite, rollte sich zusammen und stieß das Grollen erneut aus, ein langanhaltendes, finsteres, schmerzerfülltes Geräusch, das mit einem Seufzen endete. Dann begann er, stoßweise zu keuchen und zu winseln und sich neben mir im Schmutz zu krümmen. Er hatte jedes Interesse an mir verloren.
Ich blieb auf dem Rücken liegen und starrte blind in die Finsternis, bis mir klarwurde, daß die nächste logische Reaktion meine Flucht sein mußte. Ich raffte mich auf, bis ich auf allen vieren kniete, den klopfenden Schmerz in meiner Seite und in der linken Gesichtshälfte ein Gefühl, als wäre alles Fleisch dort geschwollen und aufgeplatzt. Meine Oberschenkel hatten ihre Kraft verloren; als ich versuchte, noch weiter hochzukommen, sackte ich wieder zurück. Ich dachte: Um Gottes willen, lauf davon, und meine Beine strampelten erneut im Dreck, und ich kam schwankend in die Höhe und stieß gegen eine Mauer, die mir eine unerwartete Stütze gewährte.
Dann geschahen mehrere Dinge gleichzeitig.
Das Licht von Fackeln und das Geräusch rennender Füße näherte sich aus der Altstadt, und ich hörte über dem Klingen in meinen Ohren heisere Rufe. Zugleich fiel mir Hanns Altdorf er ein, und diesmal schoß die Panik beinahe noch schärfer in mich als vorhin, während ich mich des Hagels aus Faustschlägen erwehrt hatte. Ich sah ihn keine Mannslänge von mir entfernt. Sie hatten es nicht vermocht, ihn zu Boden zu stoßen – vielleicht hatte seine schlaksige Gestalt den Aufprall besser gedämpft als mein eigener schwerer Körper. Er hatte sein Barett verloren und versuchte, die beiden Männer, die auf ihn einschlugen, mit ungezielten Fußtritten abzuwehren. Er sah nicht auf, und auch er gab außer einem scharfen Keuchen keinen Ton von sich; er sprang vor und zurück, einer der Angreifer fiel plötzlich nach vorne, ob von der Unebenheit des Bodens oder von einem Tritt Altdorfers war nicht auszumachen, und der andere stolperte über seinen Genossen und stürzte dem Stadtkämmerer in die Arme. Ich stieß mich von der Wand ab, um ihm beizustehen; die Fackeln bogen um die Ecke, ich sah das Blinken von Lanzen und Schwertklingen und hörte wilde Rufe. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Mein erster Gedanke war: Sie sind bewaffnet. Wir sind erledigt. Meine Beine wollten nachgeben.
Die beiden Männer, mit denen Hanns Altdorfer kämpfte, warfen sich herum. Der zu Boden Gefallene stolperte wild in die Höhe und versuchte zu fliehen, aber aus der Gruppe der Neuankömmlinge setzte ihm einer nach und verfolgte ihn laut fluchend. Der andere Mann zerrte an Altdorfers Armen und versuchte sich loszureißen. Ich sah, wie der Stadtkämmerer ihn festzuhalten versuchte. Ich hörte mich erschrocken rufen: »Laß ihn laufen!«
Der Mann kämpfte eine Hand frei, schlug nach Altdorfers Gesicht, aber dieser bog den Kopf weit genug nach hinten, um ihm auszuweichen. Die Männer mit den Fackeln sprangen auf die Kämpfenden zu, um sie
– niederzuhauen
auseinanderzuzerren, und der Festgehaltene hob die Faust erneut, im Licht der Fackeln blitzte die Klinge eines Messers auf, das Aufblinken gleichzeitig mit einem vielstimmigen Aufschrei des Entsetzens, Faust und Messer fuhren herab, und Altdorfer taumelte zurück und stürzte schwer zu Boden.
Ich schrie: »Nein!!«
Der Angreifer fuhr herum, die Hand mit dem Messer vorgestreckt. Zwei, drei Schwerter erhoben sich zugleich, eine Klinge zuckte nach unten, und das Messer fiel auf den Boden, und eine weitere schlug zu, und eine Hand folgte dem Messer nach. Wenn nicht alles laut durcheinandergerufen hätte, wäre vielleicht das entsetzliche Geräusch zu hören gewesen, mit dem mehrere Spieße durch Gewand, Haut, Fleisch und Knochen drangen; so sah ich nur, wie der dritte der Angreifer einen Augenblick an den Spießen hing, als wäre er eine Puppe und die Lanzen nur dazu da, um ihm eine aufrechte Haltung zu verleihen, dann wurden die Spieße ruckartig zurückgerissen, und er taumelte dem Ruck hinterher und fiel den Männern mit den Fackeln lautlos vor die Füße.
Es war, als wäre er auf eine geheimnisvolle Weise mit mir verbunden gewesen. Ich sah ihn stürzen, und dann sah ich nichts mehr. Schwach spürte ich, daß ich ebenfalls zusammensackte, und ich hörte noch, wie einer der Neuankömmlinge rief: »Schnell, helft ihm.«
Dann versagte auch mein Gehör und mit ihm mein Gleichgewichtsgefühl, und ich hatte keinen Körper mehr und schwebte in einem schmerzfreien, erinnerungsfreien Raum.
Mein erster, bewußter Eindruck danach war der mehrerer Gesichter unter matt blinkenden Helmen, die mich angespannt musterten, und ein Tätscheln auf meiner verletzten Wange, das zuerst lästig war und dann, als ich vollkommen erwachte, einen scharfen Schmerz in mein Gehirn sandte. Ich hob einen Arm und schob die tätschelnde Hand schwach zur Seite. Die linke Hälfte meines Unterleibs begann zu schmerzen; dann wurde mir von der Bewegung übel, und ich würgte. Das Innere meines Halses brannte wie Feuer. Mit einem Schlag wußte ich wieder, wo ich mich befand und was geschehen war.
»Wie geht es Euch, Herr?«
Ich lallte: »Wo ist der Stadtkämmerer?«
Jemand schob die um mich stehenden Männer beiseite und drängte sich zu mir durch: Es war Hanns Altdorfer.
»Ich bin in Ordnung«, sagte er ruhig.
»Hanns«, krächzte ich. In diesem Moment hätte ich weinen mögen. »Ich dachte, er hätte dich umgebracht.«
»Er hat mich nur geritzt«, sagte er. »Erinnerst du dich, wie kalt es im Rathaus war wegen der Treppenöffnung im Tanzsaal? Ich hatte so viele Jacken und Wämser übereinander an und darüber noch den Mantel, daß der Stoß fast vollständig abgefangen wurde.«
Er lächelte, aber er war unnatürlich blaß. Im Fackelschein glänzte ein feines Netz aus Schweißtropfen auf seiner Stirn, und seine Augen waren weit.
»Ohne das«, sagte er und hob einen Fetzen seines Mantels hoch, »hätte er mich abgestochen.«
Ich schloß die Augen und ließ mich zurücksinken. Langsam verging das Gefühl der Übelkeit; ich atmete tief ein und roch den beißend harzigen Geruch der Fackeln. Die Kälte des Erdbodens drang durch meine Kleidung, und das Liegen wurde mir unangenehm. Ich öffnete die Augen wieder und richtete mich auf. Als ich saß, begann meine linke Gesichtshälfte zu pochen. Ich versuchte, auf die Beine zu kommen, und ein paar Hände griffen zu und zogen mich in die Höhe. Ich schwankte, aber ich blieb stehen. Durch das Aufstehen hatte sich die Wunde auf meiner Wange wieder geöffnet, ein scharfer Stich inmitten des betäubenden Pochens, und ich spürte, wie mir ein dünner Blutfaden die Backe hinunterlief. Ich griff nach oben und wischte ihn weg, und die Bewegung brachte mich erneut aus dem Gleichgewicht. Einer der Männer griff zu und stützte mich. Erst jetzt fiel mir auf, daß er und seine Kumpane einheitlich gestreifte Wämser trugen.
»Wer sind diese Männer?« fragte ich Altdorf er.
»Wappner«, sagte der Stadtkämmerer. »Stadtknechte.«
»Was für ein glücklicher Zufall, daß sie in der Nähe waren.«
»Es war kein Zufall«, sagte Altdorfer.
Einer der Männer stellte sich neben Altdorfer und nahm seinen Helm ab. Er schien der Anführer der Truppe zu sein. Er lächelte grimmig.
»Kein Zufall?« echote ich.
Der Wappner ergriff das Wort.
»Nein«, sagte er. »Wir handeln im Auftrag des Kanzlers.«
»Doktor Mair?« Ich wandte mich an Hanns Altdorfer. »Was hat das zu bedeuten?«
Der Stadtkämmerer hatte sich abgewandt und beobachtete, was neben der Mauer des Lagerhauses vor sich ging. Die Wappner hatten den Mann, der mich angegriffen hatte, unsanft auf die Beine gestellt. Er krümmte sich noch immer, aber er schien sich so weit erholt zu haben, daß er wieder atmen konnte. Sie lehnten ihn gegen die Mauer und leuchteten ihm mit einer Fackel ins Gesicht; selbst von hier aus konnte ich sehen, daß er leichenblaß war und ihm Blut aus dem Mund lief – er hatte sich auf die Zunge gebissen. Bei jedem Ausatmen war ein kurzes Ächzen zu hören, und er stützte sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel. Dabei starrte er verbissen nach unten und ließ das Blut auf den Boden tropfen. Derjenige der Angreifer, der zu fliehen versucht hatte, wurde ebenfalls unsanft herbeigezerrt und gegen die Wand gedrückt. Er hatte eine Schürfwunde im Gesicht und sah betäubt und verängstigt aus.
Altdorfer hatte seine Aufmerksamkeit auf den dritten der Männer gerichtet, jenen, der den Dolch gegen ihn gezogen hatte. Die Wappner packten ihn an den Beinen und schleiften ihn zur Hausmauer, neben die anderen, die sich bemühten, den Toten nicht anzublicken. Als sie ihn davonzerrten, wanderte auch der Fackelschein seiner Träger mit ihm, und die Schatten bemächtigten sich der Stelle, an der er zusammengebrochen war. Bevor das Licht den Platz endgültig verließ, konnte man die dunkelglänzenden Blutlachen sehen, die sich in den Furchen gesammelt hatten, und ein unsägliches, abgetrenntes totes Ding, das wie ein Häufchen Dreck in einer eigenen Blutlache lag. Ich sah weg, als einer der Wappner sich bückte und die Hand mit spitzen Fingern aufhob; ich richtete den Blick auf den Toten, der jetzt ausgestreckt mit dem Gesicht nach oben neben der Hausmauer lag, das ganze Vorderteil seines Wamses zerrissen und schwarz vor Blut. Der Stadtknecht trat hinzu und legte ihm die abgehackte Hand auf die Brust. Dann bückte er sich, fuhr dem Toten über das Gesicht und schloß die weitaufgerissenen Augen. Ich war froh, als die Männer von der Leiche zurücktraten und auch das Fackellicht mitnahmen, so daß nur noch ein dunkler Körper im Schatten an der Hausmauer zu erkennen war. Ich sah zu Hanns Altdorfer. Er schluckte trocken, und seine Hände zitterten. Als er sich zu mir umdrehte, stand sein Mund offen, und sein Gesicht war verzerrt. Die Wirkung des Schocks klang offensichtlich ab.
Altdorfer machte eine Geste zu dem Anführer der Wappner. »Erklärt es ihm«, sagte er rauh. »Ich glaube, mir wird übel.«
Er trat einige Schritte beiseite und setzte sich dann hart auf den Boden, als hätten seine Beine plötzlich nachgegeben. Er blieb so sitzen, mit angezogenen Knien, zwischen denen seine Hände baumelten, und gesenktem Kopf. Der Führer der Stadtknechte blickte ihn besorgt an.
»Er braucht etwas zu trinken«, sagte er und nestelte einen Beutel vom Gürtel, dem er eine krumme Steingutflasche entnahm. Er entkorkte sie, zögerte einen Moment, dann hielt er sie mir hin. Ich packte sie und sog kräftig an ihrem Hals; der Schnaps brannte mit dem Geschmack fauler Weintrauben meine Kehle hinunter und schmerzte in meinem wunden Hals. Die Tränen stiegen mir in die Augen, aber mein Kopf wurde kurzzeitig klar. Der Wappner winkte einem seiner Männer und übergab ihm die Flasche; ich sah, wie dieser sich zu Altdorfer bückte und ihm die Flasche vor das Gesicht hielt, aber der Stadtkämmerer schüttelte den Kopf.
Ich fragte: »Was hat der Kanzler mit Eurem Auftauchen zu tun?« Der Anführer der Wappner zuckte mit den Schultern.
»Er hat uns beauftragt, auf den Herrn Notarius achtzugeben.«
»Wußte der Stadtkämmerer denn davon?« fragte ich fassungslos.
»Nein. Ich habe es ihm eben erklärt. Um ihn nicht nervös zu machen, sollten wir soweit wie möglich darauf schauen, daß er uns nicht bemerkt. Das ist heute natürlich hinfällig geworden.«
»Wozu denn das alles?«
»Ich weiß nicht. Ich nehme an, daß der Herr Kanz1er großen Wert auf die Gesundheit des Herrn Notarius legt.«
Natürlich; es war vollkommen klar. Hanns Altdorfer trug zusammen mit dem Kanzler die Verantwortung für die Hochzeitsvorbereitungen. Ich fragte mich, ob der Kanzler erst nach dem Mord an der polnischen Gräfin daran gedacht hatte, Altdorfer heimlich bewachen zu lassen; aber im Grunde genommen war der Zeitpunkt gleichgültig. Seine Umsicht hatte uns heute vermutlich das Leben gerettet. Die Ironie an der Geschichte war, daß der Überfall mit Sicherheit nicht dem Stadtkämmerer, sondern mir gegolten hatte. Ich schauderte. Hätte ich meinen Freund nicht zur Kirche begleitet, wäre ich aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt bereits ein toter Mann. Es ist nicht leicht, sich mit dem Gedanken abzufinden, daß man gerade dem Tod entronnen ist; noch weniger leicht ist es, wenn man erfährt, daß man diesen Umstand nur einem Irrtum verdankt. Ich schloß die Augen und atmete tief ein und aus. Am liebsten hätte ich mich neben Altdorfer auf den Boden gesetzt.
»Wie seid Ihr so schnell hierher gekommen?« fragte ich nach einer Weile.
»Wir haben das Rathaus beobachtet«, erwiderte er. »Im Normalfall sind immer einer oder zwei von uns dem Stadtkämmerer unauffällig gefolgt, wenn er sich irgendwohin begab. Das war auch heute der Fall. Wir waren anfangs beruhigt, weil wir Euch in seiner Begleitung sahen. Dann stellten wir fest, daß Euch eine Gruppe von sechs Männern in einem gewissen Abstand folgte. Ich sandte zwei Männer dieser Gruppe hinterher. Sie kamen bald zurück und berichteten, daß die Kerle Euch überholt und sich in Neustadt getrennt hätten, um so schnell wie möglich beide Zugänge zur Freyung abzuriegeln. Da war mir klar, daß sie nichts Gutes im Schilde führten, und ich trommelte alle verfügbaren Männer zusammen und folgte Euch nach.«
»Habt Ihr die anderen erwischt?«
»Ich habe es gar nicht erst versucht. Ich wollte kein Risiko eingehen und bin mit all meinen Leuten Euch nachgelaufen. Ich nehme an, sie werden inzwischen über alle Berge sein.«
Ich nickte langsam; es hätte mir besser gefallen, wenn auch die übrigen Strolche den Wappnern in die Hände gefallen wären.
»Kann ich die Gefangenen etwas fragen?«
Er breitete gleichgültig die Hände aus.
»Wenn Ihr Euch etwas davon versprecht...«
Ich nahm eine der Fackeln und schritt zu den Männern. Als ich mich ihnen näherte, begann meine Hand zu zittern, aber ich unterdrückte die Reaktion und leuchtete ihnen ins Gesicht; ich betrachtete selbst die Züge des Toten. Keiner der drei schien der Mann zu sein, der sich gestern als der Anführer der Strauchdiebe hervorgetan hatte. Ihre Gesichter waren mir unbekannt, aber das bedeutete nichts; ich hatte gestern keinen der anderen Männer genau angesehen. Ich versuchte, in ihren Augen ein Zeichen des Erkennens zu lesen, aber der eine hielt den Blick stur zu Boden gerichtet, und der andere starrte mir nur voller Panik ins Gesicht. Er zitterte beinahe ebenso stark wie ich selbst. Er war jung, höchstens so alt wie mein Sohn Daniel.
»Wer hat euch geschickt?« fragte ich ihn.
Er antwortete nicht. Sein Mund arbeitete, und seine Augen zuckten hin und her, aber außer seinem stoßweisen Atem kam ihm nichts über die Lippen. Der Anführer der Wappner trat neben mich und leuchtete ihm mit einer zweiten Fackel ins Gesicht. Die Augen des jungen Mannes irrten von mir ab und hefteten sich mit noch größerer Furcht auf ihn.
»Wer hat euch geschickt?« wiederholte ich.
Ich erhielt keine Antwort. Der Anführer der Wappner wandte sich an mich und sagte gelassen: »Ich glaube nicht, daß Ihr damit weiterkommt.« Er wandte sich ab. Im nächsten Moment wirbelte er herum, stieß die Fackel dem jungen Burschen ins Gesicht und brüllte: »Wer hat dich geschickt, du Bastard!?«
Der Bursche zuckte zurück und stieß sich den Hinterkopf heftig an der Mauer. Ein Winseln entrang sich ihm, und seine Lippen fingen noch heftiger an zu zittern. Plötzlich rann ihm ein Speichelfaden den Mundwinkel hinunter. Der andere der Männer regte sich, faßte zu ihm hinüber und legte ihm eine Hand auf den Arm. Dann hob er das Gesicht und starrte mir mit funkelndem Haß in die Augen. Auch er sagte kein Wort.
»Das hab ich gerne«, knurrte der Anführer der Wappner. »Ehrbare Männer aus dem Dunkel heraus überfallen und sich dann vor Angst in die Hose machen.«
Er wies verächtlich auf die Oberschenkel des jungen Burschen, und seine Männer drängten sich vor und lachten rauh. Im Schritt seiner schmutzigen Hose breitete sich ein nasser Fleck aus.
»Schafft mir die Kerle aus den Augen«, sagte er zu seinen Männern. »Dann bringen wir den Stadtkämmerer und den Herrn nach Hause.«