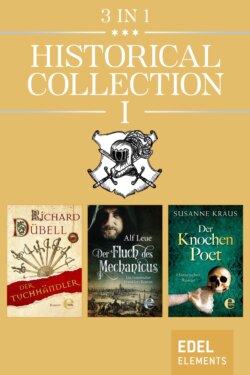Читать книгу Historical Collection I - Susanne Krauß - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеMein Spitzel erwartete mich an unserem Treffpunkt. Er schien unruhig, und ich sah, daß ihm etwas auf der Zunge lag. Er starrte mich nach einem knappen Gruß mit einem Blick an, der halb ärgerlich und halb unsicher war, dann sagte er stockend: »Seid Ihr sicher, daß Ihr mir vertraut?«
»Wie kommt Ihr darauf, daß es nicht so sein könnte?«
Er seufzte; es war ihm anzusehen, daß er überlegte, ob er sich seine Ehrlichkeit ein zweites Mal leisten konnte. Er sah auf seine Fußspitzen und trat von einem Bein aufs andere.
»Weil noch jemand anderer das Haus beobachtet«, sprudelte er schließlich hervor. »Habt Ihr diesen Mann angestellt?«
»Was sagt Ihr da?« rief ich.
»Wenn Ihr mit mir nicht zufrieden seid, bitte ich Euch, mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe ...«, begann er, aber ich unterbrach ihn aufgeregt.
»Was soll das bedeuten?« drängte ich hastig. »Schnell, sprecht.«
Er starrte mich an und blinzelte. Scheinbar kam ihm zu Bewußtsein, daß er die falschen Schlüsse gezogen hatte.
»Ich weiß nicht«, stammelte er. »Er ist mir aufgefallen, weil ich sein Gesicht immer wieder in der Gasse sah, und mittlerweile weiß ich, daß auch er das Haus beobachtet.«
Ich sah in an, ohne ihn zu sehen. Ich bemühte mich krampfhaft, meine Aufregung zu unterdrücken.
»Seltsam«, brummte ich.
»Zuerst dachte ich mir, vielleicht haben die Verwandten des jungen Mannes ihn geschickt«, sagte er eifrig.
Ich fragte ihn einmal mehr überrascht: »Welchen jungen Mannes?«
»Na, Euer Mündel trifft sich doch mit einem jungen Mann, nehme ich an.«
»Ja, ja«, stieß ich hervor. »Natürlich.«
»Seht Ihr, ich bin dem anderen gestern abend ein wenig hinterhergeschlichen«, gestand er mit einer Miene, als erwarte er auch dafür sofortige Schelte. »Ich habe gesehen, wie er sich mit einem zweiten Mann besprach, und ich nehme an, es handelt sich dabei um seinen Auftraggeber.« Ich horchte auf.
»Wie sah er aus?« erkundigte ich mich.
»Ich sah ihn nur von weitem – und von hinten.«
»Groß? Klein? Welche Kleidung trug er?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Normale Größe, würde ich sagen. An seiner Kleidung ist mir nichts Besonderes aufgefallen.«
Ich sah ihn an; er selbst war klein und mager und in ausgeblichenes Zeug gekleidet. Ich wußte, daß man auf seinen Maßstab nicht viel Wert legen konnte.
»Kennt Ihr den Mann?« fragte er neugierig.
»Anhand dieser Beschreibung sicher nicht«, erwiderte ich beißender, als ich beabsichtigt hatte. Er machte sich nichts daraus.
»Wißt Ihr«, sagte er eifrig, »ich habe mir gedacht, es könnte ja sein, daß die Familie des jungen Mannes ebensowenig mit der Entwicklung der Dinge einverstanden ist wie Ihr.« Er schaute in mein Gesicht, stutzte, zog wieder den falschen Schluß und stieß hervor: »Bei allem schuldigen Respekt, Herr! Euer Mündel ist sicherlich eine feine junge Dame; aber der junge Mann ist vielleicht auch ein aufrechter Kerl. Ich meine, möglicherweise wäre ein Gespräch zwischen den Parteien angebracht ...«Erverstummte.
Ich versuchte zu lächeln. Ich ahnte, daß ich so finster ausgesehen hatte wie immer, wenn ich angestrengt über etwas nachdachte.
»Schon gut«, sagte ich. »Ich bin nicht beleidigt.«
Er rieb nervös die Handflächen aneinander und versuchte ebenfalls zu lächeln. Er schniefte und sagte dann entschlossen: »Wenn Ihr es wünscht, spreche ich ihn an.«
»Nein«, rief ich.
»Warum nicht?«
»Weil ... weil ich nicht will, daß man von Euch erfährt.«
Er sah mich betreten an, und ich fragte ihn voll düsterer Ahnung:
»Hat er Euch etwa schon entdeckt?«
»Nein, ich glaube nicht«, sagte er hastig. »Aber ich fürchte, daß es nur noch eine Frage der Zeit ist; wenn ich in der Lage war, ihn zu entdecken, wird es ihm bei mir nicht anders ergehen.«
Ich schwieg verdrossen.
»Wir treffen uns morgen wieder«, erklärte ich dann. »Vielleicht geschieht heute abend noch etwas. Bleibt auf Eurem Posten.«
Er nickte, sichtlich unzufrieden, daß er sich nicht als Friedensstifter betätigen konnte. Ich klopfte ihm leicht auf die Schulter und ging. Ich sollte ihn nicht mehr lebend wiedersehen.
Ich stolperte zurück in die Altstadt, tief in Gedanken versunken. Der alte Flößer hatte in einem Punkt mehr als recht: Es war an der Zeit, ein Gespräch zu führen. Ein Gespräch mit dem Beauftragten des Richters, der die Gefangenen verhören sollte, um herauszufinden, welche Aussagen sie gemacht hatten – und sollte er noch immer nicht eingetroffen sein, mußte ich mich selbst mit den beiden Überlebenden des Überfalls auseinandersetzen. Es mochte sein, daß ich sie zum Sprechen ermuntern mußte. Ich konnte nicht behaupten, daß dieser Gedanke mich mit freudiger Erwartung erfüllte. Wenn ich ehrlich sein wollte, hatte er mich auch bisher davon abgehalten, diese Unterredung selbst zu suchen. Sie hatten nicht gesprochen, als sie verletzt und verängstigt vor den Spießen der Stadtknechte gestanden hatten; sie hatten nach zwei Nächten im Kerker nicht gesprochen, oder der Stadtkämmerer hätte es erfahren – und ich fürchtete, sie würden nun erst recht nicht sprechen. Das naheliegende Mittel, ihnen die Zungen zu lösen, aber war, es mit Gewalt zu versuchen. Das bedeutete: die Folter. Ich wand mich bei dem Gedanken daran; ich wollte nicht dafür verantwortlich sein, daß man Menschen marterte, um ihnen ein Geständnis zu entreißen. Ein anderer Teil von mir sagte roh: Was kümmert’s dich? Die Burschen wollten dir ans Leder! Aber ich konnte keine Befriedigung empfinden angesichts der Vorstellung, daß man einem Mann die Glieder gewaltsam streckte oder die Fußsohlen über glühenden Kohlen röstete. Ich hatte die Begegnung mit der Folter während meiner Zeit mit Bischof Peter immer zu vermeiden versucht. Manchmal war es mir nicht gelungen. Ich schlug den Weg zum Stadtgericht ein.
»Ich erwarte einen Beauftragten des Richters«, erklärte ich einem der Schreiber. »Er müßte aus Burghausen kommen. Ist er bereits eingetroffen?«
»Bei uns hat sich niemand gemeldet.«
Ich seufzte. Worauf wartete der Mann? Aber das Wetter war schon seit Tagen schlecht, und es brauchte nur einer der kleinen Flüsse über das Ufer getreten sein, um die Straße von Burghausen nach Landshut unpassierbar zu machen. Ich vermutete, daß der Richter in diesem Fall eine weitere Taube geschickt hätte; doch es konnte gut sein, daß sein Bote zwischen zwei Hochwassern gefangen war, die ihm sowohl den Her- als auch den Rückweg abschnitten, und der Richter ebenso uninformiert war wie wir. Nicht zuletzt konnte auch einer der herzoglichen Jäger aus Versehen eine eventuell geschickte Taube abgeschossen haben; Hanns Altdorfer hatte deutlich genug erklärt, daß die Wälder rund um Landshut von Bolzen und Pfeilen schwirrten.
Ich konnte jedoch nicht viel länger warten. Ich mußte es selbst versuchen.
»Mein Name ist Peter Bernward«, sagte ich zu dem Schreiber. »Der Stadtkämmerer und ich wurden am Montag abend von ein paar Männern überfallen. Zwei davon wurden von den Wappnern festgenommen.«
Der Mann nickte und betrachtete mich mit neuem Interesse.
»Ihr seid das«, sagte er. »Ich habe schon davon gehört.«
»Ist es möglich, mit den Gefangenen zu sprechen?« fragte ich vorsichtig.
»Die Festgenommenen sind aber nicht hier«, erklärte er.
Ich schaute ihn verblüfft an.
»Wo sind sie dann?«
»In Burghausen.«
»Warum in aller Welt habt Ihr sie nach Burghausen gebracht?«
Er sah mich einen Moment lang nachdenklich an, als wäre er erstaunt über meine Unwissenheit. Später kam mir der Gedanke, daß er selbst einen Grund zu finden suchte, weshalb man die beiden Männer nicht in Landshut eingekerkert hatte.
»Um das Gefängnis für die zu erwartenden Übertretungen während der Hochzeit freizuhalten«, sagte er schließlich.
»Wer hat das angeordnet?« rief ich laut.
»Es gibt einen Befehl vom herzoglichen Rat.«
»Seit wann?«
»Soweit ich informiert bin, gilt diese Anordnung seit der Hochzeit Herzog Ludwigs.«
Ich schloß die Augen.
»Kennt der Richter diesen Befehl?«
»Er hat zur Zeit viel um die Ohren,« erwiderte der Schreiber, als wolle er seinen Herrn verteidigen. »Weshalb? War es ein Fehler, die Gefangenen nach Burghausen zu verlegen?«
»Ich hätte dringend mit ihnen sprechen müssen!« knirschte ich. »Und Richter Girigel wollte eigens deswegen einen Mann nach Landshut senden.«
Der Schreiber machte ein nachdenkliches Gesicht und sagte endlich würdevoll: »Ich hätte Euch ohnehin keinen Zutritt zum Kerker gewähren dürfen.«
Ich diskutierte nicht mit ihm darüber; es machte keinerlei Sinn. Ich dankte ihm düster und ging. Der Gedanke plagte mich, daß ich zu spät gekommen war. Ich hätte die beiden Männer nicht mehr aus den Augen lassen sollen. Meine einzige Hoffnung war jetzt der Gehilfe, von dem Daniel gesprochen hatte. Selbst wenn seine Spießgesellen untergetaucht waren, mochte er auf der Baustelle zurückgeblieben sein, um die Entwicklungen weiter zu beobachten. Er war im großen und ganzen unauffällig. Ich hoffte, er wäre zurückgeblieben; ich hätte ihn zurückgelassen.
Ich besuchte die Baustelle, aber sie war verwaist bis auf eine langsam den Platz abschreitende Patrouille aus zwei Wappnern, die mich nicht beachteten. Daniel hatte recht gehabt; ich konnte frühestens morgen hoffen, mit dem jungen Mann zu sprechen. Ich kehrte um und ging mein Pferd holen. An der Einmündung zum Ländtor blieb ich unschlüssig stehen und überlegte, ob ich Jana Dlugosz aufsuchen sollte; aber ich hätte es nicht tun können, ohne auf Albert Moniwid zu stoßen, und ihm wollte ich unbedingt ausweichen. Ich informierte Hanns Altdorfer, den ich an seinem üblichen Platz im Rathaus fand, und wünschte mir hinterher, ich hätte es nicht getan, denn die Nachricht schien ihn zu entsetzen, und es gelang mir weder ihn noch mich selbst aufzuheitern. Ich ritt nach Hause. Die Hälfte unserer Frist war bereits verstrichen, und wir hatten noch nichts erreicht.
Am Donnerstagmorgen fand ich mich so früh wie möglich in der Stadt ein, um die Baustelle aufzusuchen. Als ich am Rathaus vorbeiritt, öffnete sich ein Fenster, und Hanns Altdorfer winkte heraus und rief mir etwas zu. Ich kehrte um, band mein Pferd fest und betrat das Gebäude. Um diese Stunde war noch keiner der Schreiber anwesend, nur vom oberen Stockwerk hörte ich die Geräusche der Arbeiter, die mit dem Umbau des Ratsherrensaals beschäftigt waren. Hanns Altdorfer entließ zwei Stadtknechte, als ich eben zu ihm eintreten wollte. Er blickte ihnen mit einem verdrossenen Gesichtsausdruck hinterher, dann bot er mir mit einer brüsken Handbewegung einen Platz an.
»Was gibt es?« fragte ich. »Ich bin in Eile.«
»Ich wollte dich unterrichten, daß ich gestern abend nur mit Mühe die Ratsherren davon abbringen konnte, die Stadttore vor der Prinzessin zu schließen.«
»Was?«
»Ich weiß nicht, was sie sich davon versprochen haben. Wir haben bis in die Nacht gestritten; vor allem Contzen von Asch hat sich mit seinem großen Mundwerk hervorgetan.«
Ich schüttelte verständnislos den Kopf.
»Hoffentlich wird das nicht ruchbar. Wenn es Moniwid erfährt, ist der Teufel los.«
»Ich weiß. Ich bin froh, daß sie schließlich auf die Vernunft gehört und sich zum Nachgeben haben bewegen lassen.«
Ich dachte an die Tote und an das leerstehende alte Haus.
»Glaubst du, wir haben es hier mit einer Verschwörung zu tun, in die noch ein paar der reichen Bürger verstrickt sind?«
Er verzog den Mund und hob die Schultern.
»Kaum«, sagte er dann. »Wenn ich mich nicht irre, war die gestrige Aktion nur der Ausdruck überschätzten Bürgerstolzes, den ein paar aufgeblasene Streitgockel angefacht haben.«
Ich schmunzelte unwillkürlich. Seine Empörung amüsierte mich trotz meiner Ungeduld, zur Baustelle zu gelangen.
»Das ist die richtige Aufgabe für dich«, sagte ich. »Den überschäumenden Bürgerstolz zu dämpfen.«
Er schnaubte angewidert.
»Glaub das nur nicht. Ich habe offenen Mundes gestanden vor soviel Sturheit. Vermutlich haben sie mir nur zugestimmt, weil sie mich bedauerten.«
Ich lachte und schüttelte den Kopf.
»Wer waren denn die Rädelsführer?«
»Die sattsam bekannten Querköpfe: von Asch, der alte Kettner, Heinz Moosburger ... schon ihre Großväter haben damals beim Aufstand auf die eine oder andre Weise mitgemacht. Streitsüchtigkeit scheint sich zu vererben.«
»Wolfgang Leutgeb?« fragte ich aus einer plötzlichen Eingebung heraus.
»Der ist leider nicht in der Stadt; er hätte wohl noch am ehesten Partei für den Herzog ergriffen.«
»Ich habe vorgestern mit ihm gesprochen«, sagte ich befremdet. Altdorfer hob die Augenbrauen.
»Ich habe nach ihm schicken lassen, und es hieß, er sei geschäftlich unterwegs. Vielleicht hat man ihn auch nur nicht aus seinem Rausch aufwecken können.« Er wischte die Bemerkung mit einer Handbewegung beiseite.
»Das war alles, was ich dir sagen wollte. Nein, noch etwas: Einer deiner Angestellten hat einen Boten zu mir gesandt. Er sollte dir ausrichten, daß deine Flöße angekommen sind, und suchte dich bei mir. Ich wollte den Boten zu dir hinaus senden, aber er sagte mir, daß die Nachricht bereits dorthin unterwegs sei. Wen immer du beauftragt hast, er scheint ein umsichtiger Mann zu sein.«
Ich sprang auf und rief verblüfft: »Was? Meine Flöße?«
»Ja, die Flöße mit der Stofflieferung aus Innsbruck. Das war es wohl, was er mich dir mitzuteilen bat.«
»Hanns«, sagte ich erregt, »du mußt mich entschuldigen. Ich muß zur Floßlände.«
Er zuckte mit den Schultern, und ich rannte hinaus.
An der Floßlände hatte sich eine große Menschenmenge eingefunden, um das Schauspiel zu beobachten. Ich drängte mich hindurch, und man machte mir unwillig Platz. Durch meine Größe konnte ich über die Köpfe der Menge hinweg zum Wasser hinunter sehen. Fünf oder sechs gewaltige Flöße hingen in einem weiten Bogen bis fast zum anderen Ufer hinüber in die Strömung des Flusses hinein. Ich erreichte das Flußufer, wo die Menschen Platz für die landenden Flößer ausgespart hatten, und blieb atemlos stehen.
Die Flöße waren mit langen Ketten aneinandergehängt; vermutlich, um sie besser an Land ziehen zu können. Vielleicht war dies auch die Art, wie sie den Fluß herunterfuhren: zusammengefesselt, damit keines ver-/ lorengehen konnte. Es war eine schwierige Aufgabe, die störrischen, hochbeladenen Fahrzeuge aus der Strömung zu zerren und ins seichte Wasser zu bugsieren. Die Flößer hatten ein Dutzend oder mehr Taue an Land geworfen, und an jedem Ende standen ein oder zwei Männer und stemmten sich in den Kiesboden ein; die Taue waren an den Flößen festgemacht und spannten sich oder klatschten mit knallenden Lauten ins Wasser, je nachdem, wohin die Strömung die einzelnen Flöße zog. Sie brachten eines nach dem anderen aus der Fahrrinne heraus; sobald sie ein Floß im seichten Wasser hatten, wateten ein paar von ihnen hinein und luden sich die Stoffballen auf die Schultern, um sie an Land zu tragen. Andere hielten das Floß mit langen Stangen und Haken an einem Ende fest. Sowie die Ballen fast zur Gänze abgeladen waren, begannen sie damit, die verschnürten Stämme der Flöße auseinanderzubinden und die einzelnen Stämme an Land zu rollen. Ich wußte, daß sie nur ein oder zwei Flöße intakt lassen würden, um schnell ein Transportmittel zur Hand zu haben. Sie waren erstaunlich geschickt darin und arbeiteten schnell. Ich sah, daß nicht nur die Männer, die Tannberger mitgenommen hatte, sich mit dem Entladen der Flöße beschäftigten, sondern auch ihre Kameraden, die in Landshut zurückgeblieben waren. Sie spornten sich gegenseitig mit Rufen und heiseren Liedern an, und diejenigen, die auf den Flößen geblieben waren, um sie im Fall eines Losreißens weiter unten wieder an Land steuern zu können, antworteten ihnen mit Gelächter und Flüchen. Selbst aus der Menge der Zuschauer ertönten Rufe und Pfiffe. Die Flöße trieben auseinander, bis die Ketten, die sie verbanden, straff waren, dann stakten die Flößer sie wieder zueinander, so daß sich die Ketten ins Wasser senkten. Danach wiederholte sich das Schauspiel. Das Wasser hinter den Flößen färbte sich hellbraun.
Hart am Wasser begann der Berg von entladenen Stoffballen zu wachsen. Ich trat näher und wurde von einem Wappner aufgehalten, der um die Ballen herumkam.
»Tretet zurück«, schrie er über den Lärm. »Das ist der Besitz von Peter Bern ward.«
»Ich bin Peter Bernward!« rief ich zurück und mußte gleichzeitig lachen. »Wer hat Euch beauftragt, auf den Stoff aufzupassen?«
»Wenn Ihr Peter Bernward seid, wißt Ihr seinen Namen«, sagte er schlau.
»Jörg Tannberger?«
Er nickte und trat einen Schritt zurück. Seine bauernschlaue Vorsicht amüsierte mich; noch mehr aber amüsierte mich der Betrieb, mit dem meine Stofflieferung entladen wurde. Amüsierte? Nein, ich freute mich so darüber, daß ich laut zu lachen begann, noch während ich den Arbeiten zusah.
»Wo ist Tannberger?« rief ich dem Wappner zu.
»Er ist gleich nach Ankunft der Flöße fortgeritten, um Transportkarren zu holen«, schrie er. »Er müßte bald zurück sein.«
Ich nickte und wandte mich ab, um die Ballen zu prüfen. Tannberger hatte die Stoffe in dichtes Tuch einwickeln und zum Teil Leder darum festbinden lassen, um sie vor dem Wasser zu schützen. Plötzlich tat es mir leid, daß ich ihn nicht persönlich in Landshut hatte willkommen heißen können. Ich wischte mir die nassen Hände an den Hosenbeinen ab, legte den Kopf in den Nacken und schloß die Augen. Er hatte es geschafft. Ich begann, den Lärm um die Ausladestelle zu genießen.
Dann stieß eine Frau einen spitzen Schrei aus, und das Singen und Rufen verstummte nach und nach. Ich öffnete verwirrt die Augen und sah mich um, aber ich erblickte es erst, nachdem nochmals jemand in meiner Nähe aufschrie und auf das Wasser hinaus zeigte.
Die Strömung hatte die Flöße wieder auseinandergezerrt, und die Spannung hatte die schwere Kette vom Flußboden hochgezogen. Sie war schmutzig; Algen und Wassergras hingen triefend von ihren Gliedern und tanzten mit den Schwingungen der Kette auf und ab. Dazwischen hing der schlaffe, nasse Körper eines Menschen. Ich sah ihn, und in diesem Moment fiel er durch die Bewegungen der Kette ins Wasser zurück und versank. Ein paar Männer auf den Flößen stachen sofort mit den Stangen hinterher, und andere stürzten sich vom Land aus ins Wasser. Sie hatten ihn in Sekundenschnelle herausgezogen; anders als das würdelose Gezerre um den Toten vom Bleich wehr. Zwei der Flößer hoben ihn aus dem seichten Wasser und trugen ihn an Land. Sie legten ihn vorsichtig auf den Rücken und sahen sich betreten um. Einer bückte sich und pflückte Schmutz von seinem Gesicht.
Mein Herz setzte aus und pumpte dann Eis in meinen Körper. Es war mein Spitzel, und er war so tot wie ein Büschel Tang.
Nicht lange danach stand ich mit Hanns Altdorfer vor dem Versammlungshaus der Flößer und Fischer am oberen Ende der Ländgasse. Man hatte die Leiche in einer Ecke des engen Beratungsraums aufgebahrt. Ein Kreis von Männern mit langen Gesichtern stand um sie herum und starrte sie an; beinahe alle von ihnen trieften noch vor Nässe von der Entladeaktion. Ich dachte flüchtig daran, daß meine Stoffe mittlerweile bereits auf die Transportkarren geladen wurden, die Jörg Tannberger beschafft hatte, aber ich konnte keine Freude mehr darüber empfinden. Die Männer drehten sich nach unserem Eintreten zu uns um. Hanns Altdorfer blieb einen Moment auf der Schwelle stehen, aber ich eilte ohne Zögern auf die Bahre zu. Die Männer wichen zur Seite, und plötzlich fand ich mich Auge in Auge mit dem Sprecher der Flößer wieder. Er sah mich mit einer Mischung aus Verwirrung und Zorn an, als wollte er sagen: Dafür bist du verantwortlich; ich weiß nur nicht wie. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber er wandte den Blick nach unten, und ich folgte ihm unwillkürlich und sah dem Toten ins Gesicht. Es war von leuchtender Blässe; die Bartstoppeln stachen scharf von der weißen Haut ab. Sonst hatten Tod und Wasser keine deutlichen Beschädigungen in seinen Zügen angerichtet. Jemand hatte kleine Münzen auf die Augen gelegt, damit die Lider geschlossen blieben. Als ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, wollte er sich als Friedensstifter zwischen den Familien zweier vermeintlicher Liebender betätigen.
Der Sprecher sagte mit erstickter Stimme: »Gott sei seiner Seele gnädig.«
Ich stützte mich schwer auf die Bahre und atmete tief ein und aus. Undeutlich spürte ich, wie Hanns Altdorf er neben mich trat.
»Wer ist der Mann?« fragte er leise.
Ich sah auf und begegnete dem verwundeten Blick des Sprechers der Flößer. Ich biß die Zähne zusammen und drehte mich zu Hanns um. Ich sah ihm eindringlich in die Augen und sagte: »Er hat einen kleinen Dienst für mich verrichtet.«
Der Stadtkämmerer verstand genug, um nicht weiter nachzufragen. Sein Blick irrte ab und traf ebenfalls das Gesicht des toten Mannes. Er schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Hatte er Familie?« hörte ich mich fragen.
Der Sprecher der Flößer nickte.
»Die Zunft wird sich ihrer annehmen. Wenn Ihr für sie etwas spenden wollt ... «
Ich antwortete nicht sofort, und er setzte stockend hinzu: »Es ist Eure Entscheidung. Ich möchte nicht, daß Ihr Euch verantwortlich fühlt für seinen Tod. Ihr seid sicherlich schuldlos.« Er sah mir in die Augen, und sein Blick strafte seine Worte Lügen. Er war sich nicht im mindesten sicher, daß ich für den Tod seines Kameraden nicht verantwortlich war; aber er konnte sich keinen Umstand denken, der meine Schuld bewiesen hätte. Ich selbst glaubte es besser zu wissen, aber ich schwieg. Nach einem Moment dieses Schweigens sah er sich gezwungen, weiterzusprechen.
»Er war schon alt«, sagte er abwesend. »Ich habe gehört, wie er des Nachts hustete. Vielleicht hat ihn ein Schlag getroffen.« Er warf mir einen erneuten Blick zu, der bewies, daß er selbst nicht an seine Worte glaubte.
»Ertrunken«, murmelte Hanns Altdorf er. Ich sah, wie sich ein paar der bleichen Gesichter um uns herum verschlossen. Ich dachte bei mir: Ein Mann, der sein ganzes Leben auf dem Wasser zugebracht hat, ertrinkt nicht so leicht. Nicht einmal, wenn er so besoffen ist wie ein ganzer Trupp Landsknechte. Ich sog heftig die Luft ein und drehte mich abrupt um. Ich hatte den dringenden Wunsch, den düsteren Raum zu verlassen. Dann sah ich die Füße, die nackt und mit blauen Zehennägeln aus der Hose ragten. Ich trat nochmals auf den Toten zu und sah sie mir näher an. Unwillkürlich folgte mir der Blick des Sprechers.
Ich faßte vorsichtig an die ausgefranste Öffnung eines Hosenbeins und schob den nassen Stoff über das Schienbein zurück. Knapp über den Knöcheln war die Haut an der Außenseite des Beins wundgescheuert und aufgerissen. Die Stelle war so weiß wie der übrige Körper, weil das Wasser alles Blut herausgewaschen hatte, aber man konnte die Verletzung doch deutlich sehen. Ich schob das andere Hosenbein hoch und sah die gleichen Aufschürfungen auf der dort außenliegenden Seite. Ich biß die Zähne zusammen und blickte hoch.
Der Sprecher der Flößer sah mich fragend an. Als ich nichts sagte, wanderte sein Blick zwischen den Füßen des Toten und mir hin und her. Ich nickte ihm zu.
»Ich werde mich wieder an Euch wenden«, sagte ich, ohne mein Verhalten zu erklären. Er nickte langsam und ratlos, mit schmalen Lippen und ohne jede Freundlichkeit in seinen Zügen. Ich schritt eilig hinaus, Hanns Altdorf er im Gefolge. Das Licht draußen war düster und neblig, aber es blendete mich dennoch. Ich kniff die Augen zusammen und blinzelte. Ich spürte eine Übelkeit, daß ich mich hätte übergeben mögen, aber es war eine Übelkeit, die aus meiner Seele kam und nicht aus meinem Bauch. Der Mann war tot; ohne mich würde er noch leben.
»Ich hatte ihn beauftragt, das Reckel-Haus zu beobachten«, erklärte ich Altdorfer. »Noch gestern teilte er mir mit, daß er einen weiteren Beobachter entdeckt habe. Heute ist er tot.«
»Was hast du an seinen Beinen gesehen?«
»Die Spuren eines Stricks, den das Wasser oder die Kette der Flöße heruntergezerrt haben. Ein Strick, mit dem seine Beine zusammengebunden waren.«
»Glaubst du, man hat ihn ...?«
»Ertränkt«, sagte ich. »So wie sie damals dieses Bürgermädchen in Straubing ertränkt haben, weil der Sohn des Herzogs sie heimlich geheiratet hatte. Das glaube ich. Aber warum? Was hat er gesehen oder gehört, das sein Todesurteil besiegelte?« Ich hieb mir mit der Faust in die andere Hand. »Wenn ich ihn nicht angeworben hätte, wäre er noch am Leben.«
Altdorfer sah mich an. Ich erwartete, daß er sagen würde: Du kannst nichts dafür; aber statt dessen fragte er: »Weißt du, wer der andere Beobachter ist?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung.«
Hanns Altdorfer schüttelte den Kopf, diesmal deutlicher. Er seufzte. »Mir wird bange«, sagte er schlicht. »Als wir die Tote in der Kirche fanden, machte ich mir Sorgen. Jetzt habe ich wirkliche Angst.«
Ich blickte ihn an. Ich dachte nach; über das blasse Gesicht des Toten im Versammlungsraum des Zunfthauses schob sich unvermittelt ein anderes Gesicht, aufgeschwemmt und entstellt. Über die blinkenden Münzen auf den Lidern schoben sich leergefressene Augenhöhlen. Ich sah Knöchel, in deren aufgedunsenes Fleisch tiefe Rillen gegraben waren.
»Um Gottes willen«, stieß ich hervor.
»Was hast du?«
Ich dachte an einen weiteren Strick um zwei Fußgelenke; an eine unscheinbare Delle unter einem Wirbel nassen, schwarzen Haares.
»Peter?«
»Der Mann, den sie am Freitag aus dem Wasser gezogen haben. Ich war zufällig bei der Bergung dabei.«
»Ich habe davon gehört.«
»Ich sah eine Schlinge um seine Beine, mit der man ihn wahrscheinlich gefesselt hatte. Und daß sein Schädel eingeschlagen war und die Männer am Wehr der Vermutung, diese Verletzung sei durch sein Anschwemmen ans Wehr geschehen, nicht viel Glauben geschenkt haben.«
Er hob die Schultern, aber der Blick in seinen Augen zeigte eher Entsetzen als Nichtbegreifen. Mir wurde klar, daß er trotz seines dicken Mantels fröstelte.
»Der Tote ist mir anfangs immer wieder im Kopf umgegangen«, sagte ich. »Aber dann habe ich ihn vergessen. Er war tot, und ich kannte ihn nicht, und sein Tod schien mir keinerlei Bedeutung für mich zu haben. Jetzt allerdings ...«
Ich drehte mich zu Hanns herum und klopfte ihm mit der Faust auf die Brust.
»Hat sich denn schon ein Angehöriger gemeldet?«
»Nicht daß ich wüßte; jedenfalls nicht bei mir. Vielleicht bei Hauptmann Seis auf der Burg.«
Ich dachte an das Siegel und die zerbrochenen Tonscherben, die der Stadtknecht in der Ledertasche des Toten gefunden hatte.
»Vermißt jemand einen Schreiber?« fragte ich.
Er riß die Augen auf.
»Wieso denn?« rief er.
»Der Tote hatte ein Siegel bei sich wie ein Schreiber.«
»Niemand hat mich darauf angesprochen«, sagte er. »Ich habe das noch gar nicht gewußt; ich wußte nur, daß man einen Ertrunkenen aus dem Wasser gefischt hat.« Er machte ein ärgerliches Gesicht, als ob er sich jetzt über die Schlamperei der Stadtwache mehr entrüstete als über die Todesfälle selbst.
»Wir sollten uns die Sache näher ansehen«, sagte ich. »Ich hätte mir die Sache schon viel früher näher ansehen sollen. Begleitest du mich zum Kapuzinertor? Ich muß mit den Torwächtern sprechen.«
Er nickte.
»Wenn du mir auf dem Weg dorthin mitteilst, worauf du eigentlich aus bist ... Ich fühle mich mehr und mehr im Dunkeln.«
»Ich auch«, murmelte ich so leise, daß er es nicht hörte. Er drehte sich zum Eingang des Zunfthauses um und schniefte. Ich starrte gleich ihm auf die geschlossenen Türflügel. Ich schauderte bei dem Gedanken an den toten Mann, der dahinter aufgebahrt lag.
Der Wappner, der müßig vor dem Eingang in die untere Turmkammer lümmelte, richtete sich auf, als er uns herankommen sah und schließlich den Stadtkämmerer erkannte. Er trat uns in den Weg und grüßte höflich. Ich sah ihm in die Augen und erkannte, daß er vor Schreck und Nervosität beinahe schielte. Das schlechte Gewissen strahlte von ihm aus, aber ich hielt mich nicht mit den Gedanken auf, was daran schuld sein mochte. Vielleicht war er kurz davor gewesen einzudösen, und wir hatten ihn aufgeschreckt.
Altdorfer grüßte zurück und blieb stehen, aber ich ließ mich nicht aufhalten. Ich murmelte eine Frage nach der Anwesenheit des Wachführers und wartete nicht erst auf die Antwort. Ich war in Eile und sorgte mich darum, was ich noch alles sträflich unterlassen haben mochte, und ich hatte keine Zeit für Höflichkeiten. Altdorfer folgte mir auf dem Fuß, und der junge Stadtknecht flatterte uns unglücklich hinterher, als ich auf die Tür zutrat und sie entschlossen öffnete.
Es waren drei Männer in der engen, dunklen Stube, und sie fuhren erschrocken auseinander, als das Licht von der Türöffnung auf sie fiel. Eine junge Frau mit schmutzigen Haaren streifte hastig ihren Rock über die Oberschenkel hinunter und versuchte, mit dem schäbigen Vorderteil ihres Kleids ihre nackten Brüste zu bedecken. Sie hatten eine Dirne bei sich in der Turmkammer. Einer der Männer warf einen Blick voll lodernden Zorns auf uns; ich erkannte ihn als den Offizier, der auch bei der Bergung des Toten am Freitag vor Ort gewesen war. Bevor er etwas sagen konnte, piepste der junge Kerl, den sie draußen als Aufpasser abgestellt hatten: »Der Herr Stadtkämmerer ist hier!«
Der Wachführer zog so hart die Nase hinauf, daß es sich anhörte, als ob er knurrte. Sein Gesicht lief feuerrot an. Er schluckte, dann machte er eine knappe Verneigung. Die anderen beiden Männer versuchten, in den Boden zu sinken; das Mädchen drückte sich in die Ecke und warf einen halb ängstlichen, halb ärgerlichen Blick zu uns herüber. Wir hatten ihr soeben ein Geschäft verpatzt.
»Was ist denn hier los?« fragte Hanns Altdorf er scharf.
Die beiden einfachen Wappner räusperten sich, während ihr Anführer es vorzog, den Blick in die Ferne zu richten und sich die Antwort zu ersparen. Ich drehte mich halb zu Altdorfer um und sagte: »Es ist schon in Ordnung, Hanns.«
Altdorfer zuckte unzufrieden mit den Schultern, erwiderte aber nichts mehr. Ich deutete auf die Dirne und sagte: »Verschwinde hier.«
Sie zog die Oberlippe verächtlich hoch, raffte sich aber auf und schritt wie eine Königin an uns vorbei. Als sie an mir vorbeikam, ließ sie das Oberteil ihres Kleides sinken und streifte mit einer bloßen Brust meinen Unterarm, dann kicherte sie höhnisch und lief nach draußen. Ich drehte mich nicht nach ihr um.
»Ihr habt am Montag einen Toten aus der Isar geborgen, draußen beim Bleichwehr«, sagte ich zu dem Wachführer.
Er sah mich vorsichtig an und sagte: »Das ist richtig, Herr.« Er fragte nicht, woher ich dies wüßte oder wie ich dazu käme, ihm Fragen zu stellen; vermutlich war er noch zu erschrocken von seiner eben erfolgten Blamage.
»Wo ist die Leiche jetzt?«
Er zog seine Augenbrauen erstaunt hoch.
»Wir haben sie verscharren lassen«, erwiderte er. Ich schnaubte verärgert; ich war tatsächlich zu spät. Ich wandte mich zu Hanns Altdorfer um und sagte resigniert: »Ich hätte mich gleich darum kümmern müssen. «
»Sie fing schon an zu stinken«, sagte der Wachführer zur Entschuldigung.
»Der Tote hatte eine Ledertasche, die Ihr untersucht habt. Was fandet Ihr darin?«
»Ein Siegel und einige Tonscherben.«
»Sonst nichts?«
»Nein.«
Ich fragte: »Hatte der Tote nicht einen eingeschlagenen Schädel und einen Strick um die Füße?«
»Das stimmt. Die Wunde an seinem Kopf sahen wir gleich; die Schlinge erst später. Sie war zu sehr in sein Fleisch eingesunken.«
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Altdorfer angeekelt den Kopf zur Seite wandte.
»Was glaubt Ihr, hat das zu bedeuten?« fragte ich. Der Wachführer zuckte gleichmütig mit den Schultern.
»Er wird mit dem Kopf irgendwo angeschlagen sein, als er den Fluß heruntertrieb«, erwiderte er. »Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht.«
»Und die Schlinge?«
Er verzog das Gesicht und antwortete nichts. Er hatte es nicht als seine Aufgabe angesehen, sich um den Zustand einer Wasserleiche, die man zufällig aus dem Fluß geborgen hatte, Gedanken zu machen.
Ich nickte langsam.
»Darf ich das Siegel sehen?« erkundigte ich mich dann.
Jetzt wurde er mißtrauisch. Er machte schmale Augen und musterte mich zum erstenmal eingehend; die Fragerei wurde ihm zuviel.
»Seid Ihr ein Angehöriger?« fragte er.
»Ihr sollt antworten, nicht Fragen stellen!« bellte Altdorfer.
»Ein Partner, dessen Geschäft ich mitführe, vermißt einen seiner Schreiber«, sagte ich glatt.
Der Wachführer brummte etwas, aber scheinbar war er zufrieden.
Er drehte sich zu einem seiner Männer um.
»Haben wir das Zeug des Toten noch da?«
Sie nickten eifrig, noch immer verwirrt von dem Schreck, der sie aus ihrer lüsternen Beschäftigung gerissen hatte, und bestrebt, den schlechten Eindruck wieder wettzumachen. Einer bückte sich zu einer verschlossenen Truhe, deren Schlüssel sinnigerweise auf einem Brett gleich darüber lag, öffnete sie und förderte nach einigem Kramen einen leinernen Beutel zutage, den er auf den Tisch legte. Der Wachführer nestelte das Band auf und schüttete den Inhalt heraus; Münzen, ein paar grünspanüberzogene billige Schmuckstücke und sonstiger Kleinkram, den man bei ihnen abgegeben oder den sie selbst gefunden und behalten hatten, rollten auf die Tischplatte. Das Siegel war darunter. Ich hob es auf und zeigte es Hanns Altdorfer.
Er hielt die Siegelfläche ins Licht und betrachtete sie. Seine Brauen zogen sich zusammen. Er warf mir einen raschen Blick zu, dann sah er sich um. Als er nicht fand, wonach er suchte, trat er nach draußen. Ich folgte ihm überrascht. Er suchte den Boden ab, kniete sich neben der Turmmauer am Rand der Straße nieder und fegte mit der Hand ein paar Steinchen von einer kleinen Fläche glatten, festgetretenen Lehmbodens. Mit der anderen Hand hob er das Siegel und rammte es fest in den Lehm. Ein schwacher Abdruck war zu erkennen, nicht besonders deutlich, aber für den Stadtkämmerer genügte er. Er sah zu mir auf und holte tief Luft. Er machte den Mund auf, aber ich schüttelte leicht den Kopf; er schloß ihn wieder und erhob sich. In seinem Gesicht arbeitete es. Er packte das Siegel fester.
»Wir nehmen es mit«, erklärte er den umstehenden Wappnern.
Der Anführer nickte ohne Widerspruch. Er wußte, daß er es nicht hätte behalten dürfen.
»Natürlich«, sagte er; dann drückte und drückte er und brachte schließlich heraus: »Wegen vorhin, Herr; ich bitte Euch zu verstehen ...«
Hanns Altdorf er sah ihn mit neu erwachendem Ärger an. Ich kam ihm zuvor.
»Es ist in Ordnung«, erwiderte ich rasch, und auch Altdorf er rang sich dazu durch zu sagen: »Laßt Euch ja nicht mehr erwischen.«
Er drehte sich ohne Gruß um und stapfte davon; bei seiner sonstigen Höflichkeit ein deutliches Zeichen seines Zorns, und diesmal trottete ich ihm hinterdrein. Außer Hörweite der Wappner sagte ich: »Du kennst das Siegel, nicht wahr?«
Er schnaubte und nickte.
»Es ist das des Richters«, sagte er.
Was hatte ich erwartet? Ich wußte es nicht – aber nicht das, soviel war sicher. Ich fragte: »Was jetzt?«
»Verdammt, daß der Richter in Burghausen festsitzt.
Ich muß unbedingt mit ihm sprechen. Ich möchte wissen, warum er mir nichts davon gesagt hat, daß einer seiner Schreiber fehlt.«
Ich gab ihm keine Antwort. Mir wurde klar, daß ich damit gerechnet hatte, daß uns eine nähere Untersuchung des Toten oder seiner Hinterlassenschaft weiterhelfen würde; statt dessen standen wir vor einer neuen Ungereimtheit. Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen. Altdorfer betrachtete mich und sagte: »Du hast fest geglaubt, der Tote würde uns weiterbringen, nicht wahr?«
Ich nickte stumm. Er seufzte.
»Ich glaubte es beinahe auch schon. Du warst sehr überzeugend.«
»Das Gefühl, daß er wichtig wäre, kam über mich wie eine Eingebung«, sagte ich. »Ich wäre besser bei dem geblieben, was man sehen kann, anstatt einem Gefühl nachzulaufen.«
Altdorfer schniefte und sagte nichts mehr. Wir gingen eine Weile schweigend nebeneinander her, durch die ruhige Neustadt, an deren nördlichem Ende der Geruch der Malztennen zwischen den Hausfassaden lag und im Nieselregen von klebriger Süße war wie verrottendes Heu. Wir waren schon fast an der Einmündung der Rosgasse, an der nur noch der Name an die dichten Bestände von Schilf und Rosgras erinnerte, die vor der Stadterweiterung hier gewuchert hatten, als Altdorfer plötzlich sagte: »In Wahrheit bist du nicht überzeugt davon, daß der tote Schreiber für uns keine Rolle spielt; habe ich recht?«
»Ja«, antwortete ich widerwillig. »Aber ich kann ihn nirgends unterbringen. Ich weiß noch nicht einmal, ob es uns geholfen hätte, wenn der Leichnam noch hier gelegen hätte, mit einem Schild um den Hals, wie und warum er ums Leben gekommen ist.«
Altdorfer wog das Siegel in der Hand.
»Vielleicht sollten wir mit den Schreibern des Richters sprechen«, überlegte er und fügte in einem Anfall von Sarkasmus hinzu: »Jedenfalls mit denen, die noch am Leben sind.«
»Später«, sagte ich. »Ich habe genug Zeit vertan mit dieser unglücklichen Wasserleiche; ich muß zur Baustelle.«
Er zuckte mit den Schultern und sah mich unschlüssig an. Ich klopfte ihm auf die Schulter und verließ ihn, am Anfang der Grasgasse stehend, die zum Rathaus hin führte. Er blickte mit gerunzelter Stirn auf das Siegel nieder, das er in seiner Hand hielt, und machte ein Gesicht, als könne es sich plötzlich in einen Hundekötel verwandeln.
Ich marschierte bis zur Pfarrgasse, die an der Pfarrschule vorbei zur Baustelle der Kirche führte; ich war überrascht, als ich sie von einigen Dutzend Menschen bevölkert sah, die wie ich in Richtung Altstadt strebten. Meine überreizte Phantasie veranlaßte mich sofort zu dem Gedanken: Es ist wieder etwas passiert!, aber die Leute unterhielten sich und schienen es nicht besonders eilig zu haben. Man hatte eher den Eindruck, daß es dort, wo sie hinwollten, etwas zu sehen gäbe, das nicht unbedingt von eminenter Wichtigkeit war, das man aber dennoch nicht versäumen sollte. Ich überholte die meisten von ihnen auf dem Weg zur Kirche; als ich um die Ecke bog, hinter der sich der Kirchhof erstreckte und dahinter der gewaltige Rundbogen des Chorhauses erhob, wurde mir klar, daß wir alle dasselbe Ziel hatten: die Baustelle des Domes.
Es waren nicht so viele Menschen, daß man es für einen Aufstand hätte halten können; allenfalls ein- oder zweihundert, und sie unterhielten sich friedlich und wandten nur ab und zu den Kopf und streckten die Hälse, um zur Kirche hinübersehen zu können. Weder auf dem Dach noch auf dem Turmgerüst, noch sonst irgendwo auf der Baustelle sah ich auch nur einen Arbeiter. Ganz offensichtlich wurde auch heute nicht gearbeitet; nur die Zuschauer waren anwesend. Sie standen oder gingen in dem engen Platz zwischen den Häusern und Bauhütten und der wuchtigen Fassade des Langschiffs umher. Ich drängte mich durch sie hindurch, um zur Kirche selbst zu gelangen, und stand plötzlich vor dem quergehaltenen Spieß eines Wappners, der mich am Weitergehen hinderte. Ich sah mich um: Zusammen mit seinen Kameraden bildete er einen engen Ring um die Baustelle und ließ niemanden passieren.
»Die Baustelle darf nicht betreten werden«, sagte er nicht unfreundlich.
»Ich möchte mit einem der Steinmetze sprechen«, erwiderte ich. »Er ist mein Sohn.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Er ist nicht da.«
»Woher wollt Ihr das wissen?«
»Heute wird nicht gearbeitet«, beschied er mich.
»Dann möchte ich zu Meister Stethaimer«, hörte ich mich sagen. Im gleichen Moment dachte ich: Ich weiß gar nicht mehr, wie der Baumeister aussieht; ich habe ihn nur ein einziges Mal gesehen. Jemand wird ihn mir vorstellen müssen.
Der Wappner zeigte erste Anzeichen von Ungeduld.
»Heute nicht«, sagte er bestimmt.
»Was ist denn passiert?«
»Nichts.«
Ich sah mich hilflos um; ein Mann mit einem feinen Mantel, der in meiner Nähe stand, beugte sich zu mir herüber und sagte: »Der Herzog wird angeblich mit seinem Hofstaat die Baustelle besuchen; deshalb lassen sie keinen durch.«
»Der Herzog? Herzog Ludwig?«
»Mit seinem Sohn, dem jungen Prinzen, und Bischof Bernhard von Salzburg.«
»Und was machen all die Leute hier?« fragte ich und wies auf die Umherstehenden.
»Wir sehen sie uns an«, sagte er mit einem erstaunten Unterton, als wäre meine Frage von ausgesuchter Torheit. »Was macht Ihr denn hier?«
»Ich habe etwas auf der Baustelle zu erledigen.« Er grinste plötzlich.
»Heute nicht«, wiederholte er fröhlich die Ablehnung, mit der mich schon der Wappner bedacht hatte. Er wandte sich ab, und ich trat wieder auf den Mann mit dem Spieß zu.
»Ich habe etwas Dringendes mit Hans Stethaimer zu besprechen«, sagte ich erneut. »Ich bitte euch, mich zu ihm vorzulassen.« Mit einer Hand fischte ich ein paar Pfennige aus der Tasche und ließ sie in sein Wams gleiten. Er warf seinen Kameraden links und rechts neben sich verstohlene Blicke und wechselte unschlüssig den Griff an seinem Spieß.
»Wir dürfen niemanden durchlassen, bis der Herzog die Baustelle wieder verlassen hat«, erklärte er mir.
»Der Herzog ist ja noch gar nicht angekommen«, gab ich ihm zu bedenken.
Er überlegte, ohne den Spieß zur Seite zu nehmen.
Ich wartete voller Ungeduld; wenn ich noch ein paar kleinere Münzen gehabt hätte, hätte ich seinem Denkprozeß ein wenig nachgeholfen. Plötzlich schritt eine Gruppe von Männern aus dem östlichen Eingangsportal ins Freie und sah sich um; einige von ihnen trugen lederne Schürzen. Zwischen ihnen stand eine gebeugte Gestalt mit fein geschmücktem Wams, und entgegen aller Erwartungen erkannte ich sein Gesicht auf Anhieb wieder. Es brauchte nicht die neben mir stehenden Leute, die mit den Fingern auf ihn zeigten und zu tuscheln anfingen.
»Dort ist der Baumeister«, sagte ich und wies auf die Gruppe. »Nun laßt mich bitte zu ihm durch.«
Der Wappner konnte sich noch immer nicht entschließen, den Weg freizugeben; der Widerstreit seiner Gefühle spiegelte sich deutlich in seinem Gesicht. Stethaimer stieg mit seinen Begleitern die wenigen Stufen auf den Platz herunter und setzte sich zum westlichen Portal hin in Marsch, direkt in unsere Richtung. Ein paar der weiter hinten stehenden Zuschauer drängten sich heran, um festzustellen, ob es sich bei ihm und seinen Männern nicht vielleicht schon um einen der erwarteten Würdenträger handle, und ich erhielt ein paar Stöße in den Rücken.
Ich holte Luft und rief: »Herr Stethaimer!«
Er drehte sich um und suchte mit den Blicken nach mir. Ich hob eine Hand und winkte ihm zu, und er kniff die Augen zusammen. Ich seufzte; er versuchte, mich zu erkennen. Da er mich nur ein einziges Mal gesehen hatte, und das vor mehreren Jahren, würde er im nächsten Moment mit den Schultern zucken und weitergehen. Einen der Landshuter Kaufleute und reichen Bürger hätte er wohl auf Anhieb erkannt; sie überschlugen sich mit ihren Gunstbeweisen ihm gegenüber und mit Einladungen zu gewaltigen Menüs. Ich war in den vergangenen Jahren noch nicht einmal oft genug in die Nähe der Baustelle gekommen, um mir das Gesicht des Baumeisters seit unserer ersten und letzten Begegnung genügend einzuprägen. Ich hob die Hand erneut und bedeutete ihm, zu mir zu kommen.
»Ich muß Euch sprechen!« rief ich.
Ich erhielt noch ein paar Stöße in den Rücken, als sich weitere Zuschauer herandrängten, um zu erfahren, was vor sich ginge. Die mir zunächst standen, starrten mich voll stummer Neugier an. Ärger ergriff mich.
»Nun kommt doch schon!« sagte ich laut, als Stethaimer noch immer zögerte.
Unwillkürlich trat er die paar Schritte auf mich zu.
»Was wollt Ihr von mir?« fragte er ungeduldig.
»Ich muß ein paar Dinge mit Euch besprechen. Dringend«, sagte ich.
Der Baumeister starrte mich unwirsch an. Ich sah Schatten unter seinen Augen und ein aufgeregtes Zucken um seine Lider. Er war nervös. Seine wenigen grauen Haare standen vom Kopf ab wie ein verblaßter, lückenhafter Hahnenkamm, und seine Stimme klang schrill und hastig. Er taxierte mich kurz. Ich konnte sehen, daß er sich über mich wunderte; meiner Kleidung nach war ich keiner der üblichen Bittsteller und Arbeitssuchenden. Einen Moment lang zögerte er, aber seine Nervosität gewann die Oberhand.
»Ich habe jetzt keine Zeit; der Herzog wird jeden Moment kommen«, stieß er hervor. Er wandte sich brüsk ab und wollte gehen.
»Erinnert Ihr Euch nicht mehr an mich?« fragte ich ihn.
Er drehte sich wieder um und schüttelte den Kopf. »Ich bedaure«, sagte er.
»Ich bin Peter Bernward. Mein Sohn Daniel ist einer Eurer Gesellen.« Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl dabei, mich mit dem Namen meines Sohnes auszuweisen. Eigentlich hätte es umgekehrt sein sollen. Es wäre umgekehrt gewesen, wenn ich mich öfter in der Stadt hätte blicken lassen.
Das Gesicht des Baumeisters hellte sich auf.
»Ich freue mich«, sagte er. »Wenn ich mich auch nicht mehr an Euch erinnern konnte. Wir sind uns begegnet, als Ihr Euren Sohn bei mir angemeldet und den Lehrpfennig bezahlt habt, nicht wahr?«
»So ist es. Kann ich ein paar Minuten Eurer Zeit beanspruchen? «
»Herzog Ludwig besucht die Baustelle«, erwiderte er unentschlossen.
»Ich weiß. Es dauert nur ein paar Augenblicke.«
»Also gut«, seufzte er. Er stemmte die Hände in die Hüften und sah mich erwartungsvoll an. Ich verdrehte innerlich die Augen.
»Können wir uns vielleicht ein paar Schritte beiseite begeben?« fragte ich.
Stethaimer zuckte zusammen und machte ein schuldbewußtes Gesicht.
»Entschuldigt«, murmelte er. »Ich bin schon ganz verwirrt. Natürlich.« Er tippte dem Wappner auf die Schulter, und dieser stellte den Spieß senkrecht und ließ mich an sich vorbeischlüpfen. Ich trat an die Außenmauer der Kirche; Stethaimer folgte mir.
»Gerade jetzt muß der Herzog auftauchen«, stöhnte er, als wolle er mir sein aufgebrachtes Verhalten erklären. »Wir sind mit allen Arbeiten im Verzug, und er hält uns noch zusätzlich auf.«
Ich lächelte verständnisvoll und hatte das Gefühl, ich müsse etwas zu seiner Klage bemerken.
»Mein Sohn hat mir erzählt, daß die Arbeiten bereits gestern ruhen mußten.«
»Es stimmt; gestern war der Bischof von Salzburg auf der Baustelle – ohne den Herzog; er war wohl ans Bett gefesselt. Da er sich heute angeblich besser fühlt, wollte er es sich nicht nehmen lassen, Bischof Bernhard nochmals persönlich herzuführen. Dann sind da noch die anderen hohen Herren Prälaten, die mir ständig zwischen den Füßen herumlaufen und alle halb verrückt machen.«
Ich lächelte wieder und wollte zum Zweck meines Besuches kommen, aber sein Ärger hatte sich noch nicht genügend Luft gemacht.
»Und es sind alles erfahrene Baumeister«, sagte er mit beißendem Sarkasmus. »Ihr glaubt nicht, was für Spezialisten unter den Bischofsmützen stecken; ein jeder hat schon mindestens eine doppelt so große Kirche wie diese hier gebaut.«
Stethaimer machte eine verächtliche Geste, und ich dachte daran, wie sehr Daniel sich in seiner Beurteilung des Baumeisters getäuscht hatte.
»Hat mein Sohn mit Euch gesprochen?« fragte ich ihn endlich. Er schüttelte erstaunt den Kopf.
»Worüber?«
Ich seufzte. Offenbar hatte ich Daniel zu gründlich eingeredet, daß die Angelegenheit nebensächlich sei.
»Er hat mir von einem Mann auf Eurer Baustelle erzählt, mit dem ich unbedingt sprechen möchte«, sagte ich. »Er wollte Euch darauf hinweisen.«
»Ich habe mit Eurem Sohn schon länger nicht mehr gesprochen«, erwiderte er. »Er ist zu gut, als daß man ihn oft beaufsichtigen oder anleiten müsse. Aber es ist kein Problem. Wie heißt der Mann, mit dem Ihr reden wollt?«
»Ich weiß leider seinen Namen nicht«, sagte ich zähneknirschend.
»Dann ist es doch ein Problem«, entgegnete er betroffen.
»Vielleicht können wir meinen Sohn hinzuziehen?«
»Ich habe allen Gesellen und Arbeitern freigegeben; ich weiß nicht, wo er sich aufhält. Nur die Meister sind auf der Baustelle geblieben.«
»Einer der Meister könnte ihn kennen, wenn ich ihn beschreibe«, schlug ich vor. Er zuckte mit den Schultern.
»Fragen wir sie«, sagte er. »Aber beeilt Euch.«
Tatsächlich war der Mann einem der Steinmetze ein Begriff, nachdem ich seine Eigenarten und seine vermutliche Heimatstadt angesprochen hatte.
»Ich habe ihn bei einem meiner Gesellen als Gehilfen angestellt; ein geschickter Mensch«, meinte er.
»Könnt Ihr mich mit ihm zusammenbringen?«
»Ich fürchte, nein«, sagte er gelassen. »Er arbeitet nicht mehr hier.«
»Seit wann?« ächzte ich.
Er sah nach oben, um nachzudenken. Im selben Moment ging eine Bewegung durch die Zuschauer, die außerhalb des Kordons der Wappner auf den Herzog und seine Begleitung warteten; wie ein Windstoß durch hohes Gras fährt, wandten sich alle ihre Köpfe der Altstadt zu, und ein Raunen wurde hörbar. Stethaimer drehte sich um. Sein Gesicht verschloß sich.
»Der Herzog kommt«, sagte er. »Ihr müßt gehen.«
Es war niemand zu sehen; aber irgendwo weiter vorne klatschte plötzlich jemand in die Hände, und ein anderer rief etwas, und in Sekundenschnelle klatschte über die Hälfte der Wartenden oder schrie fröhlich durcheinander. Stethaimer wandte sich ab und machte eine fahrige Abschiedsgeste. Seine Meister scharten sich um ihn, mit einemmal ebenso nervös wie der Baumeister selbst; der eine oder andere zerrte an seiner Lederschürze oder strich sich die Haare glatt.
Ich setzte den Männern einen Schritt nach und faßte meinen Gesprächspartner am Arm.
»Wann hat er die Baustelle verlassen?« fragte ich drängend. »Bitte sagt es mir.«
Er rechnete im Gehen mit den Fingern nach und bewegte dabei die Lippen.
»Am Dienstag kam er nicht mehr zur Arbeit«, sagte er dann. »Deshalb ließ ich ihn von der Lohnliste streichen. «
»Hat sich niemand danach erkundigt, ob ihm etwas zugestoßen ist?«
»Er hat keine Anschrift hinterlassen, unter der wir ihn in der Stadt ausfindig machen konnten. Den Zunftschreibern war er auch nicht bekannt.« Er zuckte mit den Schultern. »Unter normalen Umständen hätten wir ihn gar nicht eingestellt, aber bei all dem Gesindel, das hier bei uns vorspricht, war er ein echter Lichtblick.«
»Also weiß niemand, was aus ihm geworden ist.«
Er zuckte nochmals mit den Schultern. Es war Antwort genug. Als ich nichts mehr darauf sagte, wandte er sich endgültig ab und ließ mich stehen. Ich trat auf die Wappner zu, und der mir zunächst Stehende hob seinen Spieß halb in die Höhe und ließ mich darunter durch wieder auf die andere Seite treten. Die Leute dort rückten unwillig beiseite; sie hatten diesen Platz mit vielen Püffen und Ellbogenstößen bezahlt, und nun kam ich und machte ihn ihnen streitig. Dennoch pöbelte mich niemand an: Der Umstand, daß ich von innerhalb der Absperrung gekommen war, verschaffte mir einen ungewissen Respekt. Ich drehte mich um und sah Stethaimer und seinen Männern nachdenklich hinterher, die sich am westlichen Seitenportal aufstellten und auf den Herzog und seine Begleiter warteten. Stethaimer strich sich mit den Handflächen über sein Wams.
Herzog Ludwig näherte sich um das ausladende Gerüst des Turmes herum; wie eine Welle in einem Teich lief ihm der Jubel in der Zuschauermenge ein paar Schritte voraus. Sie applaudierten nicht, weil er der Herzog und der Stadtherr war oder weil sie ihn ganz besonders geliebt hätten; sie hätten auch einem Tanzbären zugejubelt, den ein Vagant um die Ecke führte. Er und sein Gefolge stellten lediglich eine willkommene Abwechslung dar. Ich versuchte, mich nach draußen zu drängen, aber jetzt schoben sich die hinten Stehenden nach vorne und verkeilten die Menge so sehr, daß an ein Durchkommen nicht zu denken war. Es bereitete mir schon Mühe, mich so weit umzudrehen, daß ich dem Kirchenbau wieder das Gesicht zuwandte. Wohl oder übel blieb ich an vorderster Front der Zuschauer stehen; es war ein schwacher Trost, daß ich von meinem Standort aus einen vorzüglichen Blick auf das Geschehen hatte.
Der Herzog konnte nicht aus eigenen Kräften gehen oder stehen; insofern war der Vergleich mit einem Tanzbären noch nicht einmal weit hergeholt. Wie ein türkischer Potentat ließ er seinen massigen Körper in einer Sänfte herumtragen; das Podagra hatte ihn in seinem schmerzhaften Griff. Ludwig führte die kleine Prozession an. Hinter seiner Sänfte befand sich mindestens ein Dutzend vornehm gekleideter Herren mit festen Wamsen, ausladenden Hüten und eng anliegenden, zweifarbigen Beinlingen, sowie zwei in das Weiß ehrwürdiger Prälaten gekleidete Männer mit hohen, goldglitzernden Bischofsmützen. Ich kniff die Augen zusammen, um sie besser sehen zu können. Ich kannte keinen der beiden Kirchenmänner; sie waren mittelgroße, rundliche Herren mit gesunder Gesichtsfarbe und roten Apfelbäckchen, die demonstrativ beeindruckt von der Konstruktion und der Wucht des Kirchenbaus, den sie alle mindestens schon dreimal besichtigt hatten, bald hierhin, bald dorthin deuteten und die Köpfe in die Nacken legten, bis ihre Tiaren ins Wanken gerieten. Der junge Herzog Georg ging hinter ihnen. Er winkte ein paarmal, als er seinen Namen aus der Menge rufen hörte, aber die Geste schien mir halbherzig, und sein hübsches Gesicht unter den langen Locken war eher verschlossen und trotzig. Auch der Kanzler, der schweigend zwischen den aufgeputzten Höflingen herschritt und sich in seinem dunklen Mantel auffallend von den bunt gekleideten Männern abhob, machte ein finsteres Gesicht. Er sah nicht links und nicht rechts und erblickte mich nicht, obwohl er so nahe an meinem Platz vorbeiging, daß ich ihn mit einem Steinwurf hätte treffen können, ohne dabei besonders auszuholen. Ich war mir sicher, daß er, selbst wenn er aufgeblickt und mich erkannt hätte, nicht mit der Wimper gezuckt hätte. Er schien tief in Gedanken versunken und ungehalten darüber zu sein, daß man ihn mit dieser Repräsentationspflicht von seinen Aufgaben abhielt. Sein Anblick munterte mich dennoch auf; wenn er wieder zurück war, konnte ich ihn später vielleicht sprechen.
Die von Hans Stethaimer geleitete Gruppe und die Prozession des Herzogs trafen vor dem westlichen Seitenportal der Kirche zusammen; der Baumeister und seine Männer beugten das Knie, erhielten ein freundliches Winken von Herzog Ludwig und einen Segen, den die zwei beeindruckten Bischöfe mit inbrünstigen Gesten erteilten, und ohne lange zu zögern, verschwanden beide Gruppen in der Kirche. Die Flügel des Portals schlossen sich dumpf, zwei Wappner stellten sich breitbeinig davor auf, und das Schauspiel war vorüber, noch bevor es richtig begonnen hatte.
Es dauerte noch eine geraume Weile, ehe sich die Menge wieder zerstreute und ich endlich ohne Schwierigkeiten meinen unwillkommenen Ausblick aufgeben konnte. Wir waren am Montag abend überfallen worden, und am Dienstag morgen war der neue Hilfsarbeiter nicht mehr auf der Baustelle aufgetaucht. Ich dachte an das Gesicht des jungen Mannes, der zusammen mit seinem finsteren Gesellen den Eingriff der Wappner überlebt hatte. Es war vor panischer Angst verzerrt gewesen, als der Truppführer der Stadtknechte ihn anschrie. Er hatte nichts gesagt; hätte er es getan, wären die Worte sicherlich mit der Klangfärbung des Ingolstädter Dialekts herausgekommen. Ich nickte freudlos; ich war mir sicher, daß ich dem Meister Hans Stethaimers hätte sagen können, wo sich sein spurlos verschwundener Arbeiter befand.